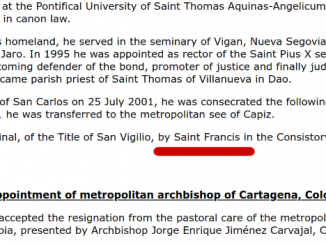Der katholische Journalist und Buchautor Alessandro Gnocchi konvertierte im Oktober 2019 zum russisch-orthodoxen Patriarchat von Moskau. Gnocchi, der Geschichte und Philosophie studierte, veröffentlichte zusammen mit dem Philosophen Mario Palmaro bis zu dessen frühem Tod 2014 mehrere Bücher und Kommentare, mit denen sie zu den ersten und schärfsten Kritikern des Pontifikats von Papst Franziskus gehörten, darunter der unvergessene Artikel: „Dieser Papst gefällt uns nicht“. Dafür wurden die beiden Autoren von Radio Maria Italien entlassen, wo sie eine eigene Sendereihe verantworteten. Nach Palmaros Tod wurde es ruhiger um Gnocchi, bis es zu seinem Übertritt zum Moskauer Patriarchat kam. Dieser bildet die Endstation der Enttäuschung über die kirchliche Entwicklung in den vergangenen Jahren und der Abneigung gegen das Pontifikat von Papst Franziskus. Im Januar veröffentlichte Gnocchi sein jüngstes Buch, mit dem er seine Apostasie von der katholischen Kirche zu rechtfertigen versucht und für unwiderruflich erklärt. Dagegen erhebt der Historiker Prof. Roberto de Mattei, ein Vordenker der katholischen Tradition, energisch seine Stimme und warnt vor einer solchen Versuchung, die es in einigen katholischen Kreisen gebe, aus Opposition zum derzeitigen Nachfolger des Petrus so weit zu gehen, sogar in die Apostasie zu fallen.
Die traurige Apostasie von Alessandro Gnocchi
Von Roberto de Mattei*
Der Verlust einer Seele ist immer eine schmerzhafte Angelegenheit, aber er ist noch viel schmerzhafter, wenn er für andere Seelen zum Ärgernis wird. Dies ist der Fall bei der Apostasie von Alessandro Gnocchi, der in einem Buch „Zurück zu den Quellen. Meine Pilgerreise in den Osten in das Herz der Orthodoxie“ („Ritorno alle sorgenti. Il mio pellegrinaggio a Oriente nel cuore dell’Ortodossia“, Verlag Monasterium, 2023, 170 Seiten) verkündet, daß er der katholischen Kirche den Rücken gekehrt hat, um sich dem „Moskauer Patriarchat, orthodoxe Ökumene“ anzuschließen (S. 14).
Er ist jetzt „Aleksandr“ und seine Seele gehört nicht mehr der Kirche, sondern seinem „Starze“: „Einer, der Seele und Willen eines anderen in seine Seele und in seinen Willen aufnimmt“ (F. Dostojewski: Die Brüder Karamasow). Unter der Führung des Starez glaubt er, den „Weg der Heiligkeit“ (S. 30) eingeschlagen zu haben. Sein Herz liegt „auf dem Berg Athos, dem Hagion Oros, dem Heiligen Berg, in der Verehrung der wahren Heiligen“ (ebd.). Alles was „in meinem Buch steht“, sagt er, „ist der Abschluß einer Arbeit, die ich mit meinem Starez unternommen habe“ (S. 103).
Ich kenne und schätze Alessandro Gnocchi seit 2009. Er stellte bei mehreren Gelegenheiten meine Geschichte des Zweiten Vatikanischen Konzils vor, die 2010 im Verlag Lindau erschienen ist [deutsche Ausgabe 2011], und ich rezensierte in der Tageszeitung Il Foglio das von ihm und Mario Palmaro (1968–2014) herausgegebene schöne Buch „Dornröschen. Warum die Kirche seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil in der Krise ist und warum sie wieder erwachen wird“ („La Bella addormentata“, Verona 2012). Die „schlafende Schönheit“ ist nach Gnocchi und Palmaro die Braut Christi, die in ihrem göttlichen Aspekt ihre Schönheit unverändert bewahrt, aber in eine tiefe Lethargie versunken zu sein scheint. „Schön, weil die katholische Kirche trotz unserer Sünden, unserer Schwächen, unseres Verrats und unserer Irrtümer immer noch die unbefleckte Braut Christi ist und sein wird“ (S. 5).
Heute jedoch lehnt Gnocchi diese „unbefleckte Braut Christi“ ab und ersetzt die Stimme ihrer Päpste, ihrer Kirchenlehrer und ihrer Heiligen durch die der russischen Starzen, die vom Moskauer Patriarchat abhängig sind. Seine Abtrünnigkeit wird auch in einigen traditionalistischen Publikationen und Blogs als eine ernsthafte und schmerzhafte geistliche Entscheidung dargestellt. Dies bestätigt die Situation der tiefen Verwirrung, in der sich diese Welt seit einigen Jahren befindet.
Im Grunde verachtet Gnocchi seine oberflächlichen Apologeten, weil er im Gegensatz zu ihnen kein Synkretist ist. Die Ablehnung des Ökumenismus ist der einzige Punkt, in dem er mit seiner Vergangenheit übereinstimmt. Für ihn ist die theologische Versöhnung zwischen der Orthodoxie und der katholischen Kirche „technisch“ unmöglich: „Die Einheit der Kirchen erscheint immer mehr als eine Schimäre, die in Wirklichkeit dazu bestimmt ist, gute Gefühle zu enttäuschen, die auf nichts beruhen…“ (S. 113). Seine Ablehnung der römischen Kirche ist vollständig und nicht verhandelbar. Die katholische Religion wird als „römische Hemisphäre“ bezeichnet, „blind und fruchtlos“ (S. 62). Petrus habe keine Nachfolger gehabt (S. 105): „Der Papst von Rom ist also nur ein Bischof, mehr nicht“ (S. 106) und die „päpstliche Ideologie“ (107) habe sich endgültig von Christus entfernt. Bei ihm war es eine sofortige „Bekehrung“ in umgekehrter Richtung: „Als ich zum ersten Mal eine orthodoxe Pfarrei betrat, während die Göttliche Liturgie gefeiert wurde, war mir sofort klar, daß ich, der ich mit der Idee hineingegangen war, römisch-katholisch zu sein, als Russisch-Orthodoxer herauskommen würde. Und so geschah es“ (S. 80). „Es war mir ebenso klar“, schreibt er weiter, „daß die römische Kirche seit den ersten Jahrhunderten den dämonischen Versuchungen erlegen ist, die Jesus in der Wüste zurückgewiesen hat“ (S. 97).
Diese Position, so deutlich zum Ausdruck gebracht, ist nicht nur schismatisch, sondern offen häretisch. Nachdem das Erste Vatikanische Konzil den Primat des römischen Pontifex als Glaubenswahrheit definiert hat, ist ein Schisma ohne Häresie nicht mehr möglich. Die Folge dieser Abtrünnigkeit ist die Autokephalie. Alle fühlen sich als kleine „Päpste“ und werden zu „Protestanten“. Denn was, wenn nicht Protestantismus, ist letztlich die russische schismatische Religion, die 1589 aus einer Laune des Zaren Fjodor (Theodor) I. Iwanowitsch entstand, als im Kreml das Moskauer Patriarchat errichtet wurde? Seitdem hat sich von allen Ostkirchen das „Dritte Rom“ als Hauptrivale der katholischen Kirche präsentiert.
Niemand sage, daß die schismatische Ostkirche durch die Beibehaltung der Gültigkeit der Sakramente einen geistlichen Vorbehalt aufrechterhält. Die Gültigkeit der Sakramente bedeutet tatsächlich nicht, daß das geistliche Leben fließt. Die Sakramente sind instrumentelle, wirksame Ursachen, die, wie jedes aktive Prinzip, die Bereitschaft des Empfängers voraussetzen, um ihre Wirkung zu entfalten. Es gibt keine Heiligkeit außerhalb des Gnaden-Lebens, aber es gibt auch keine echte Gnade außerhalb der katholischen Kirche. Wer die katholische Kirche verläßt, um zur sogenannten Orthodoxie überzuwechseln, begeht eine Todsünde der schwersten Art. Durch die Gnade empfangen wir die göttliche Person des Heiligen Geistes, die Heilige Dreifaltigkeit wohnt in unserer Seele, und sie wird zur Braut Gottes; durch die Gnade werden wir mit den theologischen und moralischen Tugenden durchdrungen und empfangen die sieben Gaben des Heiligen Geistes. Wer sich aber in der Todsünde befindet, ist der Wirkung der heiligmachenden Gnade beraubt.
Es hat völlig recht, wer die Orthodoxie einen „verdorrten Zweig“ nennt, der nur für das Feuer gut ist. Der übernatürliche Saft fließt nicht im Stamm der falschen Religionen. So stellt Joseph de Maistre treffend fest: „Alle diese Kirchen, die sich zu Beginn des 12. Jahrhunderts vom Heiligen Stuhl getrennt haben, können mit gefrorenen Leichen verglichen werden, deren Formen durch die Kälte bewahrt wurden“ (Lettre à une dame russe sur la nature et les effets du schisme, in: Lettres et opuscules inédits, A. Vaton, Paris 1863, Bd. II, S. 406).
Es ist wahr, daß man sich auch in nicht-katholischen Religionen auf außergewöhnliche Weise retten kann, trotz ihrer Irrtümer, aber Alessandro Gnocchi ist kein Muschik [einfacher Bauer im Zarenreich], der sich der katholischen Wahrheit nicht bewußt ist: Er ist ein getaufter Mann, der, nachdem er den wahren Glauben kennengelernt und bekannt hat, diesen öffentlich ablehnt und seine „bewußte Rückkehr zur Orthodoxie“ (S. 39) als „unwiderruflichen Schritt“ (S. 81) bezeichnet.
Wer sich in bewußter und unwiderruflicher Todsünde befindet, entzieht sich endgültig dem Einfluß der Gnade. Aus diesem Grund lehrt die Enciclopedia Cattolica, daß „der Schismatiker, der sich freiwillig außerhalb der Kirche befindet, nicht am göttlichen Leben des mystischen Leibes teilnimmt und der Mittel zur Heiligung beraubt ist“ (Vincenzo Carbone: Schisma, Bd. XI, Spalte 116). Die Gnade ist ein göttliches Geschenk, das unendlich viel höher ist als alles Geschaffene. Und wenn es, wie der heilige Thomas sagt, größer ist, einen Sünder in den Zustand der Gnade zurückzubringen, als Himmel und Erde zu erschaffen (Summa Theologica, I, 2, q. 113, a. 9), was soll man dann von denen halten, die die Gnade hartnäckig zurückweisen? Ein Erdbeben wie das schreckliche in der Türkei, das eine Stadt oder eine Region zerstört, erschüttert uns zutiefst, aber noch viel mehr sollte uns der Ruin einer Seele durch den Verlust der Gnade erschrecken. Wir sagen das mit lauter Stimme. Der modernde Geruch der Moskauer Religion stößt uns ab, der Duft des ewigen Roms, der Kathedra der Wahrheit und der Mutter der Völker, zieht uns an. Wir empfinden jedoch großes Mitleid für Alessandro Gnocchi und für alle, die durch Schisma und Häresie versucht sind, auch wegen der Irrtümer und Sünden der höchsten Autoritäten der Kirche. Wir stehen vor einem Drama, das Nachdenken und Gebet erfordert. Niemand, angefangen mit dem Schreiber dieser Zeilen, kann sich vor solch zerstörerischen Stürzen sicher fühlen. Die Beharrlichkeit bis zum Schluß ist eine Gnade, die wir jeden Tag mit großem Vertrauen von der Mutter aller Gnaden erbitten müssen, die, nachdem sie 1917 die Bekehrung des schismatischen Rußlands und der ganzen Welt versprochen hatte, am 3. Januar 1944 die große Verheißung von Fatima in diesen Worten an Schwester Lucia zusammenfaßte: „In der Zeit ein Glauben, eine Taufe, eine heilige, katholische und apostolische Kirche. In der Ewigkeit den Himmel“ (Um Caminho sob o olhar de Maria, Edições Carmelo, Coimbra 2012, S. 267).
*Roberto de Mattei, Historiker, Vater von fünf Kindern, Professor für Neuere Geschichte und Geschichte des Christentums an der Europäischen Universität Rom, Vorsitzender der Stiftung Lepanto, Autor zahlreicher Bücher, zuletzt in deutscher Übersetzung: Verteidigung der Tradition: Die unüberwindbare Wahrheit Christi, mit einem Vorwort von Martin Mosebach, Altötting 2017, und Das Zweite Vatikanische Konzil. Eine bislang ungeschriebene Geschichte, 2. erw. Ausgabe, Bobingen 2011.
Bücher von Prof. Roberto de Mattei in deutscher Übersetzung und die Bücher von Martin Mosebach können Sie bei unserer Partnerbuchhandlung beziehen.
Einleitung/Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Corrispondenza Romana



![Der heilige Augustinus, Bischof von Hippo (396–430].](https://katholisches.info/tawato/uploads/2021/09/Augustinus-326x245.jpg)