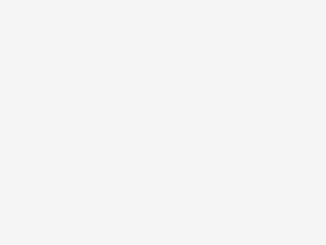Im nachfolgenden Aufsatz, den der Vatikanist Sandro Magister veröffentlichte, befaßt sich der Historiker Roberto Pertici mit dem Geschichtsdenken von Benedikt XVI., das dieser von der Heilsgeschichte ableitend in seiner Enzyklika Spe salvi vorgelegt hat. Der Tod Benedikts soll Anstoß sein, mit neuem Interesse und Ansporn sich mit seinen Texten zu befassen, besonders mit einem so weitreichenden Text wie Spe salvi, der eine differenzierte Antwort auf die Entwicklungen seit der Französischen Revolution gibt, differenzierter, als es die Kirche bisher getan hat, und jene (Fehl-)Entwicklungen aufzeigt, widerlegt und überwindet, die in eine selbstzerstörerische Sackgasse führen.
Die Nummern der jeweils von Prof. Pertici zitierten Absätze von Spe salvi sind in runden Klammern angezeigt.
Benedikt und die Geschichte
Von Roberto Pertici*
1
Die von Papst Benedikt XVI. am 30. November 2007 veröffentlichte Enzyklika Spe salvi ist ein Novum in der Gattung der Enzykliken, zu der auch sie gehört. Der flüssige Stil und der enge und ausdrückliche Vergleich mit einigen der größten Vertreter der zeitgenössischen Kultur, ob christlich oder nicht, verweisen auf die starke Persönlichkeit des Pastes. Wenn man bei den Enzykliken früherer Pontifikate manchmal die Frage stellen konnte, wer der eigentliche Autor war, so haben wir es hier mit einem Text zu tun, dessen Autorenschaft offensichtlich ist, der von dem Theologen und Seelsorger Ratzinger überlegt und geschrieben wurde. Darin will er einer Welt, in der die großen politischen Religionen des 20. Jahrhunderts „Schweigen und Finsternis“ sind und in der die einzige wirkliche Alternative die Wissenschaftsgläubigkeit in ihren verschiedenen Erscheinungsformen zu sein scheint, die christliche Hoffnung neu vorschlagen.
Als Geschichtswissenschaftler werde ich mich darauf beschränken, einige Überlegungen zur Sichtweise der menschlichen Geschichte anzustellen, die Benedikt in seinen Schriften zum Ausdruck bringt. Ich glaube nämlich, daß die geschichtliche Dimension und das Problem der „Gerechtigkeit in der Geschichte“ im Mittelpunkt der Enzyklika stehen und daß der Papst hier eine Lösung anbietet, die auf einige der Grundlagen des Christentums zurückgreift.
2
In der christlichen Geschichtsauffassung lassen sich zwei Archetypen ausmachen. Augustinus von Hippo sieht darin einen ewigen Kampf zwischen zwei „Städten“, der göttlichen und der irdischen, die gemeinsam vorhanden sind und bis zum Ende der Zeit miteinander in Konflikt stehen werden: Sie werden erst beim Jüngsten Gericht getrennt. Diese Aussage des Augustinus bleibt die radikalste Kritik am gesamten Millenarismus, d. h. an all jenen Vorstellungen, die immer wieder behauptet haben, daß die göttliche Stadt in einer mehr oder weniger nahen Zukunft unwiderruflich über die irdische Stadt siegen und in der Welt verwirklicht werden würde. Augustinus bestreitet, daß die durch die Erbsünde belastete Menschheit in der Geschichte eine vollständige Befreiung vom Bösen erfahren kann: Jede Generation muß daher ihren Kampf für den Triumph des Guten erneuern, wohl wissend, daß dieser Triumph niemals endgültig sein wird und daß es in der Tat auch Momente des „Rückfalls in die Barbarei“ geben kann. Das ist eine tragische Sichtweise, keine tröstliche: „Die Welt ist wie eine Presse, die auspreßt“, sagt Augustinus. „Wenn du Bodensatz bist, wirst du weggeworfen; wenn du Öl bist, wirst du gesammelt. Aber das Pressen ist unvermeidlich“.
Es gibt auch eine andere Linie, die der eschatologischen Tradition des frühen Christentums, die eine historische Verwirklichung des Reiches der Gerechtigkeit erwartete. Sie wird – ein Jahrhundert vor Dante – von Joachim da Fiore aufgegriffen, der eine vorsehungsbedingte Entwicklung des geschichtlichen Prozesses hin zu einem Zeitalter des Geistes voraussah, in dem sich die Menschheit voll verwirklichen würde. Es ist bekannt, daß eine Reihe von Wissenschaftlern des 20. Jahrhunderts (von Karl Löwith bis Eric Voegelin) den Joachimismus als ein entscheidendes Moment in der Historisierung der christlichen Eschatologie und damit als Voraussetzung für die Geschichtsphilosophie des 19. Jahrhunderts sahen.
Benedikt XVI. bleibt in der Sphäre einer augustinischen Geschichtsauffassung: Dies wird durch die Kritik bestätigt, die er an der Fortschrittsidee, einem typischen Produkt der Moderne, übt. Der Papst unterscheidet zwischen materieller Entwicklung (technisch, wissenschaftlich, wirtschaftlich) und moralischem Fortschritt. Erstere ist unbestreitbar und hat der Menschheit große Vorteile gebracht, aber sie zeigt auch ein zweideutiges Gesicht:
„Der Fortschritt bietet unzweifelhaft neue Möglichkeiten zum Guten, aber er öffnet auch abgründige Möglichkeiten des Bösen, die es ehedem nicht gab. Wir alle sind Zeugen geworden, wie Fortschritt in den falschen Händen zum grausamen Fortschritt im Bösen werden kann und geworden ist“ (Spe salvi, 22).
Aber auf dem Gebiet der Moral? Ist etwas Ähnliches wie die Anhäufung von Wissen, die man in der Wissenschaft hat, als „addierbarer“ Fortschritt, wie Benedikt sagt, denkbar? Ist es möglich, auf den ethischen Entscheidungen früherer Generationen aufzubauen, sie als unwiderruflich verwirklicht anzusehen und so die Möglichkeit des Bösen in der Welt schrittweise zu verringern, bis sie verschwindet? Stellt die Menschheit des 21. Jahrhunderts einen moralischen Fortschritt gegenüber der des 18. Jahrhunderts dar, weil sie ein Moratorium für die Todesstrafe verkündet hat, den Umweltschutz und die Gleichstellung der Geschlechter predigt? Wäre das der Fall, wäre auch das Christentum, so wichtig es auch sein mag, nur eine Etappe auf dem Weg der Menschheit, aber dazu bestimmt, von etwas Weiterem überholt zu werden, und das Ziel des „Übermenschen“, das sowohl Marx als auch Nietzsche auf unterschiedliche Weise predigen, hätte seine Plausibilität.
Der Pontifex hingegen erklärt:
„Aber im Bereich des moralischen Bewußtseins und des moralischen Entscheidens gibt es keine gleichartige Addierbarkeit, aus dem einfachen Grund, weil die Freiheit des Menschen immer neu ist und ihre Entscheide immer neu fällen muß. Sie sind nie einfach für uns von anderen schon getan – dann wären wir ja nicht mehr frei. Freiheit bedingt, daß in den grundlegenden Entscheiden jeder Mensch, jede Generation ein neuer Anfang ist. Sicher können die neuen Generationen auf die Erkenntnisse und Erfahrungen derer bauen, die ihnen vorausgegangen sind, und aus dem moralischen Schatz der ganzen Menschheit schöpfen. Aber sie können ihn auch verneinen, weil er nicht dieselbe Evidenz haben kann wie die materiellen Erfindungen“ (24).
Es gibt also keinen Fortschritt in der menschlichen Natur, sie kann sich nicht progressiv von den Grenzen befreien, die ihr innewohnen.
Noch weniger kann der Mensch darauf hoffen, daß die Lösung für seine Existenz von außen, von der Veränderung der Gesellschaft kommt. Nicht, daß der Kampf für eine bessere Gesellschaft nutzlos wäre, er ist sogar wünschenswert und notwendig, und die Politik kann einen großen Beitrag zur „Minimierung“ des Bösen leisten: Sie kann nur nicht dessen Wurzel zerstören und das Problem der menschlichen Freiheit endgültig lösen. Der Papst sagt:
„Der moralische Schatz der Menschheit ist nicht da, wie Geräte da sind, die man benutzt, sondern ist als Anruf an die Freiheit und als Möglichkeit für sie da. Das aber bedeutet:
a) Der rechte Zustand der menschlichen Dinge, das Gutsein der Welt, kann nie einfach durch Strukturen allein gewährleistet werden, wie gut sie auch sein mögen. Solche Strukturen sind nicht nur wichtig, sondern notwendig, aber sie können und dürfen die Freiheit des Menschen nicht außer Kraft setzen. Auch die besten Strukturen funktionieren nur, wenn in einer Gemeinschaft Überzeugungen lebendig sind, die die Menschen zu einer freien Zustimmung zur gemeinschaftlichen Ordnung motivieren können. Freiheit braucht Überzeugung; Überzeugung ist nicht von selbst da, sondern muß immer wieder neu gemeinschaftlich errungen werden.
b) Weil der Mensch immer frei bleibt und weil seine Freiheit immer auch brüchig ist, wird es nie das endgültig eingerichtete Reich des Guten in dieser Welt geben. Wer die definitiv für immer bleibende bessere Welt verheißt, macht eine falsche Verheißung; er sieht an der menschlichen Freiheit vorbei. Die Freiheit muß immer neu für das Gute gewonnen werden. Die freie Zustimmung zum Guten ist nie einfach von selber da. Gäbe es Strukturen, die unwiderruflich eine bestimmte – gute – Weltverfassung herstellen, so wäre die Freiheit des Menschen negiert, und darum wären dies letztlich auch keine guten Strukturen“ (24).
3
Die Idee eines unendlichen moralischen Fortschritts ist ein Kind der Moderne. Bedeutet die Kritik Benedikts XVI. also eine Rückkehr der Kirche zu einer polemischen Haltung gegenüber der modernen Welt und dem modernen Denken, das Ende jener Aufmerksamkeit für die „Zeichen der Zeit“, die eine der Früchte der Wende des Zweiten Vatikanischen Konzils war? Nirgendwo hat es ein so freundliches Beharren auf „moderner Welt“, „modernem Denken“, „Modernität“ gegeben wie in der katholischen Welt der vergangenen Jahrzehnte.
Aber das nachkonziliare katholische Denken hatte seine Gründe: Es wollte die Zeit der Gegensätze abschließen, die Zeit, in der der Abstraktion „moderne Welt“ eine andere Abstraktion gegenüberstand, nämlich die des „Christentums“: die vage Vorstellung einer organischen Gesellschaft, die in ihren zivilen Institutionen stark von der katholischen Präsenz geprägt war und die auf ein mythisches, wiederherzustellendes Mittelalter zurückblickte. Jahrhundertelang hatte sich das katholische Denken den Stammbaum zu eigen gemacht, indem es ihn bekämpfte, den das „moderne Denken“ von sich behauptete: von der protestantischen Reformation über die Aufklärung und die Französische Revolution bis hin zum Liberalismus, Sozialismus und Kommunismus. Was die Moderne als Emanzipationsprozeß betrachtete, sah das katholische Denken als eine Abfolge von historischen Tragödien, die die Menschheit in den Abgrund stürzten. Daraus ergab sich – das muß betont werden – auch eine Distanzierung von liberalen Institutionen und den ihnen zugrunde liegenden Werten: Gewissensfreiheit, religiöser Pluralismus usw.
Von all dem findet sich in Spe salvi keine Spur. Zunächst ist festzuhalten, daß Benedikt die Moderne nicht verurteilt, sondern sie zu einer „Selbstkritik […] im Dialog mit dem Christentum und seiner Konzeption der Hoffnung“ (22) einlädt und in diesem Dialog auch die Notwendigkeit einer parallelen „Selbstkritik des neuzeitlichen Christentums“ bekräftigt. Aber, Vorsicht! Die vom Pontifex beschriebene „Moderne“ ist nicht die, die der antimoderne Katholizismus anathematisiert. In seinen Überlegungen zur neueren Geschichte wird die protestantische Reformation nicht einmal erwähnt, und Luther wird nur einmal erwähnt, um seine Auslegung einer Passage aus dem Hebräerbrief zu diskutieren.
Für Ratzinger hat die „Moderne“ einen weiteren Vorläufer: Francis Bacon. In seinem Denken, so schreibt er, erscheinen die „Grundlagen der Neuzeit […] besonders deutlich“. Und welche sind das? 1) Der nicht mehr kontemplative, sondern instrumentelle Charakter des Wissens, durch den es dem Menschen gelingt, durch Experimente die Naturgesetze zu erkennen und sie nach seinem Willen zu formen. 2) Die Übertragung dieser Eroberung auf die theologische Ebene: Durch die Wissenschaft, nicht durch den Glauben an Jesus Christus, erlangt der Mensch die Herrschaft über die Natur zurück, die er durch die Erbsünde verloren hatte; tatsächlich ist es die Wissenschaft, die ihn „erlöst“. 3) Der Glaube wird somit für die Welt irrelevant und wird in den privaten Bereich verbannt. 4) Hoffnung auf Veränderungen in der Natur: Die Wissenschaft verspricht einen kontinuierlichen Prozeß der Emanzipation von den Beschränkungen des Lebens und eine Verbesserung, einen unendlichen „Fortschritt“ des menschlichen Zustands. 5) Diese Haltung geht auf die politische Ebene über: So wie die Wissenschaft die fortschreitende Überwindung jeglicher Abhängigkeit von der Natur garantiert, so erscheint es zunehmend notwendig, sich von allen anderen sozialen, politischen und religiösen Konditionierungen zu emanzipieren. 6) Es entsteht die Aussicht auf eine Revolution, die die endgültige Herrschaft der Vernunft und der Freiheit errichten wird (16–18).
4
Auch das Thema der „Negativität“ der Aufklärung (ein weiterer typischer Zug des antimodernen Katholizismus) wird vom Papst nicht aufgegriffen: Im Gegenteil, er weist darauf hin, daß die Beziehung dieses Denkens zur französischen Revolution eher problematisch war. „Das aufgeklärte Europa hat zunächst fasziniert auf diese Vorgänge hingeblickt, angesichts des Fortgangs freilich auch neu über Vernunft und Freiheit nachdenken müssen“ (19).
Als Beispiele für die „zwei Phasen der Rezeption dessen, was in Frankreich geschah“, verweist Ratzinger auf zwei Schriften Kants, in denen der Philosoph über diese Ereignisse reflektiert. In der ersten, ab 1792, betrachtete Kant die Ereignisse in Frankreich und die säkularisierenden Maßnahmen der zweijährigen verfassungsgebenden Versammlung mit Wohlwollen: Sie markierten seiner Meinung nach die Überwindung des „Kirchenglaubens“, der nun durch den „religiösen Glauben“, d. h. durch den einfachen Vernunftglauben, ersetzt wurde. Im Essay von 1795 fällt sein Urteil jedoch ganz anders aus: Wir befinden uns in den Nachwehen des Sturzes von Robespierre, Europa hat mit Erstaunen die Politik der gewaltsamen Entchristlichung und das Aufkommen der revolutionären Kulte erlebt: Das politische Gegenstück zu dieser Phase war der Terror. Für den Philosophen rückt eine andere Möglichkeit in den Vordergrund: das gewaltsame Ende des Christentums, in moralischer Hinsicht „das verkehrte Ende aller Dinge“ (19). Es versteht sich von selbst, wie aus diesem Umdenken in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts ein liberales Denken entstanden ist.
Der Weg wichtiger Teile des modernen Denkens unterscheidet sich daher für Ratzinger von jener Genealogie der Moderne, gegen die die katholische Kultur jahrhundertelang polemisiert hat. Er beginnt mit dem ersten Auftreten der modernen Wissenschaftsgläubigkeit bei Bacon; entwickelt sich in einigen der radikaleren Sektoren der Aufklärung und im antireligiösen „Konstruktivismus“ des jakobinischen Terrors; mündet in die „Überflußgesellschaft“ und ihre Ideologien: Wissenschaftsgläubigkeit, Technokratie, Konsumismus, Massenhedonismus.
Auf diesem Weg liegt natürlich auch Karl Marx, aber Ratzingers Annäherung an das Denken des deutschen Revolutionärs ist alles andere als liquidierend. Für Ratzinger ist Marx sozusagen der Bacon des Proletariats: „Der Fortschritt zum Besseren, zur endgültig guten Welt, kommt nun nicht mehr einfach aus der Wissenschaft, sondern von der Politik – von einer wissenschaftlich bedachten Politik, die die Struktur der Geschichte und der Gesellschaft erkennt und so den Weg zur Revolution, zur Wende aller Dinge weist“ (20).
Aber die Ergebnisse der kommunistischen Revolutionen des 20. Jahrhunderts stellen auch das erste wirkliche Scheitern dieser post-baconianischen Denkrichtung dar, und es ist kein zufälliges Scheitern. Sie entspringt der inneren Logik des marxistischen Denkens: Durch die Reduzierung des Individuums auf eine Reihe sozialer Beziehungen war Marx davon überzeugt, daß die Veränderung der Gesellschaft „mit der Enteignung der herrschenden Klasse und mit dem Sturz der politischen Macht, mit der Vergesellschaftung der Produktionsmittel“ ipso facto den neuen Menschen schaffen würde. Nach einer kurzen Zwischenphase der Diktatur würde das neue Jerusalem geboren werden, in dem der Mensch endlich er selbst sein würde. Die Ergebnisse dieses Denkens haben sich gezeigt. Das Scheitern des Marxismus war kein Zufall: Es rührte von seinem konstitutiven Materialismus her, von seinem Unvermögen zu verstehen, daß „der Mensch eben nicht nur Produkt der ökonomischen Zustände ist, und man ihn allein von außen her, durch das Schaffen günstiger ökonomischer Bedingungen, nicht heilen kann“ (21).
5
In den vergangenen beiden Jahrhunderten hat der Atheismus massenhafte Ausmaße angenommen. Aber in vielen Fällen entspringt er, zumindest anfangs, nicht einem bewußten Materialismus. Vielmehr war er, – so schreibt Benedikt XVI., „ein Moralismus: ein Protest gegen die Ungerechtigkeiten der Welt und der Weltgeschichte. Eine Welt, in der ein solches Ausmaß an Ungerechtigkeit, an Leid der Unschuldigen und an Zynismus der Macht besteht, kann nicht Werk eines guten Gottes sein. Der Gott, der diese Welt zu verantworten hätte, wäre kein gerechter und schon gar nicht ein guter Gott. Um der Moral willen muß man diesen Gott bestreiten. So schien es, da kein Gott ist, der Gerechtigkeit schafft, daß nun der Mensch selbst gerufen ist, die Gerechtigkeit herzustellen“ (42).
In dieser Analyse des Atheismus als Moralismus sind Anklänge an einen gewissen katholischen Progressivismus aus der Mitte des 20. Jahrhunderts zu erkennen. Der weit verbreitete Atheismus ist also auch für Ratzinger die Folge bestimmter Grenzen des Christentums in den vergangenen Jahrhunderten. Es habe sich als Religion des individuellen Heils aufgestellt und darauf verzichtet, das Problem des Sinns des Daseins und damit des menschlichen Leidens auf eine universalgeschichtliche Ebene zu stellen: „Es hat damit den Radius seiner Hoffnung verengt und auch die Größe seines Auftrags nicht genügend erkannt“ (25, aber auch 22 und 42).
Das ist also die Selbstkritik, zu der der Papst das heutige Christentum auffordert, und hier liegt der Grund, warum Spe salvi die große Frage nach der „Ungerechtigkeit in der Geschichte“ erneut aufwirft. Und hier kehren wir zu den Themen von Ratzingers Augustinismus zurück: Wenn „die Welt wie eine Presse ist, die auspreßt“, welchen Sinn hat dann das Leiden derer, die seit Jahrtausenden „ausgepreßt“ werden? Die Geschichtsphilosophien der vergangenen Jahrhunderte machten sie zum „Material“, auf dem der Fortschritt seinen mühsamen Weg aufbaute: Der Mensch, der die Vollkommenheit erreicht hatte, sollte sich ihnen zuwenden und sagen: „Wir haben endlich das Ziel erreicht, aber wir haben es auch dank eurer Mühen erreicht“. Damit wurde diesen zahllosen Existenzen zwar nur eine rein instrumentelle Bedeutung zugeschrieben, aber es war dennoch irgendeine Bedeutung. Nun, mit der unumkehrbaren Krise dieser Geschichtsvorstellungen, mit der weit verbreiteten Annahme, daß die Geschichte keinen „Sinn“ hat, laufen diese Leben Gefahr, endgültig jeden Sinn zu verlieren.
Die Frage, die Benedikt dem Menschen von heute stellt, lautet daher: Sollen wir uns damit abfinden, daß die Ungerechtigkeit das letzte Wort in der Menschheitsgeschichte hat? Daß die Leiden der vergangenen Jahrhunderte und der Gegenwart ohne Widerruf bleiben? In dieser Perspektive spricht er mit Nachdruck vom „Jüngsten Gericht“, nicht aus einer apokalyptisch-strafenden Perspektive, sondern als Element der Hoffnung, das ein Gleichgewicht in der Ökonomie der Weltgeschichte wiederherstellt.
„Ich bin überzeugt, daß die Frage der Gerechtigkeit das eigentliche, jedenfalls das stärkste Argument für den Glauben an das ewige Leben ist. Das bloß individuelle Bedürfnis nach einer Erfüllung, die uns in diesem Leben versagt ist, nach der Unsterblichkeit der Liebe, auf die wir warten, ist gewiß ein wichtiger Grund zu glauben, daß der Mensch auf Ewigkeit hin angelegt ist, aber nur im Verein mit der Unmöglichkeit, daß das Unrecht der Geschichte das letzte Wort sei, wird die Notwendigkeit des wiederkehrenden Christus und des neuen Lebens vollends einsichtig.“ (43).
Die Aussicht auf das Jüngste Gericht – auch darauf besteht der Papst – führt nicht zur Resignation gegenüber den Ungerechtigkeiten der Gegenwart, sondern fordert zur „Verantwortung“ eines jeden auf (44) und drängt uns zu einer Ethik, die nicht platt eudämonistisch ist, sondern dazu, „auch in den kleinen Alternativen des Alltags das Gute der Bequemlichkeit vorzuziehen – wissend, daß wir gerade so das Leben selber leben“ (39). Eine solche „asketische“ Ethik wird uns manchmal auch von vielen zeitgenössischen Weltverbesserern vor Augen geführt:
„Aber in wirklich schweren Prüfungen, in denen ich mich definitiv entscheiden muß, die Wahrheit dem Wohlbefinden, der Karriere, dem Besitz vorzuziehen“, kurzum, wenn es um das Leben geht, „wird die Gewißheit der wahren, großen Hoffnung, von der wir gesprochen haben, nötig.“ (39).
Die christliche Hoffnung bekommt in der Enzyklika von Benedikt XVI. also wieder eine überindividuelle, sozusagen kosmisch-geschichtliche Dimension. Sie zeigt sich als einzige, die in der Lage ist, der Weltgeschichte einen Sinn zu geben.
*Roberto Pertici, Professor für Zeitgeschichte an der Universität Bergamo, spezialisiert auf das Verhältnis zwischen Kirche und Staat. Noch vor wenigen Jahren zählte er zu den Autoren des Osservatore Romano.
Erstveröffentlichung: Settimo Cielo
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: MiL