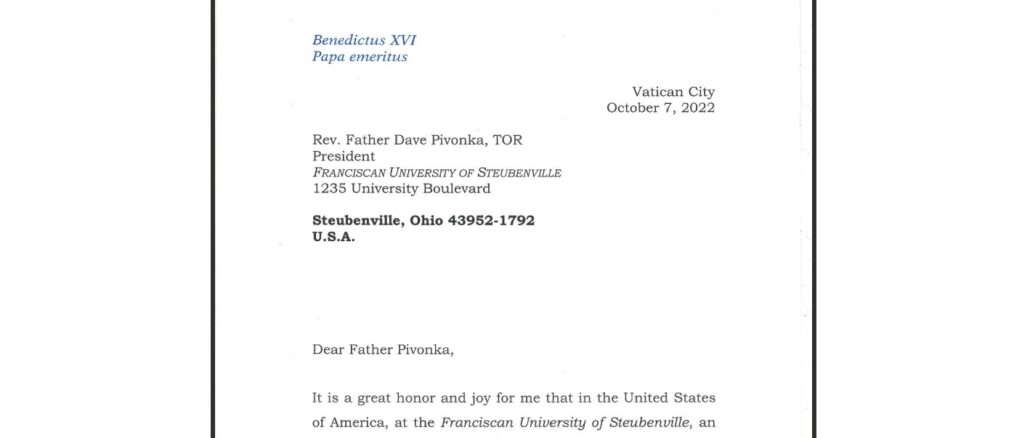
Benedikt XVI., steht im 96. Lebensjahr. Nach einer längeren Zeit der Stille meldete er sich nun wieder zu Wort und schrieb einen Brief an Pater Dave Pivonka, den Rektor der Franciscan University of Steubenville im Staat Ohio in den Vereinigten Staaten von Amerika. Dort fand gestern und heute die 10. Jahreskonferenz der Stiftung Joseph Ratzinger/Papst Benedikt XVI. zum Thema „Die Ekklesiologie von Joseph Ratzinger“ statt. Der Brief wurde gestern von Pater Federico Lombardi, dem Stiftungsvorsitzenden, vor rund 350 Konferenzteilnehmern verlesen und auf den Internetseiten der Franziskaner-Universität und der Stiftung Joseph Ratzinger/Papst Benedikt XVI. veröffentlicht.
Benedikt XVI. verteidigt darin die Bedeutung des Zweiten Vatikanischen Konzils, dessen Konsequenzen von ihm bei dieser Gelegenheit nicht thematisiert werden. Die „deutliche Notwendigkeit“ eines Konzils und die „positive Kraft des Konzils“, ohne Differenzierung, wie sie Benedikt XVI. betont, verlangen allerdings nach einem Ergebnis mit guten Früchten. Diese scheinen allerdings seit 70 Jahren wie in eine ferne Zukunft aufgeschoben. Papst Franziskus schrieb in seinem Vorwort zu dem vor wenigen Tagen erschienenen Buch „Giovanni XXIII – Vaticano Secondo. Un Concilio per il mondo“ („Johannes XXIII. – Zweites Vaticanum. Ein Konzil für die Welt“), das Zweite Vatikanische Konzil sei „noch nicht vollständig verstanden, gelebt und angewandt“. An anderer Stelle sagte er, es seien erst 60 Jahre seit der Eröffnung vergangen, man habe also noch Zeit für seine Umsetzung. Das dauere. Ein Papabile meinte jüngst, es gebe manche, die behaupten, das Konzil von Trient sei noch nicht überall angekommen, geschweige denn also das Zweite Vaticanum. Beide Seiten der Debatte um die Konzilshermeneutik scheinen sich zumindest darin einig, bezüglich der guten Früchte des Konzils zu vertrösten.
Lieber Pater Pivonka!
Es ist eine große Ehre und Freude für mich, daß sich in den Vereinigten Staaten von Amerika, an der Franziskaner-Universität von Steubenville, ein internationales Symposium mit meiner Ecclesiologie beschäftigt und damit mein Denken und meine Bemühungen in den großen Strom einordnet, in dem sie sich bewegt haben.
Als ich im Januar 1946 mit dem Theologiestudium begann, dachte niemand an ein Ökumenisches Konzil. Als Papst Johannes XXIII. es ankündigte, gab es zur Überraschung aller viele Zweifel, ob es sinnvoll, ja ob es überhaupt möglich sein würde, die Erkenntnisse und Fragen in einer konziliaren Gesamtaussage zu ordnen und damit der Kirche eine Richtung für ihren weiteren Weg zu geben. In Wirklichkeit erwies sich ein neues Konzil nicht nur als sinnvoll, sondern als notwendig. Zum ersten Mal hatte sich die Frage nach einer Theologie der Religionen in ihrer Radikalität gezeigt. Dasselbe gilt für das Verhältnis zwischen dem Glauben und der Welt der bloßen Vernunft. Beide Themen waren in dieser Form bisher nicht vorgesehen. Das erklärt, warum das Zweite Vaticanum die Kirche zunächst mehr zu verunsichern und zu erschüttern drohte, als ihr eine neue Klarheit für ihre Sendung zu geben. In der Zwischenzeit ist die Notwendigkeit, die Frage nach dem Wesen und der Sendung der Kirche neu zu formulieren, immer deutlicher geworden. Auf diese Weise wird auch die positive Kraft des Konzils langsam sichtbar.
Meine eigene ekklesiologische Arbeit war geprägt von der neuen Situation, die sich für die Kirche in Deutschland nach dem Ende des Ersten Weltkrieges ergab. Wurde die Ekklesiologie bis dahin im wesentlichen institutionell behandelt, so wurde nun die umfassendere spirituelle Dimension des Kirchenbegriffs freudig wahrgenommen. Romano Guardini beschrieb diese Entwicklung mit den Worten: „Ein Prozeß von immenser Bedeutung ist in Gang gekommen. Die Kirche ist dabei, in den Seelen zu erwachen“. So wurde der „Leib Christi“ zum tragenden Begriff der Kirche, der folgerichtig 1943 seinen Ausdruck in der Enzyklika „Mystici Corporis“ fand. Doch mit der Verabschiedung der Enzyklika hatte der Begriff der Kirche als mystischer Leib Christi gleichzeitig seinen Höhepunkt überschritten und wurde kritisch überdacht. In dieser Situation dachte und schrieb ich meine Dissertation über „Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche“. Der große Augustinuskongreß 1954 in Paris gab mir die Gelegenheit, meine Sicht auf die Position Augustins in den politischen Wirren der Zeit zu vertiefen.
Die Frage nach der Bedeutung der Civitas Dei schien damals endgültig geklärt zu sein. Die in der Harnack-Schule entstandene und 1911 veröffentlichte Dissertation von H[einrich]. Scholz über „Glaube und Unglaube in der Weltgeschichte“ hatte gezeigt, daß mit den beiden Civitates keine Körperschaften gemeint waren, sondern die Darstellung der beiden Grundkräfte des Glaubens und Unglaubens in der Geschichte. Schon die Tatsache, daß diese unter der Leitung von Harnack verfaßte Studie mit summa cum laude angenommen wurde, sicherte ihr ein hohes Maß an Zustimmung. Zudem paßte sie in die allgemeine öffentliche Meinung, die der Kirche und ihrem Glauben einen schönen, aber auch harmlosen Platz zuwies. Wer es gewagt hätte, diesen schönen consensus zu zerstören, konnte nur als eigensinnig gelten. Das Drama von 410 (die Eroberung und Plünderung Roms durch die Westgoten) erschütterte die damalige Welt und auch das Denken des Augustinus zutiefst. Natürlich ist die Civitas Dei nicht einfach mit der Institution der Kirche identisch. In dieser Hinsicht war der mittelalterliche Augustinus in der Tat ein fataler Irrtum, der heute glücklicherweise endgültig überwunden ist. Aber die völlige Vergeistigung des Kirchenbegriffs verfehlt ihrerseits den Realismus des Glaubens und seiner Institutionen in der Welt. So wurde im Zweiten Vaticanum die Frage nach der Kirche in der Welt schließlich zum eigentlichen Kernproblem.
Mit diesen Überlegungen wollte ich nur die Richtung andeuten, in die mich meine Arbeit geführt hat. Ich hoffe aufrichtig, daß das internationale Symposium an der Franziskaner-Universität Steubenville hilfreich sein wird im Kampf um ein richtiges Verständnis von Kirche und Welt in unserer Zeit.
Mit freundlichen Grüßen in Christus
Benedictus XVI
Einleitung/Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Franciscan University of Steubenville (Screenshot)



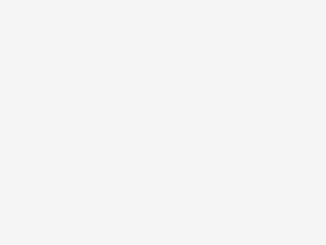

Interessant, dass Papst Benedikt XVI. ausgerechnet die Enzyklika „Mystici Corporis“ Christi erwähnt.
Am 2.2.22 war es in einer Mittwochskatechese, da erklärt wurde, dass die nachfolgende Aussage aus der erwähnten Enzyklika nicht mehr gilt (freilich, ohne auf die Enzyklika Bezug zu nehmen) und stattdessen auch die Häretiker, Schismatiker und Apostaten der Gemeinschaft der Heiligen angehören.
„Denn nicht jede Schuld, mag sie auch ein schweres Vergehen sein, ist dergestalt, daß sie, wie dies die Folge der Glaubensspaltung, des Irrglaubens und des Abfalls vom Glauben ist, ihrer Natur gemäß, den Menschen vom Leib der Kirche trennt.“
Vielleicht will Papst Benedikt XVI. dazu anregen, sich theologisch mit dieser Änderung auseinanderzusetzen?
Ich vertraue Benedikt. Er nimmt einen überzeitlichen Standpunkt ein. Das wäre der Standpunkt, Gott kennt das Ergebnis von Anfang an und es ist nach seinem Willen. Man denke an die über 10 Millionen Unterstützer von Christians United for Israel in den USA. Ist da zukünftig ein Zusammenkommen des Judentums mit dem Christentum zu erwarten? Welche Grundlagen würde man dafür im Vatikanum finden? Oder das Zurückstellen des Lateinischen in der Liturgie zugunsten der Landessprachen. Wie wichtig ist das für die Sprachen, die durch die Verwendung in der Liturgie gereinigt werden? Worte, die in der Welt immer mehr verdreht werden, finden zurück zu Ihrer wahren Bedeutung. Es offenbart sich gerade, wie unverzichtbar der alte Ritus ist, aber der Schritt in die Landessprachen kann tatsächlich eine richtige Richtung sein.
Es ist ganz natürlich, „normal“, daß Joseph Ratzinger eine „positive Kraft des Konzils“ verteidigt.
In den wilden Jahren des Dritten Reichs und der Weltkriegsära großgeworden, durchtränkt mit den modernisierenden Trends in Deutschland nach 1945, verletzt durch die Beanstandungen bei seiner Doktorarbeit und dann frohgemut als junger Peritus beim Konzil: das alles kann psychologisch nicht plötzlich wegfallen.
Ratzingers Beitrag bei „ad gentes“ war ein kleiner Nebenschauplatz.
In den drei Jahren nach dem Konzil, mit den Studentenunruhen, den Drangsalierungen und Beleidigungen in Tübingen und dem Rückzug nach Regensburg, ist es Ratzinger sicher bewußt geworden, daß da ein böser Geist aus der Flasche geraten war.
Erzbischof Msgr. Lefebvre hat das klar gesehen und als Kämpfer und mutig auch gesagt und ist konsequent den steinigen Weg gegangen.
Ratzinger, nie ein Kämpfer, sondern ein Gelehrter und Bücherfreund, Papst Johannes Paul II. und Papst Benedikt XVI haben natürlich diesbezüglich geschwiegen und, gegen alles bessere Wissen hin, die „Früchte“ alias das Positive des Zweiten Vatikanischen Konzils als Mantra deklamiert.
Menschlich verständlich – kein Mensch, und sicher kein Senior, gibt gerne einen Irrtum zu.
Es ist jedoch auf Dauer nicht haltbar, nicht kohärent, eine irgendwelche „positive Kraft“ zu postulieren und dann sofort hinterher inzwischen mehr als 60 Jahre lang nur dadurch bedingte Katastrophen, fundamentale Schäden und Unsinn zu bewältigen und zu reparieren zu versuchen.
Besucher 23.10.2022 um 12.59 spricht da den „Schritt in die Landessprache“ an. Ein Topos, der nun schon seit 58 Jahren durch die Gemüter geistert.
Und dann auch noch besonders im Kontrast zum Latein.
Die Sache ist wohl plakativ, aber nicht so einfach.
Was ist die Sprache des Volkes, und um welches Volk handelt es sich?
Ab 1965, gerade durch das Konzil und „seinen Geist“ (lies: die rebellischen Gedanken und Instruktionen von Kard. Suenens) ausgelöst, wurden in Nordbelgien die „Eucharistiefeiern“ in der „Volkssprache“ abgehalten. Für Belgien in seinem Sprachenstreit besonders brisant: im niederländischsprachigen Flandern, an der Nordseeküste, in der Franziskanerkirche (mit schönem Vorhofperistylium) in Knokke mit seiner Haute-volée-Bourgeoisie und von den Brüsselern eigenmächtig als „französischsprachige Exklave“ angesehen, auch auf französisch. Es gab sofort gewaltige Demonstrationen, Polizeieinsätze, Verordungen hin und her… Die ganze Affäre lief parallel zu „Löwen flämisch“, die Regierung stürzte, die christdemokratische Partei geriet in einen kontinuierlichen Sinkflug und die Aufspaltung/Föderalisierung von Belgien startete.
Die meistgesprochene „Volkssprache“ in Brüssel ist heute Arabisch oder Tamazight (die letzte Kirchen von St-Jans-Molenbeek sind geschlossen), in der Basilika von Koekelberg dominiert jetzt der „Zaîrische Ritus“ in den Sprachen Kikongo und Lingala.
In Hamburg und Berlin sollte man dementsprechend in Polnisch, Italienisch, Kroatisch und Philippinisch zelebrieren.
Franziskus spricht als Sohn von italienischen Immigranten in Argentinien Spanisch und Italienisch und ist kein Vorbild von Polyglottie.
Insoweit ist die Verwendung des Lateins, mit guten Übersetzungen im Volksmeßbuch (wie z.B. von Pater Ramm FSSP) sehr sinnvoll. Die Orthodoxen verwenden so auch das Kirchenslawisch.