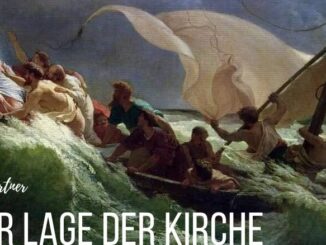(Rom) Für die Verehrer von Johannes Paul I., für Albino Luciani, der 1978 für nur 33 Tage den Stuhl des Petrus eingenommen hatte, war gestern ein großer Tag. Der Papst des Lächelns aus der norditalienischen Provinz Belluno wurde seliggesprochen. Damit wurde eine letzte „Lücke“ geschlossen und zugleich von Papst Franziskus ein weiterer Pfeil abgeschossen.
Die Heiligsprechung des Zweiten Vatikanischen Konzils?
Papst Luciani war Patriarch von Venedig gewesen, als er auf die Cathedra Petri gewählt wurde. Als solcher hatte er – ganz der Linie der italienischen Bischöfe folgend – radikal die Liturgiereform von 1969/70 mit einem Verbot des überlieferten Ritus durchgesetzt. Über sein Pontifikat läßt sich wenig aussagen, da es zu kurz währte, um eventuelle Kursbestimmungen erkennen zu können.
Für die Verehrer des Zweiten Vatikanischen Konzils wurde eine letzte Lücke geschlossen: Alle Konzilspäpste – lebende ausgenommen; Papa Luciani hatte als Bischof von Vittorio Veneto zu den Konzilsvätern gehört – sind seit gestern zu den Altären erhoben, eine in der Kirchengeschichte nur mit der frühchristlichen Märtyrerzeit zu vergleichende Kanonisierungsdichte.
Allerdings könnte die Zeit der Apostel und der großen Kirchenverfolgungen kaum verschiedener sein von der Zeit der äußeren Prachtentfaltung des jüngsten Konzils und des historisch beispiellosen Niedergangs, der auf dieses folgte.
Hinter der Kanonisierung der Konzilspäpste wird als eigentliche Absicht eine Heiligsprechung des Konzils vermutet, das unantastbar gemacht werden soll.
Es gibt jedoch auch eine andere These, die jener ersten nicht widersprechen muß, jedoch einen anderen Akzent setzt. Denmnach sei die Erhebung aller Päpste seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil eine Reaktion auf die Destabiliserung, die für die Kirche seit dem Konzil folgte. Die mit Nachdruck betonte Anhänglichkeit gegenüber dem Papst wäre demnach ein „letzter“ Anker eines verunsicherten Volkes Gottes.
Wir wollen als gläubige Kinder der Kirche auf das Prüfungsverfahren durch die römische Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse (nunmehr Dikasterium) vertrauen, daß der Papst des Lächelns würdig zu den Altären erhoben wurde.
Der päpstliche Seitenhieb: Der Feind der Kirche steht …
Papst Franziskus nützte jedenfalls die Gelegenheit, um einen seiner berüchtigten Pfeile abzuschießen, diesmal gegen den „Involutionismus“ in der Kirche. Dabei handelt es sich um eine weitere Wortneuschöpfung des Kirchenoberhaupts. Als jüngste Neologismen hatte es soeben „Indietrismus“ und „Indietristen“ eingeführt, womit Franziskus die Vertreter der Tradition bedachte, die er als rückwärtsgewandt diskreditierte – als jene, die „zurück“ in die Vergangenheit wollten.
Gestern nahm Franziskus während der Messe zur Seligsprechung von Johannes Paul I. gegen Ende seiner Predigt Stellung:
„Mit seinem Lächeln gelang es Papst Johannes Paul I., die Güte des Herrn zu vermitteln. Schön ist eine Kirche mit einem heiteren Gesicht, mit einem gelassenen Gesicht, mit einem lächelnden Gesicht, eine Kirche, die ihre Türen nie verschließt, die die Herzen nicht verbittert, die nicht jammert und keinen Groll hegt, die nicht zornig und unduldsam ist, die sich nicht mürrisch zeigt, die nicht an Nostalgie leidet und in einen ‚Involutionismus“ verfällt.“
Der deutsche Übersetzungsdienst des Heiligen Stuhls sah offensichtlich die Notwendigkeit dieses unbekannte Wort durch einen verständlichen Begriff zu ersetzen. In der deutschen Übersetzung heißt es nämlich:
„[…] eine Kirche, die ihre Türen nie verschließt, die die Herzen nicht verbittert, die nicht jammert und keinen Groll hegt, die nicht zornig und unduldsam ist, die sich nicht mürrisch zeigt, die nicht an Nostalgie leidet und in eine Rückwärtsgewandtheit verfällt.“
Überhaupt weisen die Übersetzungen des Vatikans den Weg zu diesem Wort, denn es findet sich nur in der spanischen Fassung und dort unter Anführungszeichen, also jener Sprache, in der Franziskus seine Gedanken entwickelt haben dürfte. Selbst der italienische Übersetzungsdienst wußte nichts mit dem Wort anzufangen und vollzog einen Rückgriff auf die vorherige päpstliche Neuschöpfung „Indietrismus“. Gleiches gilt, wenn auch unter Verwendung unterschiedlicher Begriffe, für alle anderen Übersetzungen.
Damit ist der Inhalt ausreichend klargestellt. „Involutionismus“ meint synonym „Indietrismus“. Es handelt sich dabei um die wiederholte Schelte jener Kräfte der Kirche, die sich dem „Aggiornamento“ und der Anpassung an die Welt verweigern und zugleich – anders als von Franziskus offensichtlich angenommen oder unterstellt – den Nachweis erbringen, daß die zweitausendjährige Tradition der Kirche ungebrochen fruchtbar und lebendig ist.
Franziskus attackierte gestern also erneut die Tradition, indem er, ohne es zu nennen, das Motu proprio Traditionis custodes verteidigte. Er habe gegen den „indietristischen Rausch“ einschreiten müssen, so die päpstliche Rechtfertigung für Traditionis custodes vom 29. Juli gegenüber den kanadischen Jesuiten.

Nachvollziehung politischer Kategorien?
Neuneinhalb Jahre des Franziskus-Pontifikats bestätigen: Für den regierenden Papst ist der schrecklichste Kirchenfeind die Tradition. Der „Politiker auf dem Papstthron“ vollzieht darin, kirchlich dekliniert, eine linke Maxime nach, die da lautet: „Der Feind steht rechts“. In der sozialistischen Urfassung meint das: „Der Feind ist der Faschismus“. Diesem kategorischen Denkfehler liegen politische Verwicklungen zugrunde, die ideologischer Natur sind, also genau jener Kategorie entspringen, die Franziskus mit Nachdruck den Worten nach kritisiert, allerdings dabei der Tradition zum Vorwurf macht. Ein Denkfehler gebiert demnach weitere Denkfehler.
Im konkreten Fall handelt es sich um einen zwangsläufigen Prozeß, denn der Denkfehler ist in Wirklichkeit keiner, sondern eine ideologisch gewollte Weichenstellung, denn der Faschismus war historisch eine Reaktion auf den Kommunismus. Im Umkehrschluß: kein Faschismus ohne Kommunismus. Diese historische Metathese wurde überzeugend vom Historiker Ernst Nolte aufgezeigt und nachgewiesen – unter dem Getobe einer unerbittlichen Ablehnung der entlarvten Linken.
Was aber hat all das, haben all diese politischen und ideologischen Kategorien mit einem Papst und seinen Aussagen zu tun?
Diese Frage gilt nach wie vor als großes Rätsel des derzeitigen Pontifikats. Einige Autoren wie George Neumayr und Roberto de Mattei haben versucht, dieses Rätsel zu lüften. Beide verweisen auf die Prägung des jungen Jorge Mario Bergoglio durch den Peronismus, jenen Caudillo-Populismus, der Argentinien nach dem Zweiten Weltkrieg prägte. Eine sich dem europäischen Denken teils sich entziehende, da auf die Gestalt Juan Domingo Peróns zugeschnittene politische Richtung. Hinzu kommen Aussagen von Franziskus selbst, laut denen zu den ihn prägenden Figuren einige Kommunisten gehörten.
Der Sache mangelt es nicht an einer offenbar unfreiwilligen Pointe, denn „Involution“ steht in direktem Zusammenhang mit „Evolution“. In der Tat finden sich die raren Hinweise auf diese Wortschöpfung im Kontext der heute verpönten Rassenlehre und des wenig christlichen Denkers Julius Evola. Man könnte nun sagen, daß sich der Kreis vielleicht auf irgendeine Weise schließt im Sinne einer Art von rassistischem Antirassismus, wie ihn Black Lives Matter propagiert und wie ihn Papst Franziskus, laut seinem freimaurerischen Freund Eugenio Scalfari, in einer „Theologie der Vermischung“ als generell anzustrebendes „Mestizentum“ für die Menschheit wünscht.
Man steht einer Vielzahl von offenen Fragen gegenüber, die an dieser Stelle aber nicht weiter vertieft werden sollen.
Die bei der gestrigen Predigt vorgetragene Schelte wirft vielmehr die konkrete Frage auf, ob die Aussage von Franziskus auf ihn selbst anzuwenden ist: Ist es nicht vielmehr er, der aus Nostalgie und „Indietrismus“ die Kirche in die späten 60er und frühen 70er Jahre zurückführen will?

Text: Giuseppe Nardi
Bild: Vatican.va/NLM (Screenshots)