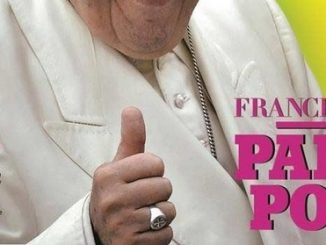Von Roberto de Mattei*
Seit mehr als 40 Jahren kenne ich Rocco Buttiglione. Wir waren beide Assistenten von Prof. Augusto Del Noce (1910 – 1989) an der Fakultät für Politische Wissenschaften an der Universität La Sapienza, aber schon seit damals unterscheiden sich unsere Positionen, vor allem was das Urteil über die Moderne betrifft. Buttiglione hielt den historischen Prozeß, der mit der französischen Revolution einsetzte, für vereinbar mit dem Christentum, während ich ihn für unvereinbar hielt.
Unabhängig von diesen Divergenzen habe ich das Wirken Buttigliones als Minister für die Kulturgüter in der Regierung Berlusconi III (2005/2006) und habe ihm meine Solidarität ausgesprochen, als er 2004 nicht zum europäischen Kommissar ernannt wurde, weil er die Homosexualität als „eine Sünde“ bezeichnet hatte. An all das erinnere ich, um meine Ehrlichkeit zu belegen, wen ich von einer „freundschaftlichen Kritik“ an den Thesen spreche, so wie Buttiglione wirklich ehrlich ist, wenn er in seinem jüngsten Buch mit Prof. Josef Seifert polemisiert, den er als einen „Freund ein Leben lang“[1]Risposte (amichevoli) ai critici di Amoris Laetitia, (Freundschaftliche Antwort an die Kritiker von Amoris laetitia), mit einem einführenden Aufsatz von Kardinal Gerhard Müller, Ares, Mailand 2017, … Continue reading nennt. Das soeben erschienene Buch umfaßt 200 Seiten und ist in vier Kapitel gegliedert.

Es findet sich darin nichts, was die Leser von Buttiglione nicht schon kennen. Die Kapitel bestehen aus Aufsätzen, die bereits an verschiedener Stelle 2016 und 2017 veröffentlicht wurden. Das erklärt die vielen Wiederholungen, die allerdings dabei helfen, die Grundthese besser zu verstehen: die Möglichkeit, wiederverheiratete Geschiedene zur Kommunion zuzulassen, weil in einigen Fällen, auch wenn „die Handlungen illegitim sind“, die Personen „aus Mangel an vollständigem Bewußtsein und bewußter Zustimmung nicht einer Todsünde verfallen“ (S. 172).
Ich hatte bereits Gelegenheit, diese Position zu kritisieren. Dem ist hinzuzufügen, daß Buttiglione, um seine Position zu rechtfertigen, eine trügerische Unterscheidung zwischen der „Todsünde“, die „durch das Objekt (durch die schwerwiegenden Materie) spezifiziert wird“, und der „Todsünde“, die „durch die Wirkung auf das Subjekt (läßt die Seele sterben) spezifiziert wird“. „Alle Todsünden“, so Buttiglione, „sind auch schwere Sünden, aber nicht alle schweren Sünden sind auch tödlich. Es kann vorkommen, daß in einigen Fällen die Schwere der Materie nicht einhergeht mit einem vollen Bewußtsein und der bewußten Zustimmung“ (S. 173).
Diese These wurde von Johannes Paul II. zurückgewiesen, der gegen den Vorschlag einiger Theologen und Synodenväter der Synode von 1984, eine dreifache Unterscheidung der Sünden in läßlich, schwere und tödliche Sünden einzuführen, in seinem nachsynodalen Schreiben Reconciliatio et pænitentia erklärte, daß in der Lehre der Kirche die schwere Sünde mit der Todsünde gleichgesetzt ist. Das sind seine Worte:
„Eine solche Dreiteilung könnte deutlich machen, daß es bei den schweren Sünden Unterschiede gibt. Dabei bleibt es jedoch wahr, daß der wesentliche und entscheidende Unterschied zwischen jener Sünde besteht, die die Liebe zerstört, und der Sünde, die das übernatürliche Leben nicht tötet: Zwischen Leben und Tod gibt es keinen mittleren Weg. […] Deshalb wird in Lehre und Pastoral der Kirche die schwere Sünde praktisch mit der Todsünde gleichgesetzt“ (Reconciliatio et pænitentia, 17).
Natürlich gibt es Abstufungen in den Todsünden. Die Kreuzigung des Herrn, zum Beispiel, ist nicht in gleichem Maße schwerwiegend für Pilatus und die Anführer des jüdischen Volkes (Joh 19,11). Aber alle schweren Sünden sind Todsünden und alle Todsünden sind schwerwiegend. Für Buttiglione ist das Zusammenleben immer eine „schwere Wunde“ für das moralische Wohl der Person, aber nicht immer eine „tödliche Wunde“ (S. 174). Es hänge von den „Umständen“ ab, die „nicht die Natur der Handlung, aber das Urteil über die Verantwortlichkeit der Person ändern können“ (S. 174). Die Kirche könne daher „ausnahmsweise die Sakramente gewähren, wenn es sich ergibt, daß das Subjekt trotz der objektiven Abweichung von der christlichen Moral sich nicht aus subjektiven, mildernden Umständen im Stand der Todsünde befindet“ (S. 197). Der Ehebruch zum Beispiel kann „eine Situation der Sünde, aber nicht der Todsünde bedeuten“ (S. 175). „Während also die Regel ausnahmslos Gültigkeit hat, ist das abweichende Verhalten nicht immer gleich schuldhaft“ (S. 185). Die Ausnahme gilt demnach für das Verhalten, nicht für die Regel. Da stellt sich aber die Frage, wie anders man die Moralregel übertreten soll, wenn nicht durch das Verhalten?
Buttiglione leugnet, daß die Position von Papst Franziskus und seine eigene eine „Situationsethik“ vertritt, die von der Kirche verurteilt wurde. Um zu überzeugen, muß man jedoch belegen, was man behauptet oder bestreitet. Bedauerlicherweise muß ich mit Josef Seifert, Carlos Casanova, Corrado Gnerre, Claudio Pierantoni und anderen herausragenden Kritikern Buttigliones, daß die Position von Amoris laetitia einer „Situationsethik“ entspricht, oder noch genauer, einer „Ethik der Umstände“. Charakteristikum der Situationsethik ist nach P. Angelo Perego „die Leugnung der entscheidenden und konstitutiven Funktion der Moral der objektiven Ordnung“[2] L’etica della situazione (Die Situationsethik), Verlag La Civiltà Cattolica, Rom 1958, S. 106.
In der traditionellen Moral ist die letzte Regel im menschlichen Handeln das Sein und nicht das handelnde Subjekt. Die traditionelle Moral ist daher essentiell objektiv, weil sie vom Sein ausgeht und sich ständig am Sein mißt. Die Ethik der Umstände gründet sich hingegen auf das subjektive Werden.
In der Ethik der Umstände von Buttiglione und von Papst Franziskus ist das letzte, konstitutive Element der Moral von subjektivem Charakter im engen Sinn. Das Moralgesetz wird eine intrinsische Norm, die zum praktischen Urteil beiträgt, aber nie zum entscheidenden Element wird. Was ist der entscheidende Faktor? Die „Unterscheidung“ der Umstände durch den Beichtvater, der, wie ein Zauberer, das Gute in Böses und das Böse in Gutes verwandeln kann. Pius XII. sagte:
„Wir stellen der ‚Situationsethik‘ drei Betrachtungen oder Maximen entgegen. Die erste: Wir geben zu, daß Gott vor allem und immer die gute Absicht verlangt; aber diese genügt nicht. Er will auch das gute Werk. Die zweite: Es ist nicht erlaubt, Böses zu tun, damit daraus Gutes entstehe (vgl. Röm 3,8). Doch diese Ethik handelt – vielleicht ohne sich davon Rechenschaft abzulegen – nach dem Prinzip, daß der Zweck die Mittel heilige. Die dritte: Es kann Umstände geben, in denen der Mensch und besonders der Christ sehr wohl wissen sollte, daß er alles, selbst das Leben, opfern muß, um seine Seele zu retten. Alle Märtyrer erinnern uns daran. Und diese sind in unserer Zeit selber sehr zahlreich. Hätten denn die Mutter der Makkabäer und ihre Söhne, die heiligen Perpetua und Felizitas trotz ihrer neugeborenen Kinder, Maria Goretti und tausend andere Männer und Frauen, die die Kirche verehrt, in ihrer ‚Situation‘ den blutigen Tod umsonst oder selbst fälschlich auf sich genommen? Gewiß nicht, und sie sind mit ihrem Blut die ausdrücklichsten Zeugen der Wahrheit gegenüber der ‚neuen Moral‘“ (Ansprache vom 18. April 1952, in AAS, 44 (1952), S. 417f).
Umgekehrt, wie ein Freund mich aufmerksam machte: Wenn Buttigliones Lehre über die Anrechenbarkeit der Schuld gültig wäre, würde daraus folgen, daß auch die Abtreibung zu einer schweren, aber der abtreibenden Frau nicht anrechenbaren Sünde werden könnte wegen ihrer psychischen und ökonomischen Situation zum Zeitpunkt, an dem sie ihrer Schwangerschaft ein Ende setzt, und wegen der psychologischen und ökonomischen Probleme, die ihr die Geburt ihres Kindes verursache würde. Dasselbe könnte man von der Euthanasie sagen und a fortiori von der Homosexualität, die zwar eine himmelschreiende Sünde, dem „Sodomiten“ aber nicht anrechenbar wäre, weil er es nicht aufgrund einer Entscheidung, sondern von Natur aus sei.
Die intellektuelle Anstrengung von Rocco Buttiglione bleibt auch deshalb fruchtlos, weil trotz der Worte die Fakten bleiben. Und die Fakten sind, daß im Beichtstuhl eine zunehmende Zahl von Priestern auf der Grundlage von Amoris laetitia dem Beichtenden versichern, daß die Göttliche Barmherzigkeit seine irreguläre Situation abdeckt und ihn einlädt, bedenkenlos die Eucharistie zu empfangen.
Wir fragen daher Prof. Buttiglione: Hat die Zahl der sakrilegischen Kommunionen und der ungültigen Beichten seit Amoris laetitia zugenommen oder abgenommen?
Die Antwort ist eindeutig. Die neue „pastorale Strategie“ zerstört die Ehe und die Sakramente, zersetzt das Naturrecht und öffnet den Weg für neue Irrtümer und Häresien auf der Ebene von Lehre und Praxis. Kein Sophismus kann das widerlegen.
*Roberto de Mattei, Historiker, Vater von fünf Kindern, Professor für Neuere Geschichte und Geschichte des Christentums an der Europäischen Universität Rom, Vorsitzender der Stiftung Lepanto, Autor zahlreicher Bücher, zuletzt in deutscher Übersetzung: Verteidigung der Tradition: Die unüberwindbare Wahrheit Christi, mit einem Vorwort von Martin Mosebach, Altötting 2017.
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Corrispondenza Romana/LifeSite
-
| ↑1 | Risposte (amichevoli) ai critici di Amoris Laetitia, (Freundschaftliche Antwort an die Kritiker von Amoris laetitia), mit einem einführenden Aufsatz von Kardinal Gerhard Müller, Ares, Mailand 2017, S. 41. |
|---|---|
| ↑2 | L’etica della situazione (Die Situationsethik), Verlag La Civiltà Cattolica, Rom 1958, S. 106. |