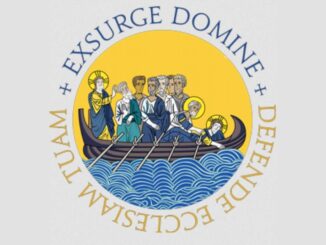Überlegungen zu den Folgen des Rücktritts von Papst Benedikt XVI. und dem weitverbreiteten Empfinden von Verwirrung und Unsicherheit rund um das Papsttum
Von Antonio Socci
Das Jugendtreffen im Heiligen Jahr, gefeiert von Papst Leo XIV., hat mit der Klarheit seines auf Christus und die Ewigkeit ausgerichteten Lehramts die Kirche schlagartig in die Zukunft katapultiert – und die Ereignisse der letzten fünfzehn Jahre wirklich wie Vergangenheit erscheinen lassen.
In der Kirche entsteht das Gefühl, aus einem langen Tunnel pastoraler und lehrmäßiger Verwirrung und Unsicherheit herauszutreten. Das ermöglicht es, mit einer gewissen kritischen Distanz über die kirchlichen Entwicklungen der letzten Zeit nachzudenken, um sie historisch einzuordnen – und daraus Lehren für die Zukunft zu ziehen.
Genau dies unternimmt Msgr. Nicola Bux, ein enger Mitarbeiter Benedikts XVI., gemeinsam mit Vito Palmiotti in dem Buch „Realität und Utopie in der Kirche“ („Realtà e utopia nella Chiesa“), erschienen im Verlag Omni Die.
Im Anhang des Buches veröffentlicht Bux einen Brief, den er am 19. Juli 2014 an den „emeritierten Papst“ schrieb, sowie die Antwort Ratzingers vom 21. August 2014. Beide Texte lagen mir seit Jahren in vertraulicher Form vor. Nun, da sie öffentlich zugänglich sind, können sie einer Analyse unterzogen werden.
Im Kern unterbreitete Don Bux dem emeritierten Papst – unter Einbeziehung kritischer Stimmen verschiedener Persönlichkeiten, darunter auch Kardinäle aus dem engeren Umfeld Benedikts XVI. – eine Reihe von Fragen.
Die erste lautete:
„Nach Ansicht einiger angesehener Historiker hat Ihr Rücktritt die Struktur des Petrusamtes erschüttert, sodaß unklar ist, was künftig geschehen kann.“
Dabei ging es nicht um die grundsätzliche Möglichkeit eines päpstlichen Rücktritts – dieses Recht steht außer Frage –, sondern um die Beweggründe, die nicht den schweren Gründen zu entsprechen schienen, wie sie in der kanonistischen Literatur vorgesehen sind. Viele Gläubige blieben ratlos zurück. Verschiedene Beobachter interpretierten den Rücktritt als eine „Modernisierung des Papsttums“ – als handele es sich dabei um ein Amt mit Verfallsdatum. Hans Küng sprach gar von einer „Entmythologisierung des päpstlichen Amtes“.
Die zweite Frage lautete:
„Nach Ansicht anderer Theologen können Sie nicht behaupten, lediglich die Ausübung des Amtes niedergelegt, das munus (das Amt im theologischen Sinne) jedoch behalten zu haben – dies birgt die Gefahr eines Schismas. Auch dürfen Sie sich nicht wie ein Papst kleiden, wenn Sie es nicht mehr sind.“
Bux erläuterte weiter, daß viele Kirchenrechtler eine Klärung des rechtlichen Status des „emeritierten Papsttums“ forderten.
Verwirrung stiftete zudem die Anweisung von Pater Federico Lombardi, dem damaligen Vatikansprecher, auf Wunsch von Msgr. Georg Gänswein, Benedikt XVI. künftig als „Seine Heiligkeit Benedikt XVI., emeritierter Papst“ zu bezeichnen.
Der Vatikanist Sandro Magister kommentierte dies als „viel zu wenig und zu vage, um die Sache als geklärt ansehen zu können.“ Drei Tage zuvor hatte die römische Jesuitenzeitschrift La Civiltà Cattolica noch kategorisch ausgeschlossen, daß jemand, der zurücktritt, weiterhin als „Papst“ bezeichnet werden könne.
Benedikt XVI. beantwortete die ihm von Don Bux vorgelegten Fragen, ohne direkt auf sie einzugehen: Er betonte die Rechtmäßigkeit seines Rücktritts – sowohl in bezug auf die Ausübung des Amtes als auch auf das munus – und wies die Positionen der von Bux zitierten Historiker und Theologen scharf zurück. Diese seien, so Ratzinger, „meiner Meinung nach weder echte Historiker noch Theologen“ – er nannte sie später sogar „Journalisten“.
Faktisch war es jedoch das erste Mal in der Geschichte der Kirche, daß ein zurückgetretener Papst weiterhin als „Seine Heiligkeit“ und „emeritierter Papst“ bezeichnet wurde, die weiße Soutane trug und innerhalb des Vatikans verblieb.
Die Präsenz von zwei Päpsten sorgte für erhebliche Verunsicherung. Insbesondere deshalb, weil Benedikt selbst in seiner letzten Generalaudienz am 27. Februar 2013 sagte:
„Das ‚immer‘ ist auch ein ‚für immer‘ – es gibt kein Zurück in das Private mehr. Meine Entscheidung, auf die aktive Ausübung des Amtes zu verzichten, widerruft das nicht.“
Für weiteres Aufsehen sorgte ein Vortrag von Msgr. Gänswein am 20. Mai 2016 an der Päpstlichen Universität Gregoriana, in dem er sagte:
„Vor und nach seinem Rücktritt hat Benedikt seine Aufgabe als Beteiligung am Petrusamt verstanden und versteht sie weiterhin so. (…) Er hat dieses Amt keineswegs aufgegeben. Vielmehr hat er das persönliche Amt mit einer kollegialen und synodalen Dimension ergänzt – gewissermaßen ein gemeinschaftliches Amt.“
Und weiter:
„Es gibt daher nicht zwei Päpste, sondern de facto ein erweitertes Amt, mit einem aktiven und einem kontemplativen Mitglied.“
Diese Aussagen lösten bei Theologen große Fassungslosigkeit aus.
Historisch betrachtet hatte die Präsenz Benedikts im Vatikan allerdings den Effekt, die „Revolution“ von Papst Franziskus zu verlangsamen. War dies möglicherweise das Ziel?
Msgr. Bux schreibt:
„Es wird behauptet, Benedikt XVI. habe diesen Schritt unternommen, um einem Schisma zuvorzukommen, indem er den Modernisten zuvorkam, die ihn zum Rücktritt drängen wollten.“
Das deutet auf eine dramatische innerkirchliche Lage hin, die Don Bux unter Berufung auf Ratzinger so zusammenfaßt:
„Der Neopaganismus oder Säkularismus – wie auch immer man es nennt – ist durch das Hinterherlaufen hinter der Welt in die Kirche eingedrungen.“
Nach Einschätzung von Don Bux erreichte in den vergangenen Jahren die Durchdringung der Kirche durch modernistisch-progressistische Denkmuster ihren Höhepunkt:
„Der Apostel sagt: ‚Die Wirklichkeit aber ist Christus‘ (Kol 2,17). Doch seit über sechzig Jahren wird die Realität in der Kirche von der Utopie bedrängt (…) bis hin zu dem Punkt, daß Papst Franziskus nicht mehr erklärte, warum Gott Mensch geworden ist, sondern die Quelle der Brüderlichkeit anderswo suchte. Er bevorzugte individuelle und soziale Körperschaften, sprach nie über die Rettung der Seelen und verband die Hoffnung mit Utopie und Träumen – im Gegensatz zur christlichen Hoffnung, der theologalen Tugend, durch die wir das Himmelreich und das ewige Leben als unser Glück ersehnen, unser Vertrauen auf Christi Verheißungen setzen und uns nicht auf unsere Kräfte stützen, sondern auf die Gnade des Heiligen Geistes (KKK 1817). Kirchenmänner wurden zu Propheten der erschöpften postsäkularen Gesellschaft Europas, vermieden es aber, in Jesus den Weg zur Erlösung aufzuzeigen – und damit Trost in bezug auf die letzten Fragen des Daseins zu spenden: den Sinn von Leben und Tod sowie die Gründe des Leidens im irdischen Leben.“
Der große Abwesende in der Verkündigung war Jesus selbst.
Don Bux formuliert deshalb abschließend:
„Wenn sich die heutige Kirche in einer solch ‚offensichtlichen Verwirrung‘ befindet – kann der neue Papst dann einfach so tun, als sei nichts gewesen? Eine Erneuerung wird gewiß das Ende der Unordnung markieren, unter der die Kirche leidet.“
Papst Leo XIV. hat damit einen Anfang gemacht.
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Vatican.va (Screenshot)