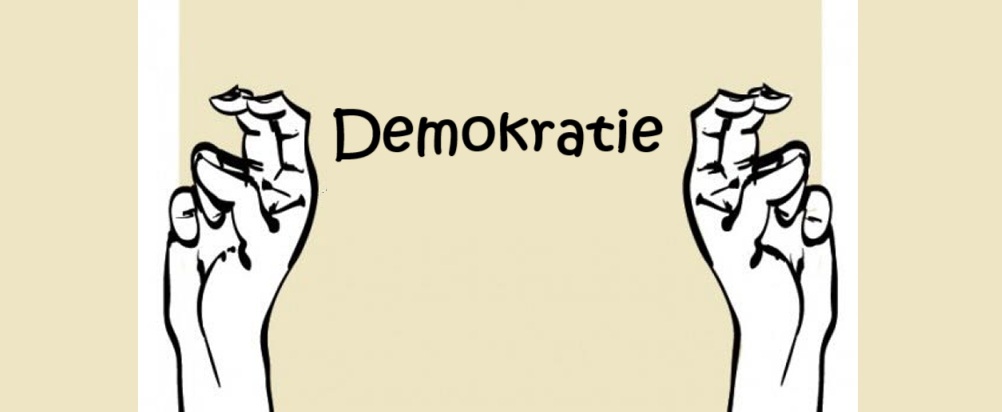
Prof. Trabucco legt in einem Aufsatz, der zuerst auf dem Blog Duc in altum von Aldo Maria Valli veröffentlicht wurde, den Finger in die große Wunde der sogenannten westlichen Ordnung oder freiheitlichen Demokratie. Zum bloßen Willen als einzig normierender Rechtsquelle genügt der Hinweis auf den sechsten Reichsparteitag der NSDAP, der im September 1934 in Nürnberg stattfand unter dem Motto: „Willen zur Macht“. Leni Riefenstahl drehte dazu einen aufschlußreichen Dokumentarfilm mit dem Titel: „Triumph des Willens“, mit dem sie zahlreiche auch internationale Preise gewinnen konnte. Eine Mahnung, die man unter demokratischem Vorzeichen leichtfertig in den Wind zu schlagen scheint. Doch die conditio humana ändert sich nicht, weil es einen technischen Fortschritt gibt und auch nicht weil sich Staats- oder Regierungsformen ändern. Die katholische Kirche als die Hüterin des Wissens über das Menschsein steht in der Pflicht, beständig vor fatalen Trugschlüssen zu warnen.
Die Demokratie und der selbstbestimmte Mensch
Von Daniele Trabucco*
Das gegenwärtige Abendland beruht auf einem strukturellen Oxymoron: dem Anspruch auf Freiheit durch die Verneinung der objektiven Ordnung der Wirklichkeit. Die modernen liberalen Demokratien, die sich als geschichtliche Offenbarungen individueller Autonomie und als Ausdruck der Volksbeteiligung präsentieren, verbergen in Wahrheit eine tiefgreifende theoretische Krise, deren Wurzel in der Abkoppelung der politisch-rechtlichen Ordnung vom metaphysischen Fundament des Naturrechts liegt. An die Stelle der Wahrheit als Maßstab der Gerechtigkeit ist der Wille getreten – mal der des einzelnen, mal der des Volkes, mal der überstaatlicher Apparate – als einzige Quelle normativer Legitimation. Die Demokratie, reduziert auf ein selbstbezogenes Verfahren, erhebt sich so zum politischen Götzen einer Epoche, die den Sinn für die Teilhabe an der „lex aeterna“ verloren hat.
Die moderne Idee der Demokratie, weit davon entfernt, eine geordnete Regierungsform zum Wohle des Gemeinwohls zu sein, erscheint zunehmend als formales Entscheidungsschema, das auf der Unbestimmtheit der Inhalte gründet. Sie entsteht und entwickelt sich innerhalb eines anthropologischen Paradigmas, das vom Nominalismus und einer absoluten Subjektivierung der Freiheit geprägt ist: Der Mensch, als „ens ex nihilo“ verstanden, hält sich für seinen eigenen Schöpfer, für den willkürlichen Erbauer seines Seins und seines Zieles. Diese Annahme zerstört jede Möglichkeit eines Naturrechts, das als rationale Maßgabe menschlichen Handelns im Einklang mit einer vernunftgemäß geordneten Natur verstanden wird. Das Recht, vom Sein losgelöst, wird zur bloßen Entscheidung, und diese Entscheidung, der Wahrheit entkoppelt, beugt sich den Zufälligkeiten des Begehrens.
Der zeitgenössische Konstitutionalismus, Kind dieser theoretischen Wurzel, basiert auf einer ursprünglichen Zweideutigkeit: Einerseits verkündet er unveräußerliche Menschenrechte, andererseits verweigert er es, diese Rechte auf eine normative Anthropologie zu gründen. Das Resultat ist ein System, in dem die Menschenwürde zwar abstrakt behauptet, aber ihres konkreten Inhalts entleert ist, da man das Wesen des Menschen, das durch die Vernunft erkennbar ist, nicht mehr anerkennt. Das Individuum, absolut gesetzt und aus dem Kontext gelöst, wird zum Zentrum der Rechtsproduktion als Subjekt unbegrenzter Ansprüche – ohne Bezug auf ein objektives Maß des Guten. So wird das Recht nicht mehr als rationale Ordnung menschlichen Handelns verstanden, sondern als unendliche Vervielfältigung individueller Erwartungen, die als subjektive Rechte ohne jegliche ethische Grundlage institutionalisiert werden.
Die Europäische Union verkörpert beispielhaft diese postmetaphysische Entwicklung. Seit dem Vertrag von Maastricht von 1992 (in Kraft seit dem 1. November 1993) hat die EU allmählich die Logik der Integration souveräner nationaler Ordnungen verlassen und das Modell einer überstaatlichen technokratischen Governance übernommen, die von einem schwebenden positiven Recht geleitet wird, ohne jede Verwurzelung im Naturrecht oder in der klassischen Rechtstradition. Das Prinzip der Subsidiarität wurde seines ursprünglichen Sinnes beraubt – nämlich des Schutzes der Autonomie untergeordneter Gemeinschaften im Hinblick auf das Gemeinwohl – und zu einem Mechanismus der Neutralisierung nationaler Souveränität unter dem Primat wirtschaftlicher Kompatibilität und finanzieller Parameter umfunktioniert.
In diesem Zusammenhang ist der Volkswille nicht mehr Ausdruck einer gemeinsamen Suche nach dem Gemeinwohl, sondern eine rein prozedurale Funktion innerhalb eines normativen Rahmens, der bereits von sich selbst reproduzierenden Machtzentren vorgegeben wurde. Das EU-Recht erscheint als anonyme Normativität, gesichtslos, unfähig, eine gerechte Ordnung auszudrücken, weil es nicht auf die Wahrheit des Menschen und der Gemeinschaft ausgerichtet ist. Die „lex“, da sie nicht mehr „ordinatio rationis ad bonum commune“ ist, wird zum „imperium technicum“, zur strategischen Regulierung der Vielheit im Dienst eines systemischen Gleichgewichts. Der Rechtspositivismus, zum hegemonialen Sprachgebrauch des westlichen Rechts geworden, hat so die Auflösung der Idee von Gerechtigkeit vollendet. Indem er das Recht als Ausdruck eines normativen Willens ohne ontologische Grenzen versteht, hat er das Kriterium der Wahrheit durch das der formalen Gültigkeit ersetzt.
Der Normativismus nach Kelsen, der auf der Selbstreferenzialität des Rechtssystems und der Neutralisierung ethischer Inhalte gründet, hat eine Rechtsordnung hervorgebracht, in der es keine Unterscheidung mehr zwischen „ius“ und „lex“ gibt, zwischen dem, was an sich gerecht ist, und dem, was positiv festgelegt wurde. Die Folge dieser Verschiebung ist zweifach: einerseits der Verlust der Unterscheidung zwischen Legitimität und Legalität, andererseits die Erhebung der Freiheit zur absoluten Selbstbestimmung – selbst gegen die Ordnung der Natur.
Die moderne Freiheit, verstanden als Emanzipation von jeglicher natürlicher Bindung und objektiver moralischer Ordnung, erweist sich in ihrer geschichtlichen Entfaltung als Instrument der Unterwerfung unter die systemische Macht. Das postmoderne Individuum, scheinbar frei, ist in Wirklichkeit radikal fremdgesteuert: Sein Bewußtsein wird durch Bildungs- und Medienmechanismen geformt, die künstlichen Konsens erzeugen; sein Wille wird durch normative Systeme gelenkt, die selbst die intimsten Bereiche des Daseins regeln; seine Entscheidungsfähigkeit ist durch vorgefertigte rechtliche Rahmenbedingungen eingeschränkt, die seinen Handlungsspielraum begrenzen. In diesem Zustand wird die individuelle Autonomie, statt Ausdruck der Würde der Person zu sein, zur tragischen Karikatur derselben.
Die Krise des Westens ist daher nicht nur politischer oder wirtschaftlicher Natur, sondern zutiefst ontologischer und axiologischer Art. Die Rechtsordnung hat ihre Daseinsbegründung verloren, weil sie ihr Fundament in der „lex naturalis“ – der Teilhabe des vernünftigen Geschöpfs an der „lex aeterna“ – verleugnet hat.
Das Naturrecht ist kein von oben auferlegter Regelkatalog, sondern die erkennbare Ordnung des Seins, die von der rechten Vernunft als Maß des Gerechten erkannt werden kann. Nur innerhalb dieses Horizonts kann dem Recht, der Gerechtigkeit und der Freiheit wieder Bedeutung verliehen werden. Wahre Freiheit ist nicht Willkür, sondern Übereinstimmung des Handelns mit der Wahrheit des Seins. Sie ist „libertas per veritatem“, nicht „libertas a veritate“. Der einzige Weg zur Wiederherstellung der politisch-rechtlichen Ordnung führt daher über eine Neugründung des gesamten normativen Systems auf Grundlage der Ontologie des Naturrechts. Dies setzt eine radikale intellektuelle Umkehr voraus: vom Positivismus zum Essentialismus, vom Formalismus zum Finalismus, vom Subjektivismus zum Realismus. Ohne diese Rückkehr zu den metaphysischen Wurzeln des Rechts wird jeder institutionelle Reformversuch wirkungslos bleiben, da er sich weiterhin innerhalb der Koordinaten eines selbstzerstörerischen Paradigmas bewegt.
Wie schon der heilige Thomas von Aquin (1225–1274) mahnte: „Lex humana, si non sit secundum rationem, non est lex sed corruptio legis“ – Ein Gesetz, das nicht der natürlichen Vernunft entspricht, ist kein Gesetz, sondern eine Verderbnis des Gesetzes. Die Demokratie muß sich daher, um wahrhaftig zu sein, wieder als auf die Gerechtigkeit ausgerichtet verstehen – und die Gerechtigkeit wiederum muß ihr Fundament in der Wahrheit des Seins erkennen. Ohne dieses Fundament verfallen Institutionen zu Herrschaftsinstrumenten, Rechte zu selbstbezogenen Ansprüchen, Freiheit zu einem Trugbild. Das Schicksal der westlichen Demokratien hängt nicht von einer effizienteren Machtverteilung ab, sondern vom Wiedererkennen des Primats der Wahrheit über das Handeln, des Naturrechts über die Normproduktion, des Gemeinwohls über das subjektive Interesse. Jeder andere Entwurf bleibt substanzlos – bloße juristische Tautologie in einem Universum, das den Logos verstoßen hat.
*Daniele Trabucco, Professor für Verfassungsrecht und vergleichendes öffentliches Recht an der SSML/Hochschule San Domenico in Rom
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Duc in altum



