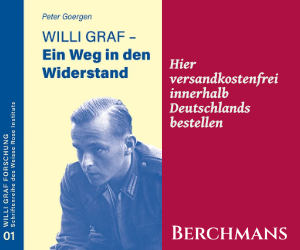In katholischen Kreisen wird seit Jahrzehnten der Wunsch nach einer „Restauration“ von Glauben, Kirche und christlicher Kultur geäußert. Gemeint ist eine Rückkehr zu den Quellen, da offensichtlich nicht nur die Welt, sondern auch Teile der kirchlichen Autorität – teils sogar der Stellvertreter Christi – die göttliche Offenbarung vernachlässigen. Doch statt der erhofften Restauration, die bei Benedikt XVI. Ansätze zeigte (progressive Kreise bezeichneten das „Doppelpontifikat“ von Johannes Paul II. und Benedikt XVI. als „restaurative Phase“), folgte mit der Wahl von Franziskus das Gegenteil: eine radikal antirestauratorische Haltung. Franziskus machte sich bei vielen Gelegenheiten über jene katholischen Kreise und ihre Hoffnungen gar lustig. „Aber selbst im konservativen Spektrum erhoben sich Stimmen gegen die Idee einer Wiederherstellung der christlichen Kultur, und jene, die das taten, waren keine Laien“, so Caminante Wanderer. Und er fügt hinzu: „Wahrscheinlich haben sie den Begriff mißverstanden: Für sie scheinen die Restaurationsbefürworter eine Art katholische Mennoniten zu sein. Es ist jedoch auch denkbar, daß sie – obwohl sie sich Konservative nennen – in Wahrheit langsam fortschreitende Progressisten sind und bereits progressive Positionen einnehmen, ohne es zu merken.“
Caminante Wanderer verweist auf einen Artikel, um den Sachverhalt zu klären und aufzuzeigen, warum in der Kirche hingegen eine Restaurierung notwendig ist. „Er versteht sich als Antwort auf das universelle Gesetz der Entropie“. Der Artikel stammt von dem englischen Dominikaner und Oxford-Absolventen Pater Thomas Crean.
Die Notwendigkeit einer religiösen Restauration
Von Thomas Crean OP*
Die Notwendigkeit einer religiösen Restauration ist sehr alt. Sie begann lange vor den liturgischen Umwälzungen der 1960er Jahre, lange vor der Abwicklung des Christentums durch säkulare Regime in der Zeit der Französischen Revolution oder dem Verschwinden der mittelalterlichen Scholastik. Wenn wir dem Urteil des heiligen Thomas von Aquin folgen, begann sie im zweiten Moment der Schöpfung. Laut ihm war es genau damals, als eine große Zahl Engelwesen vom Zustand der Gnade abwich, sich selbst zuwandte und vom Licht in die Finsternis überging. So wurde die himmlische Stadt fast von Beginn an vieler ihrer rechtmäßigen Bewohner beraubt.
Nach Ansicht des heiligen Augustinus war ein Zweck der Inkarnation, die Trümmer dieser himmlischen Stadt wiederherzustellen, indem die Menschen die Plätze einnehmen, die durch die gefallenen Engel leer geworden waren. Wie er im Enchiridion über Glauben, Hoffnung und Liebe erklärt:
„Jerusalem, die da droben ist, die Mutter von uns allen, die Stadt Gottes, wird von keinem ihrer Bürger entblößt werden, sondern vielleicht über eine noch zahlreichere Bevölkerung herrschen.“ Thomas von Aquin kommentiert – in bezug auf die Worte des Apostels Paulus an die Epheser: „Er hat beschlossen, alles in Christus wiederherzustellen, was im Himmel und auf Erden ist“ – dahingehend:
„Was im Himmel ist, das sind die Engel; nicht, daß Christus für die Engel gestorben wäre, sondern daß er durch die Erlösung des Menschen ihre Ruine wiederherstellt.“
Wie der Begriff „erlösen“ nahelegt, muß der Mensch selbst wiederhergestellt werden. Im 2. Jahrhundert schrieb Meliton, Bischof von Sardes:
„Der Mensch berührte den Baum, verletzte das Gebot und gehorchte nicht Gott. Deshalb wurde er in diese Welt verbannt wie in ein Schuldgefängnis.“
Wie im Gleichnis vom barmherzigen Samariter ist der gefallene Mensch nackt und verwundet – seines Mantels der Gnade und seiner natürlichen Kräfte beraubt. In besseren Momenten sehnt er sich danach, in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt zu werden – als er, in Worten von Hugo von St. Victor, nicht Gott suchen mußte wie einen Abwesenden.
Zumindest im kosmischen Sinn muß der Christ also ein Wiederhersteller, ein Restaurator, sein. Aber wie sieht das im Alltag in dieser gefallenen Welt aus? Kann man erwarten, daß religiöse Restaurierung regelmäßig nötig wird? Ohne Zweifel ja – und zwar vor allem aus logischen Gründen. Die heilbringende Wahrheit, durch die wir lernen, was wir über Gott glauben und wie wir ihn anbeten sollen, ist kein Werk menschlicher Produktivität. Sie muß von oben kommen, wie es Jakobus betont.
Deshalb können wir zwar erwarten, daß innerhalb eines bestimmten Volkes – zumindest bei Abwesenheit von Kriegen oder anderen Katastrophen – die technologische Fähigkeit oder die Naturwissenschaften von einer Generation zur nächsten fortschreiten, doch dieselbe Zuversicht in die Treue dieses Volkes zur göttlichen Offenbarung können wir nicht haben. Vielmehr können wir erwarten, daß das „Gesetz der Entropie“ im geistlichen Bereich genauso wirkt wie im materiellen. Schließlich wirken, so wie es John Henry Newman nannte, „diese Riesen, die Leidenschaft und der Stolz des Menschen“ beständig und neigen von Natur aus dazu, die Religion zu zersetzen.
Das erklärt, warum im Alten Testament für die Israeliten eine jährliche Wiederherstellung vorgeschrieben war. Am Tag der Versöhnung mußte der Hohepriester das Heiligtum von der Unreinheit der Kinder Israel sühnen und die Stiftshütte zu ihrem ursprünglichen Zustand ritueller Reinheit zurückführen, damit dort ein weiteres Jahr lang Opfer dargebracht werden konnten (Lev. 16).
Die menschliche Natur hat sich seit damals nicht verändert. Man kann erwarten, daß im Laufe der Zeit der göttliche Kult durch Respektlosigkeit und Formalismus getrübt wird, während das moralische Leben der Christen lockerer, weltlicher und kompromißbereiter wird und ihre Annahme der göttlichen Wahrheit immer lauwarmer, teilweiser, zögerlicher und verworrener erscheint. Noch einmal zitiere ich Newman:
„Die Natur neigt zur Gottlosigkeit und zum Laster, und tatsächlich entwickelt sich diese Neigung und erfüllt sich in jeder Menschenmenge, nach dem Spruch des alten Griechen, daß ‚die vielen böse sind‘, oder nach dem Zeugnis der Schrift, daß die Welt mit ihrem Schöpfer verfeindet ist. Der Zustand der Dinge ändert sich nicht, wenn eine Nation getauft wurde; doch in der Praxis setzt sich die Natur gegen die Gnade durch, und die Bevölkerung fällt in einen Zustand der Schuld und Benachteiligung, der aus gewisser Sicht schlimmer ist als der, aus dem sie erlöst wurde. So hat die Schrift es prophezeit: ‚Viele sind berufen, aber wenige sind erwählt‘; ‚das Himmelreich gleicht einem Netz, das ins Meer geworfen wird und alle Arten von Fischen sammelt‘ (Difficulties of Anglicans, Vortrag 9).
Natürlich ist dies nur eine Seite der Wahrheit. Ich bestreite nicht, daß Gott in jeder Epoche neue Heilige und Lehrer hervorbringt, die für diese Zeit passend sind. Wie Newman sagt, nachdem er die Lage vieler beschrieben hat: „Die Kirche bemüht sich zugleich mit aller Kraft, sie zu ihrem Schöpfer zurückzuführen; und tatsächlich bringt sie gewaltige Mengen zurück, einen nach dem anderen, obwohl einer nach dem anderen wieder fällt.“
Weniger bestreite ich den großen Wandel, den die Menschheitsgeschichte durch die Inkarnation erfahren hat, durch die das alte Gesetz einer neuen und ewigen Bündnisordnung Platz machte. Ebenso bestreite ich nicht die Möglichkeit einer neuen Ausgießung der Gnade über die Kirche, wie viele sie im Zusammenhang mit einer Massenbekehrung des jüdischen Volkes erwartet haben.
Doch obwohl dieses von mir vorgeschlagene Gesetz der geistlichen Entropie nicht das einzige Gesetz ist, das im geistlichen Bereich wirkt, so ist es doch dauerhaft wirksam, und daher ist der „Restaurationsgedanke“ als fester Bestandteil der Haltung der Christen gerechtfertigt.
Dies war ein Argument a priori, das auf der absteigenden Tendenz der menschlichen Natur basiert. Aber wir können auch aus der Geschichte argumentieren, und zwar vor allem aus der inspirierten Geschichte des auserwählten Volkes. Wie Joseph Shaw festgestellt hat, präsentiert uns das Alte Testament wiederholt das Ideal der Wiederherstellung nach einer Zeit des Verfalls oder einer Katastrophe, und ganz konkret die der liturgischen Wiederherstellung (The Case for Liturgical Restoration, in: Una Voce studies on the Traditional Latin Mass, Angelico Press, 2019, S. 14).
Josia, der letzte König von Juda, der vor der Ankunft der Babylonier friedlich regierte, stellte nicht nur den Kult im Tempel in seiner ursprünglichen Reinheit wieder her und feierte das erste Pessachfest seit den Tagen des Exodus nach allen vorgeschriebenen Ritualen. Er entdeckte auch das Buch Deuteronomium wieder, das im Tempel verlorengegangen und in Vergessenheit geraten war, und setzte alle seine Vorschriften in die Tat um.
Nach der Rückkehr aus dem babylonischen Exil, als das Volk entmutigt zögert, den zerstörten Tempel wieder aufzubauen, erweckt Gott den Propheten Haggai, um ihnen zu sagen, daß sie es tun sollen. Dieses Volk sagt: „Es ist noch nicht die Zeit, das Haus des Herrn zu bauen.“ Und das Wort des Herrn kam durch den Propheten Haggai, indem er sprach: „Ist es Zeit für euch, in Häusern mit geschnitzten Balken zu wohnen, während dieses Haus wüst liegt?“
Als nach dem Wiederaufbau des Tempels die Ältesten weinen, weil sie den bescheidenen Zustand mit dem Glanz vergleichen, den sie noch von vor siebzig Jahren kennen, sendet Gott den Propheten Sacharja, um sie mit diesen geheimnisvollen Worten zu trösten: „Verachte nicht den Tag der kleinen Dinge.“
Es vergehen weitere 350 Jahre. Erneut werden die Opfer im Tempel unterbrochen – diesmal durch die Heere des Antiochos IV. Epiphanes, der ein Götzenbild auf dem Altar Gottes errichten läßt. Viele der einflußreicheren Juden kommen zu dem Schluß, daß die Zeit der Befolgung des mosaischen Gesetzes vorüber sei – ein Erbe aus einer angeblich „primitiveren“ Epoche. Ihrer Meinung nach folge der Bogen der Geschichte unaufhaltsam dem Hellenismus. Doch ein weiteres Mal zeigt sich: Gottes Wille ist die Wiederherstellung.
Als Judas Makkabäus und seine Brüder den Tempelberg zurückerobern, lesen wir:
„Sie sahen das Heiligtum verwüstet, den Altar entweiht, die Tore verbrannt und Gestrüpp, das in den Vorhöfen wucherte wie in einem Wald oder in den Bergen; die an den Tempel angrenzenden Räume waren niedergerissen.“
Wie reagieren sie? Zunächst – ganz natürlich – klagen sie: Sie zerreißen ihre Kleider und bedecken ihr Haupt mit Asche. Doch dann gehen sie ans Werk: sie reinigen den heiligen Ort, wählen zwölf neue Steine aus, um einen neuen Altar zu errichten, dem Vorbild des alten entsprechend, sie stellen neue heilige Gefäße her und bringen erneut Opfer dar – gemäß dem Gesetz.
Deshalb konnte zwei volle Generationen später, als unser Herr geboren wurde, er würdig im Tempel dargestellt werden – in Erfüllung der Prophezeiung des Haggai, die er den zögerlichen Bauleuten seiner Zeit verkündete: „Die Herrlichkeit dieses letzten Hauses wird größer sein als die des ersten“ (Haggai 2,9).
Im Neuen Testament finden sich weniger Beispiele, doch es gibt Anspielungen auf das Abdriften der menschlichen Natur und die notwendige Wiederherstellung. Jesus sagt zur Gemeinde in Ephesus: „Ich werfe dir aber vor, daß du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke, aus welcher Höhe du gefallen bist. Kehr zurück zu deinen ersten Werken! Wenn du nicht umkehrst, werde ich kommen und deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken.“
An den Klerus derselben Gemeinde in Ephesus richtet der heilige Paulus folgende Worte: „Ich weiß, daß nach meinem Abschied reißende Wölfe unter euch eindringen werden, die die Herde nicht schonen, und aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger an sich zu ziehen.“
Was wird die Verteidigung gegen diese zukünftigen Irrlehrer sein? Es wird sein, zurückzublicken auf die Apostel. „Gedenkt eurer Vorsteher“, sagt er an die Juden, „die euch das Wort Gottes verkündet haben; folgt ihrem Glauben und richtet eure Aufmerksamkeit auf den Zweck ihres Lebenswandels.“
Ebenso ist seine Lösung für die liturgischen Unordnung in Korinth, die Korinther aufzurufen, zur liturgischen Tradition zurückzukehren, die sie von ihm empfangen haben und durch ihn von Christus selbst.
Wenn wir vom Neuen Testament zum nachfolgenden Leben der Kirche übergehen, finden wir beständig das Ideal der Erneuerung im Leben der Heiligen und der großen Männer der Kirche.
Der heilige Augustinus ruft zu Beginn seiner Ordensregel das Beispiel der Kirche von Jerusalem aus der Apostelgeschichte in Erinnerung, wo alle Gläubigen ein Herz und eine Seele waren und alles gemeinsam hatten. Diese Verfassung war schon lange verschwunden, aber der heilige Augustinus, ebenso wie andere Ordensgründer, wünschte, sie in seiner Zeit und für seine eigene Gemeinschaft wiederherzustellen.
Die Liturgie der Kirche lobt den heiligen Dominikus. Im Präfationsgebet seines Festes spricht der Priester zu Gott: „Du hast gewollt, die apostolische Lebensweise durch den heiligen Patriarchen Dominikus zu erneuern.“
Auch der heilige Franziskus wird von der Kirche am Fest seiner Stigmata gelobt, weil er die Liebe wieder entflammte – die erste Liebe der Kirche, könnte man sagen – als die Welt erkaltete.
Unter diesem Lob der Erneuerung liegt, so würde ich sagen, ein tiefes Verständnis dessen, was ich das Gesetz der geistlichen Entropie genannt habe, nämlich die Unvermeidlichkeit des Verfalls, aber eines Verfalls, dem durch menschliche Anstrengungen unter der Gnade bis zu einem gewissen Grad widerstanden und der gemildert werden kann. Es ist eine Haltung, die vielleicht von der Frage unseres Herrn an die Jünger inspiriert ist: „Wenn der Menschensohn kommt, wird er dann den Glauben auf der Erde vorfinden?“, ebenso wie von den verschiedenen Prophezeiungen im Neuen Testament über die Übel der letzten Tage.
Diese Haltung findet sich bereits ausdrücklich in der patristischen Zeit. „Ich gebe euch keine Gebote wie Petrus oder Paulus“, schrieb Ignatius von Antiochia Anfang des 2. Jahrhunderts an die Römer, „sie waren freie Männer, während ich, selbst bis jetzt, ein Sklave bin“. In einem Brief an die Kirche von Neocaesarea im Jahr 368, um den Tod ihres heiligen Bischofs Musonius zu beklagen, schrieb Basilius der Große: „Es ist ein Mann gestorben, der seinen Zeitgenossen offenkundig überlegen war… Er zeigte den alten Charakter der Kirche, so daß denjenigen, die Zeit mit ihm verbrachten, es schien, als befänden sie sich in Gesellschaft eines jener Männer, die vor mehr als zweihundert Jahren wie Sterne leuchteten.“ (Brief 28)
Die gleiche Haltung findet einen überraschenden und rätselhaften Ausdruck in einem Satz, der dem heiligen Ischyrion, einem der Wüstenväter, zugeschrieben wird: Die heiligen Väter machten Vorhersagen über die letzte Generation. Sie sagten: „Was haben wir getan?“ Einer von ihnen, der große Abba Ischyrion, antwortete: „Wir haben die Gebote Gottes erfüllt.“ Die anderen fragten: „Und was werden diejenigen tun, die nach uns kommen?“ Er sagte: „Sie werden darum kämpfen, die Hälfte unserer Werke zu vollbringen.“ Sie fragten weiter: „Und was wird denen geschehen, die nach ihnen kommen?“ Er antwortete: „Die Menschen jener Generation werden kein Werk vollbringen, und Versuchung wird über sie kommen; und diejenigen, die an jenem Tag bestehen, werden größer sein als wir oder unsere Väter.“
Einige Worte von Thomas von Aquin können hier lehrreich sein. Er schreibt:
Die endgültige Vollendung der Gnade erfolgte durch Christus, weshalb seine Zeit „die Fülle der Zeiten“ genannt wird. Folglich kannten diejenigen, die Christus näher standen, sei es zuvor, wie Johannes der Täufer, oder danach, wie die Apostel, die Geheimnisse des Glaubens vollständiger. Dasselbe beobachten wir hinsichtlich des Zustands des Menschen, der in der Jugend seine Vollkommenheit erreicht, und je näher er der Jugend ist, sei es vor oder nach ihr, desto vollkommener ist er. (Summa Theologiae, 2a 2ae 1.7 ad 4)
Mit anderen Worten, so der Doctor Angelicus, beinhaltet dies als Teil der Ehre, die Christus gebührt, daß das mittlere Maß an Gnade und geistlicher Erkenntnis unter den Menschen im Verhältnis zu unserer Nähe zur Zeit seiner ersten Ankunft größer sein wird. An anderer Stelle schreibt er: „Was den Glauben an die Menschwerdung Christi betrifft, so ist es offensichtlich, daß, je näher die Menschen Christus waren, sei es vor oder nach Ihm, sie größtenteils vollständiger über diesen Punkt unterrichtet waren, wenn auch nach Ihm vollständiger als vorher“ (2a 2ae, 174.6). Dies gibt uns einen weiteren Grund, warum die restaurative Haltung, im religiösen Bereich auf die Vergangenheit zu schauen und daraus Inspiration zu ziehen, für den Christen besonders angemessen ist.
*Pater Thomas Crean, englischer Dominikaner, studierte Philosophie und Theologie am St. John’s College in Oxford, 1995 trat er in den Dominikanerorden ein und wurde 2001 zum Priester geweiht. Er promovierte an der Katholischen Hochschule ITI in Trumau in Österreich, Autor mehrerer Bücher, darunter „A Catholic Replies to Professor Dawkins“, „The Mass and the Saints“ und zuletzt „Vindicating the Filioque“ über das Konzil von Florenz (Emmaus Academic, 2023), lebt im Dominikanerpriorat von Haverstock Hill im Norden Londons.
Einleitung/Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Caminante Wanderer