
Ein Priester des Erzbistums Genua, die seit 2020 von dem bergoglianischen Minoriten Msgr. Marco Tasca geleitet wird, wandte sich mit einem Brief an Aldo Maria Valli, den ehemaligen Leiter der Religionsabteilung der italienischen Fernsehanstalt RAI, der ihn auf seinem Blog Duc in altum veröffentlichte. Da die Schilderung nicht nur die Diözese Genua betrifft, legen wir das Schreiben auch in deutscher Übersetzung vor:
So erlebe ich als Priester die Selbstauflösung der Kirche
Ich bin Priester der Diözese Genua. Da Duc in altum bereits mehrfach Aufmerksamkeit für unsere Situation gezeigt hat, fühle ich mich ermutigt, einige Überlegungen mit Ihnen und Ihren Lesern zu teilen.
Seit Jahren erleben wir den regelrechten Abbau unserer Diözese, besonders seit Juli vor fünf Jahren, als Pater Marco Tasca – zuvor Generalminister des Ordens der Franziskaner-Konventualen – zum Bischof ernannt wurde.
Natürlich war die Diözese schon zuvor von der allgemeinen Krise betroffen, die die gesamte Weltkirche durchzieht. Doch seither sind wir auf dem Weg der Selbstauflösung, begleitet von einer tiefgreifenden Umwandlung aller diözesanen Strukturen.
Der Bischof hat sich ein Umfeld enger Mitarbeiter geschaffen – aus den Pfarreien abgezogen – den sogenannten magischen Zirkel, mit dem er seither arbeitet.
Zentrum dieses Kurses ist der Synodale Weg. Eine Gruppe von Laien wurde ins Leben gerufen, die zunehmend das Sagen hat. Es handelt sich um Menschen mit hohem sozialem und kulturellem Status – Universitätsprofessoren, Anwälte, Vertreter der feinen Genueser Gesellschaft –, größtenteils Ex-68er mit ultraprogressiver Gesinnung. Ihre Themen sind die typischen Parolen des kirchlichen Mainstreams: mehr Raum für Laien, Marginalisierung der Priester und der Sakramente, eine „hörende Kirche“, eine „Kirche der Armen“ sowie feministische und queere Forderungen. Und das alles mit dem Paradox, daß diese Leute ständig von den Armen sprechen, selbst aber wohlhabend sind und abgeschieden in den noblen Vierteln der Stadt leben.
Bischof und Synodalteam verfolgen ein neues Modell der „Fürsorge“ für die Pfarreien, bei dem Laien immer stärker in den Vordergrund treten – bis hin zur faktischen Ersetzung des Priesters. Das geschieht nicht etwa nur in administrativen Dingen (wo Hilfe wirklich willkommen wäre), sondern in der alltäglichen Leitung und sogar in der Liturgie. Das Modell heißt „Pfarrgemeinschaften“, betreut von einem Priester zusammen mit einem „Team“.
In letzter Zeit wurden einige Pfarrer zu „Moderatoren“ ernannt – ein Titel, den das Kirchenrecht gar nicht kennt – und ihnen mehrere, teils weit auseinanderliegende Pfarreien übertragen. Das geschieht nicht in erster Linie wegen Priestermangels, sondern um das Priestertum bewußt umzudeuten und Laien die Macht zu geben.
Ein besonders deutliches Beispiel ist die Ernennung eines jungen Priesters zu seinem ersten Pfarramt in der Val Bisagno: Als „Moderator“ betreut er nicht eine, sondern gleich vier Pfarreien – obwohl es durchaus genügend Priester gäbe. Doch das Ziel ist klar: Laien sollen künftig die Pfarreien leiten. Sein Vorgänger hatte sich gegen dieses System gestellt.
Wer sich dem widersetzt, wird ausgegrenzt. Wer mitmacht, verliert seine priesterliche Identität als Hirte der Gemeinde. Das Amt des Lehrens und Heiligens wird ausgehöhlt. Die Sendung der Kirche und die Berufung des Priesters verschwimmen. Stattdessen wird gebetsmühlenartig wiederholt: „Gemeinsam gehen“, „Besser Unrecht haben, als die Beziehung verlieren“ – lauter gefühlsduselige Phrasen.
Die Berufungspastoral ist faktisch tot. Das Priesterseminar – dessen Rektor gern T‑Shirts mit Che-Guevara-Aufdruck trägt – ist am Tiefpunkt angekommen. Es herrschen dort unzählige soziale Experimente. Kein Gebet, keine Früchte.
Kürzlich fand ein Fortbildungstag für die Kurie statt, geleitet vom Synodalteam, in dem mehrere Frauen lautstark mehr Raum und Bedeutung für sich und die Laien forderten. Einige gehören zu einer feministischen Bewegung, die unrechtmäßige Liturgien veranstaltet – mit einem Priester als „Vorsitzendem“, während die Frauen alles leiten. Eine ideologisch aufgeladene Vision, die mit dem Evangelium nichts zu tun hat.
Und dann gibt es noch die unvermeidlichen Vigilien gegen „Homo- und Transphobie“, bei denen Priester und bischöfliche Vikare mitwirken. Dort redet man endlos von Inklusion – allerdings nicht, um die Menschen zur Bekehrung zu führen, sondern um die Sünde zu legitimieren.
Natürlich haben Laien mit christlichem Geist seit jeher in den Pfarreien mitgewirkt. Doch nun dominieren radikal-schicke Eliten, die in Papst Franziskus ihren Vordenker sehen.
Wenn diese „aufgeklärten“ Vorreiter vom „Protagonismus der Laien“ sprechen, tun sie so, als hätten Laien früher keine Rolle gespielt. Dabei ist ihre ganze Sichtweise ideologisch – nicht evangeliumstreu.
In dieser Lage sind viele Priester zutiefst entmutigt. Sie leben in einer diözesanen Realität, die nichts mehr mit dem Wesen des Priesters und dem Weihesakrament zu tun hat. Ein sehr begabter Priester, der kürzlich versetzt wurde, gestand mir sein ganzes Unbehagen: Er will Priester sein – nicht „Moderator“, nicht Koordinator eines Teams wie in einem Unternehmen!
Was wir erleben, ist eine Verfälschung des Glaubens durch die Pastoral: Nicht mehr die Rettung der Seelen steht im Zentrum, nicht mehr das Verlangen, Christus zu bringen, sondern ein politisch korrektes Sozialprogramm, wie es genauso gut vom linken Parteispektrum kommen könnte: Ökologismus, Gender-Gleichheit, Inklusion, Dialog… Und so verflüchtigt sich das Christentum – und stirbt.
Das Pontifikat von Papst Leo XIV. hat bisher keine Wende gebracht. Man fährt fort mit denselben Schlagworten – blind für die Dramatik der Lage.
Einige von uns versuchen noch, katholisch zu bleiben, aber das Gefühl ist: Wir sind am Limit angekommen.
Einleitung/Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Wikicommons

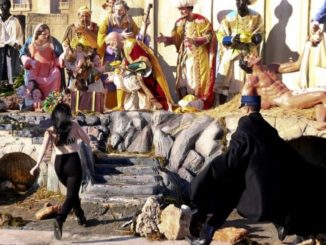


Nun, in Deutschland ist es ebenso, nur darf man den Wahnsinn hier auch noch finanzieren. Daher meine dringende Bitte: Zahlen Sie keine “ Kirchensteuer“ mehr!! Nur so kann man ein “ nachhaltiges“ Zeichen setzen und katholisch bleiben!
Die Lage der Kirche ist ernst: In einem aufrüttelnden offenen Brief an den Generalvikar des Bistums Fulda, Dr. Martin Stanke, kommentiert Pfarrer Winfried Abel (Priester des Bistums Fulda im Ruhestand und bekannter Exerzitienmeister) die Situation der Kirche im Bistum Fulda.
Siehe:
https://www.kath.net/news/88015
Möchten Sie zu «Schule und Bildung» eine kleine neurolinguistische Seelenmassage?
Angriffsziel Schule und Kirche
von Dr. phil. Judith Barben, Psychologin
https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2012/nr25-vom-1162012/moechten-sie-zu-schule-und-bildung-eine-kleine-neurolinguistische-seelenmassage
https://www.ostinstitut.de/documents/Besitzt_der_gegenwrtige_Konflikt_mit_Russland_eine_kulturelle_Dimension.pdf
——————————–
Schließlich wird auch die für die Moderne maßgebliche Trennung von Staat und Kirche in der
Postmoderne zunehmend in Frage gestellt. Ob es um die öffentliche Diskussion im Zuge der
Mohammed-Karikaturen geht, um die Rechtmäßigkeit der im Judentum praktizierten Beschneidung
oder um die Punk Band Pussy Riot. In all diesen öffentlichen Debatten wird ein neuer Wertmaßstab
etabliert. Nämlich eine Wertsetzung, die das Recht der Religionen auf einen eigenen vom Staat
unabhängigen Bereich bestreitet. Damit kommt in der Postmoderne den Religionen der Schutz
abhanden, den sie in der Moderne gerade durch die Trennung von Staat und Kirche noch genossen
haben. In der Postmoderne wird von den Religionen verlangt, die Herrschaft des Profanen nicht nur
im Staat und in der Gesellschaft anzuerkennen, sondern zusätzlich auch noch in ihrem ureigensten
Bereich, nämlich in der Kirche selbst, möglichst sogar während des Gottesdienstes.
—————————————–