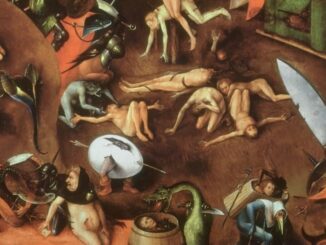Von Roberto de Mattei*
Die Wahl von Zohran Mamdani zum Bürgermeister von New York ist ein Ereignis von internationaler Bedeutung, das einige Überlegungen verdient.
Die Wahl eines Kandidaten der extremen Linken in der einflußreichsten Stadt der Vereinigten Staaten von Amerika bestätigt vor allem die Existenz einer tiefen Polarisierung innerhalb der USA. Die Ermordung von Charlie Kirk am 10. September hatte dies bereits deutlich gemacht. Tyler Robinson, der Mörder des jungen christlich-konservativen Anführers, stellt eine radikale Ausdrucksform jener ultra-progressiven amerikanischen Strömung dar, die die traditionelle gesellschaftliche Ordnung zutiefst verabscheut und bereit ist, auch Gewalt einzusetzen, um sie zu zerstören. Donald Trump, der selbst am 13. Juli des vergangenen Jahres nur knapp einem Anschlag entging, gilt in diesem Milieu als der Erzfeind.
New York steht zwar nicht repräsentativ für die gesamten USA, ist aber eine Schaufensterstadt für die Welt – und die Person, die sie heute führt, ist ein Linkssozialist und erklärter Gegner des US-Präsidenten. Mamdani präsentierte seinen Wahlsieg als direkte Herausforderung an Donald Trump und betonte, daß sein politischer Kampf nicht an den Stadtgrenzen endet. „New York wird die Vorhut des Widerstands sein“, erklärte er in seiner Rede als neuer Bürgermeister im Brooklyn Paramount, kurz nach seinem Wahlsieg.
Die Stadt New York sieht sich ernsthaften Problemen gegenüber: steigende Kriminalität, eine Krise auf dem Immobilienmarkt, marode Infrastruktur, niedrige Bildungsqualität und urbaner Verfall. Die von Mamdani vorgeschlagenen Rezepte, „mehr Aktivist als Verwalter“, wie die New York Post am 24. Oktober betonte, sind utopisch und könnten die Lage verschärfen. Seine Prioritäten scheinen ideologische Mobilisierung über pragmatisches Management zu stellen. So wird New York zur Plattform eines globalen Kampfes. Nicht zufällig verwendete Mamdani in einem Interview am 16. Juni 2025 den Ausdruck „Globalize the Intifada“, um die globale Dimension eines Konfliktes zu beschreiben, dessen Wurzeln im Nahen Osten liegen.
Mamdani ist der erste muslimische Bürgermeister New Yorks, von südasiatischer Herkunft, in Afrika geboren und erst seit wenigen Jahren amerikanischer Staatsbürger. Sein Vater, Mahmood Mamdani, ist Professor für Anthropologie an der Columbia University, seine Mutter, Mira Nair, eine bekannte Filmregisseurin. In Mamdanis Biographie und politischem Programm fließen somit zwei scheinbar gegensätzliche Identitäten zusammen: einerseits die „Woke“-Kultur – ein Produkt der linken US-Universitäten –, andererseits der zunehmende Faden des Islamismus, wie er in Europa unter muslimischen Einwanderern der zweiten und dritten Generation verbreitet ist. Von diesen beiden Welten feiert die eine Relativismus und Identitätsfluidität, die andere beruft sich auf das Gesetz der Scharia.
Das „woke“ Paradigma interpretiert den Westen als eine Machtstruktur, die systematisch dekonstruiert werden muß. In ihr sieht es die Quelle aller „Unterdrückung“: Kolonialismus, Patriarchat, Kapitalismus, Heteronormativität. Das Endziel ist nicht Reform, sondern die Auflösung von Identitäten, Grenzen und Traditionen.
Der politische Islamismus hingegen sieht den Westen in einer entgegengesetzt-spiegelbildlichen Perspektive: nicht als ungerechtes kulturelles Konstrukt, sondern als eine im Niedergang befindliche Zivilisation, geprägt von moralischem Verfall, erzwungener Säkularisierung und einer geopolitischen Expansion, die als aggressiv oder feindlich gegenüber der muslimischen Welt wahrgenommen wird.
Die politische Rhetorik Mamdanis bedient sich daher sowohl der islamistischen als auch der ultra-linken Diskursbestände, die die Welt in Unterdrücker und Unterdrückte einteilen und den Westen als moralisch delegitimiert betrachten. Wie die New York Post titelte: „Es ist keine Islamophobie, festzustellen, daß Mamdani den Westen haßt.“ Der Artikel beurteilt seine Ideen nicht, stellt jedoch seine Feindseligkeit gegenüber den Säulen der westlichen Kultur fest.
Die Konvergenz von radikalem Islamismus und „Woke“-Aktivismus beruht nicht auf einem konstruktiven Projekt, sondern auf einer im Kern negativen Koalition, die eher durch Ablehnung als durch eigene Vorschläge geprägt ist. In diesem Sinne kann die Strategie, Elemente islamistischer Ideologie mit Praktiken der ultra-linken Bewegungen zu verbinden, als „Anarcho-Islamismus“ bezeichnet werden.
Grundidee ist nicht, internationale Netzwerke mit Institutionen und Gesellschaft zu knüpfen, sondern radikale Protest- und Daueroppositionserfahrungen zu fördern, um ein Klima sozialer und kultureller Konfliktbereitschaft zu erzeugen, insbesondere in Großstädten, und die westliche Gesellschaft als „in der Krise“ erscheinen zu lassen. Der urbane Raum, in dem Spannungen am deutlichsten zutage treten, wird so zum bevorzugten Schauplatz des Handelns: Demonstrationen, die häufig in Gewalt umschlagen, Besetzungen, Gegen-Narrative in sozialen Medien. Dies ist die Logik der Revolution: Wenn die Wahrheit nicht länger als ordnendes Prinzip gilt, füllen ihre Leugner das Vakuum – wenn auch chaotisch und fragmentarisch.
New York war jahrzehntelang die Tribüne der liberal-demokratischen Weltkultur. Hier fanden die Vereinten Nationen ihren Sitz, hier wurden die fortschrittlichsten Formen kultureller Pluralität erprobt, hier wurde individuelle Freiheit – wirtschaftlich, politisch, künstlerisch – zum universellen Paradigma erhoben. Die Stadt verkörperte das, was Francis Fukuyama 1992 als „Ende der Geschichte“ bezeichnete: den Triumph der liberalen Demokratie als endgültiges Modell politischer Ordnung weltweit. Dieses Projekt ist gescheitert, und wir müssen dies zur Kenntnis nehmen.
Die Wahl von Zohran Mamdani ist nicht nur ein Wechsel in der Stadtverwaltung, sondern ein Beleg für die Selbstauflösung einer liberalen Kultur, die nicht nur unfähig war, die Feinde des Westens abzuwehren, sondern ihnen den Weg ebnet.
Der Westen kann sich nicht länger mit der modernen Zivilisation identifizieren, die aus der Französischen Revolution hervorging, sondern muß sich auf die christliche Zivilisation besinnen, deren Wurzeln im Mittelalter und in der griechisch-römischen Kultur liegen. Wir kämpfen darum, diese Zivilisation zu verteidigen, und Zohran Mamdani, der sie zerstören will, ist unser kultureller Gegner.
*Roberto de Mattei, Historiker, Vater von fünf Kindern, Professor für Neuere Geschichte und Geschichte des Christentums an der Europäischen Universität Rom, Vorsitzender der Stiftung Lepanto, Autor zahlreicher Bücher, zuletzt in deutscher Übersetzung: Verteidigung der Tradition: Die unüberwindbare Wahrheit Christi, mit einem Vorwort von Martin Mosebach, Altötting 2017, und Das Zweite Vatikanische Konzil. Eine bislang ungeschriebene Geschichte, 2. erw. Ausgabe, Bobingen 2011.
Bücher von Prof. Roberto de Mattei in deutscher Übersetzung und die Bücher von Martin Mosebach können Sie bei unserer Partnerbuchhandlung beziehen.
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Corrispondenza Romana