
Von Pater Paolo M. Siano*
Unter den Theologen, die dem Titel „Miterlöserin“ ablehnend gegenüberstehen, befindet sich der Dominikaner Pater Edward H. Schillebeeckx OP (1914–2009), Autor des Buches „Maria, Moeder van der Verlossing“, 1. Auflage 1954, 2. Auflage 1957. Diese wurde von Schillebeeckx selbst überarbeitet und 1969 als „Maria – Mutter der Glaubenden“ im Matthias-Grünewald-Verlag veröffentlicht. Das Imprimatur für die italienische Ausgabe stammt vom Priester Salvatore Famoso, Kanzler der Erzdiözese Catania, vom 22. Oktober 1964. Bereits im Vorwort (es ist nicht ganz klar, ob es von den Paulinern oder von Schillebeeckx stammt) erfolgt eine Distanzierung vom Titel „Miterlöserin“ (S. 7), da dieser in den offiziellen Konzilsdokumenten nicht vorkomme…
Tatsächlich jedoch, wie ich hier gezeigt habe, wird der Titel „Miterlöserin“ in den Konzilsakten – sowohl in der vorbereitenden als auch in der synodalen Phase des Konzils – als legitim und wahr anerkannt.
Später im Buch lehnt Schillebeeckx den Titel „Miterlöserin“ deutlich ab (S. 107).
In traditionell-katholischen Kreisen erkennt Msgr. Marcel Lefebvre (1905–1991) selbstverständlich an, daß die Madonna „wesentlich am Heil der Welt mitgewirkt hat“ und daß sie daher „Miterlöserin“ ist (Msgr. Marcel Lefebvre: Die priesterliche Heiligkeit, Sarto-Verlag, 2011) und „Spenderin aller Gnaden“ (S. 235).
Besonders interessant ist die Tatsache, daß selbst in nachkonziliaren theologischen und kirchlichen Kreisen – die keineswegs „traditionalistisch“ oder „konservativ“ sind – Autoren existieren, die den Marientitel „Miterlöserin“ in gewisser Weise anerkennen.
1968 veröffentlichten die Verlage Herder (Rom) und Morcelliana (Brescia) die italienische Ausgabe des „Lexikons der Theologie“ von Karl Rahner und Herbert Vorgrimler, in dem der Begriff „Miterlöserin“ zumindest toleriert wird – was in der nachkonziliaren theologischen Landschaft schon viel ist.
Wir lesen unter dem Stichwort „Miterlöserin“: „Ein Begriff der katholischen Theologie (Mariologie), der in seiner möglichen und genauen Bedeutung noch nicht klar definiert ist. Er soll die einzigartige und unwiederholbare Funktion ausdrücken, die Maria – unter dem Blickwinkel der Person und der Heilsgeschichte – innehatte: eine stets gültige und wirksame Funktion, die Maria am historischen Anfang des Erlösungswerkes, in dessen Vollendung durch den Erlöser Christus und in der Gemeinschaft der Heiligen innehatte“ (S. 145).
Unter dem Stichwort „Maria“ (S. 368–373) lesen wir: „Auch wenn Maria in der neueren Theologie als Miterlöserin bezeichnet wird, ist gleichzeitig klar, daß diese ihre Funktion qualitativ ganz anderer Art ist als die des Gottmenschen, Mittlers und Erlösers. In der Tatsache, daß die Schrift Maria (Joh. 19,25–27) als Frau schlechthin (zweite Eva und Mutter der Erlösten) unter dem Kreuz, unter dem Baum der Erlösung zeigt, kann man erkennen, wie die Funktion als Mutter des Heils, die ihr als Mutter Jesu zukommt, sich durch ihr ganzes Leben hindurch bis zur ‚Stunde‘ der Erlösung (Joh. 2,4) erstreckt“ (S. 368).
Im Gegensatz zu dem, was Rahner und Vorgrimler behaupten, ist der Titel „Miterlöserin“ in Wirklichkeit sehr wohl von Theologen und Päpsten erläutert worden. Es genügt, festzustellen, daß Rahner und Vorgrimler – ungeachtet ihrer minimalistischen und irreführenden Theorien oder Erklärungen – diesen Titel zumindest nicht ablehnen, auch wenn sie ihn als „Begriff“ oder „Funktion“ darstellen. Sie erkennen Maria die „Funktion“ einer „Miterlöserin“ zu (vgl. S. 368).
In dem Buch „Maria. Meditationen“ (Herder – Morcelliana, Rom-Brescia 1968–1970) nennt Karl Rahner Maria „die neue Eva“ und stellt fest, daß sie: „(…) wenn wir uns auf einen Punkt der Lehre beziehen, dessen Inhalt in der katholischen Theologie noch umstritten ist – auch ‚Miterlöserin‘ genannt wird“ (S. 14).
Bemerkenswert ist, daß Rahner – im Gegensatz zu Schillebeeckx – den Titel nicht bestreitet oder ablehnt, sondern ihn respektvoll erwähnt: Maria „wird auch ‚Miterlöserin‘ genannt“ (S. 14). Ungeachtet seiner Erklärungen hat Rahner kein Problem mit dem Titel „Miterlöserin“.
Rahner erkennt sogar den marianischen Titel „Mittlerin aller Gnaden“ an (S. 16), auch wenn er ihn leider auf reine Fürbitte reduziert (vgl. S. 14). Später im Buch bekräftigt Rahner, daß Maria „in der Gemeinschaft der Heiligen die Mittlerin für uns alle ist, die Mittlerin aller Gnaden“ (S. 120).
In dem Artikel „Marienverehrung und Emanzipation der Frau“, in La Civiltà Cattolica (Bd. II, 1970, S. 123–132), schreibt der belgische Jesuit P. Jean Galot SJ (1919–2008): „Miterlöserin: Dieser Titel bringt die Aufgabe Mariens gut zum Ausdruck, auch wenn er die Kritik einer Reihe von Theologen auf sich gezogen hat, die eine Gleichsetzung Mariens mit Jesus befürchteten. Doch drückt er keine solche Gleichheit aus, denn Christus ist der Erlöser und nicht der Miterlöser; vielmehr weist er auf die Mitarbeit am Erlösungswerk hin. In der Tat ist die ganze Kirche Miterlöserin, und jeder Christ ist Miterlöser. In seiner apostolischen Aufgabe zögerte der heilige Paulus nicht zu sagen: ‚Wir sind Mitarbeiter Gottes‘ (1 Kor 3,9). Maria ist Miterlöserin in einem besonderen, einzigartigen Sinn: als Frau, als neue Eva, die vom Vater mit dem erlösenden Opfer Christi und mit der messianischen Geburt verbunden wurde“ (S. 128).
Leider teilt P. Galot nicht die Marientitel „Mittlerin aller Gnaden“ und „Spenderin“ der Gnaden (vgl. S. 130).
1978 veröffentlichen die Edizioni Paoline die zweite Auflage (1. Auflage 1977) des Buches „Ein marianischer Monat. 31 kurze biblische Meditationen“ („Imprimatur: Bari 21.2.1977 Msgr. Francesco Colucci, Generalvikar“: S. 4) des Redemptoristen P. Bernhard Häring CSsR (1912–1998), der Maria „Miterlöserin“ nennt. Maria ist „die neue Eva“ (S. 31, 36), sie ist die „Mutter der Lebendigen“ (S. 36). „Maria, schlicht wie eine Taube, wird stets dem Wirken des Heiligen Geistes folgen, um ihre Rolle im Erlösungswerk zu erfüllen“ (S. 67).
Hier das für uns zentrale Zitat: „Das Leiden Christi ist in sich vollkommen und bedarf keiner Ergänzung, aber die erlösende Kraft seines Leidens und Sterbens ist so groß, daß die neue Eva daran aktiv teilnehmen konnte. Wir können sie daher ‚Miterlöserin‘ nennen, ohne Christus, den einzigen Erlöser und Mittler, zu schmälern – im Gegenteil, wir preisen ihn damit“ (S. 105).
Im Kommentar zu den Worten Jesu „Siehe, deine Mutter“ schreibt P. Häring über Maria:
„[…] an alle ist also dieses Wort gerichtet: ‚Siehe, deine Mutter!‘ Vor uns steht die Frau, die neue Eva, die Mutter der Lebendigen, das große Zeichen der Apokalypse. Lieben wir diese Mutter, denn sie hat uns unter den Schmerzen am Kreuz des Lebensspenders geboren! […] Sie ist die Mutter der Kirche“ (S. 110).
Auch in nachkonziliaren franziskanischen Kreisen gibt es weiterhin Stimmen, die für die Miterlösung eintreten.
1966 veröffentlichte der Verlag „Crociata del Vangelo“ in Palermo das Buch „Der Primat Christi bei Paulus und Duns Scotus“ von P. Gabriele Allegra OFM (1907–1976; 2012 von Benedikt XVI. seliggesprochen). Ich beziehe mich auf die 2011 bei Edizioni Porziuncola in Assisi erschienene Ausgabe.
P. Allegra schreibt: „Mir scheint, daß aus dem Licht dieser Lehre – dem Christozentrismus und der Erlösung aus reiner Liebe – logisch die Unbefleckte Empfängnis Mariens und der Wert ihres mitleidenden Mitwirkens als Miterlöserin folgt“ (G. Allegra ofm, Deviazioni dottrinali e morali (cause e rimedi), Konvent S. Biagio, Acireale (CT) 1993, S. 70).
In dem Heft „Peregrinantibus et itinerantibus“, zwischen Macao und Hongkong 1970 geschrieben, bekräftigt P. Allegra – trotz des aufkommenden und arroganten theologischen Progressismus nach dem Konzil – die Lehre von: „der universalen Mittlerschaft und der Miterlösung der Madonna, […] dem Rosenkranzgebet und […] der Weihe an ihr Unbeflecktes Herz sowie anderen Formen marianischer Frömmigkeit, die für die adoptierten Kinder eine Quelle tiefer übernatürlicher Freude und Kraft darstellen“ (ebd., S. 112).
Auch in der Zeitschrift Miles Immaculatae der Milizia Maria Immacolata, die damals von Minoriten geleitet wurde, finden sich Verfechter des Titels „Miterlöserin“.
Ich zitiere einige Artikel: In Miles Immaculatae, Jahr II, Heft 3, 1966, im Artikel „Orientierung der Mariologie nach dem Konzil“ (S. 308–314), erkennt P. Leone Veuthey OFMConv (1896–1974) der Allerheiligsten Maria „ihre unersetzliche Funktion als universale Mittlerin und höchste Miterlöserin“ zu (S. 313).
Indem er die göttliche Mutterschaft Mariens – ein zentrales Thema der thomistischen Mariologie – als Grundlage der nachkonziliaren Mariologie nimmt, schreibt P. Veuthey: „Maria ist nicht Mutter, weil sie Wohltäterin ist, sondern sie ist Wohltäterin, weil sie Mutter ist; sie ist nicht Mutter, weil sie Mittlerin und Miterlöserin ist, sondern sie ist Mittlerin und Miterlöserin, weil sie Mutter ist“ (S. 311). Jedenfalls erkennt auch er Maria als „Miterlöserin“ an.
In Miles Immaculatae, Jahr VI, Heft 1, 1970, im Artikel „Der marianische Auftrag des Franziskaners“ (S. 41–49), schreibt P. Orlando Todisco über die Allerheiligste Maria: „Als Miterlöserin bot sie das große Lösegeld dar – ihren Sohn –, als starke und barmherzige Frau, als Christus am Kreuz den Geist aufgab, um jede Schuld zu tilgen, um uns zu reinigen und zu erlösen…“ (S. 46).
In Miles Immaculatae, Jahr VII, Heft 3–4, Juli–Dezember 1971, im Artikel „Im Verzeichnis der Seligen“ (S. 289–334), über die Seligsprechung von P. Maximilian Kolbe, teilt P. Antonio Blasucci OFMConv (1911–1987) den Marientitel „Miterlöserin“ (S. 309).
In Miles Immaculatae, Jahr VIII, Heft 3–4, 1972, im Artikel „Don Giacomo Alberione und die Madonna“ (S. 255–257), erinnert P. Antonio Blasucci OFMConv daran, daß auch der Gründer der Paulusfamilie die Madonna als „universale Mittlerin der Gnade“ und „die Miterlöserin mit Christus, dem Erlöser“ (S. 256) bezeichnet hat.
In Miles Immaculatae, Jahr X, Heft 3–4, Juli–Dezember 1974, in der Rubrik „Marianische Lehre“, finden wir den Artikel „Das Geheimnis des Heils und Maria. ‘Mater Salvatoris’“ (S. 211–231) von P. Gabriele M. Roschini OSM, der bekräftigt, daß Maria „wahre und eigentliche Miterlöserin des Menschengeschlechts“ sei (S. 215).
„[…] Das ordentliche Lehramt kann daher als sehr klar hinsichtlich der unmittelbaren Mitwirkung Mariens an der Erlösung bezeichnet werden“ (S. 217), „Maria Miterlöserin“ (S. 218). Die „Erlösung des Menschengeschlechts“ ist „unmittelbares und gleichzeitiges Ergebnis des gemeinsamen Wirkens des Erlösers und seiner Mutter, der Miterlöserin“ (S. 220).
In Miles Immaculatae, Jahr XII, Heft 1–2, 1976, im Artikel „Professor Enrico Medi im Licht Mariens“ (S. 107–114), zitiert P. Sebastiano Botticella OFMConv Auszüge, in denen der bekannte italienische Physiker, Politiker und Akademiker Enrico Medi (1911–1974) in einem Buch von 1973 schreibt: „Maria hat ihren Sohn Jesus als Opfer für die Erlösung der Menschen von der Sünde dargebracht; Jesus, der Erlöser, gibt der Miterlöserin die ganze Menschheit zurück und macht sie zur Mutter aller Geschöpfe – sie, die Mutter Gottes. […] Siehe da, die universale Mittlerin“ (S. 110).
In Miles Immaculatae, Jahr XIII, Heft 1–2, Januar–Juni 1977, im Artikel „Der Titel ‚Maria Mutter der Kirche‘“ (S. 19–36), zitiert Don Domenico Bertetto SDB zustimmend den Dominikaner P. Philipon, der über Maria am Kalvarienberg schreibt: Mit ihrem „miterlösenden Mit-Leiden“ (S. 22) vollendete sie ihre Zustimmung zur „Mutterschaft über den ganzen Christus“ (S. 22). Bertetto befürwortet die „Miterlösung“ (S. 30), das heißt: „die heilbringende Verbindung mit dem Opfer Christi auf Golgotha (vgl. Lumen gentium 58), zu der Maria von Gott bestimmt wurde, gerade um – in untergeordneter Einheit mit dem neuen Adam – Quelle von Vergebung, Leben und Heil für die ganze Menschheit zu sein“ (S. 30).
„Die geistige Mutterschaft Mariens entspringt der göttlichen Mutterschaft und der Miterlösung auf Golgotha, verstanden im Licht der Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils, und ist daher der Mutterschaft gegenüber der Kirche vorausgehend; sie erstreckt sich auch auf die Kirche selbst, der sie ihren Ursprung gibt – abhängig von Christus“ (S. 32).
1971 veröffentlichten die Edizioni Dehoniane in Neapel das Buch „Das Geheimnis Mariens“ des Passionisten P. Candido Amantini CP (1914–1992), bekannter Exorzist in Rom an der Heiligen Stiege von 1961 bis 1992. Ich zitiere die zweite Auflage, herausgegeben von den Edizioni Scala Santa (Rom 2018). Im Kapitel „Maria, Miterlöserin der Menschen“ (S. 191–225) schreibt der Diener Gottes P. Amantini, daß Maria durch ihre Teilnahme am Opfer ihres Sohnes am Kreuz „sich den glorreichen Titel Miterlöserin der Menschen verdient hat“ (S. 191).
Weiter schreibt er: „Durch das blutige Opfer des Kreuzes, an dem die Allerheiligste Jungfrau in großem Maß teilnahm, wurde die Erlösung des Menschen im absoluten Sinn vollzogen – und das unterscheidet sie tiefgreifend, wie festgestellt wurde, vom Opfer am Altar, an dem die Kirche teilnimmt. Deshalb hat die Jungfrau vollen Anspruch auf den Titel ‚Miterlöserin‘, der ihr ausdrücklich oder sinngemäß von vielen und bedeutenden Autoritäten verliehen wurde“ (S. 203).
Sehr interessant ist auch das Zeugnis des Priesters Don Nicola Canzona († 1996), Pfarrer von Castelpetroso (Isernia, Italien) und von 1968 bis 1978 sowie von 1983 bis 1986 am Heiligtum der Schmerzhaften Muttergottes von Castelpetroso tätig.
Don Canzona berichtete, daß Msgr. Alberto Carinci [Erzbischof von Boiano-Campobasso von 1948 bis 1977; seit 1982 trägt das Erzbistum den heutigen Namen Campobasso-Boiano] bei einer Audienz zusammen mit seinem Klerus Papst Paul VI. das Bild der Madonna von Castelpetroso zeigte. Der Papst betrachtete es und rief spontan aus: „Aber das ist ja das Bild der Miterlöserin!“ (vgl. „Don Nicola… im Paradies“, in: Corredemptrix. Annali Mariani 1996, Heiligtum der Schmerzhaften Muttergottes, Castelpetroso (IS) 1997, S. 306; vgl. auch P. Alessandro M. Apollonio, „‚Das ist das Bild der Miterlöserin‘ (Paul VI.)“, in: Corredemptrix. Annali Mariani 2004, Castelpetroso 2005, S. 164).
Die zitierten Texte nennen kein genaues Datum für diese Audienz. Ich vermute, sie fand in den frühen 1970er Jahren statt, da Paul VI. 1973 die Schmerzvolle Madonna von Castelpetroso zur Patronin von Molise ernannte.
Somit hat – dieser Zeugenaussage zufolge – auch Papst Paul VI., wenn auch nicht in offiziellen Dokumenten, die Madonna als „die Miterlöserin!“ bezeichnet.
Was jedoch mit Sicherheit und Unwiderlegbarkeit feststeht, ist, daß kurz nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, unter dem Pontifikat von Papst Paul VI., der Titel „Miterlöserin“ – zumindest einmal – in der Zeitung des Papstes und des Vatikans erschien.
In L’Osservatore Romano vom Samstag, dem 15. Januar 1966, auf Seite 5, findet sich eine Kurzmeldung mit dem Titel „Tabor“: Es wird über die neueste Ausgabe der Zeitschrift für spirituelles Leben „Tabor“ berichtet, in der unter anderem über „Maria Santissima und die Eucharistie“, „die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel und den universalen Konsens der Kirche“, „Maria und die Kirche“ gesprochen wird.
Außerdem „Msgr. Vincenzo Faraoni stellt den Lesern einen weiteren Aspekt der Mariologie vor: ‚Maria, Mittlerin aller Gnaden‘ – ein tröstlicher Aspekt, begründet und gestützt durch die Tradition, die Maria zur Miterlöserin der Menschheit macht“ (S. 5).
Für biografische Hinweise zu Msgr. Vincenzo Faraoni (1919–1974), seit 1969 Consultor der römischen Kongregation für den Klerus.
*Pater Paolo Maria Siano gehört dem Orden der Franziskaner der Immakulata (FFI) an; der promovierte Kirchenhistoriker gilt als einer der besten katholischen Kenner der Freimaurerei, der er mehrere Standardwerke und zahlreiche Aufsätze gewidmet hat. In zahlreichen seiner Veröffentlichungen geht es ihm darum, den Nachweis zu erbringen, daß die Freimaurerei von Anfang an esoterische und gnostische Elemente enthielt, die bis heute ihre Unvereinbarkeit mit der kirchlichen Glaubenslehre begründen.
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Corrispondenza Romana
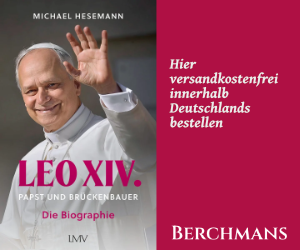



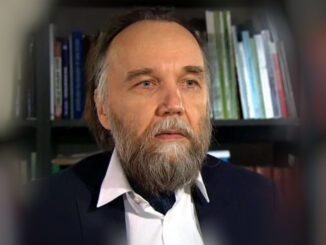
Hinterlasse jetzt einen Kommentar