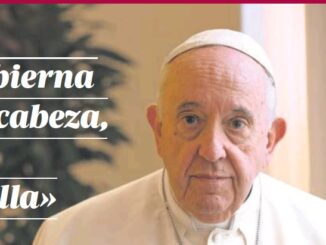Von Cristina Siccardi*
Der Märtyrertod gehört zum Wesen des Christentums. Der erste, der das Martyrium erlitt, war der Sohn Gottes, wahrer Gott und wahrer Mensch, der zur Erlösung der Seelen gefoltert und gekreuzigt wurde. Die Verfolgung der Christen und ihr Martyrium begannen im Jahr 36 mit dem heiligen Stephanus (dem ersten Märtyrer unter den Menschen). Im Lauf der Jahrhunderte und Jahrtausende – so wie auch heute noch – reißt der gewaltsame Strom in odium fidei (aus Haß gegen den Glauben) nicht ab. Gleichzeitig setzt die Heilige Römische Kirche ihre Aufgabe fort, Zeugen des Glaubens an Christus selig- und heiligzusprechen. Der jüngste unter ihnen ist der Maristenbruder Lycarion May, der am 12. Juli dieses Jahres in der Pfarrei San Francesco di Sales in Barcelona seliggesprochen wurde. Die Feier wurde von Kardinal Marcello Semeraro, Präfekt des Dikasteriums für die Selig- und Heiligsprechungen, geleitet.
François Benjamin May – so sein bürgerlicher Name – wurde am 21. Juli 1870 in Champsec im Walliser Val de Bagnes in der Schweiz geboren und drei Tage später getauft. In seiner tief katholisch geprägten Familie keimte seine religiöse Berufung früh auf. Bereits mit 18 Jahren trat er in das Institut der Maristenbrüder ein. Am Fest Mariä Himmelfahrt im Jahr 1888 erhielt er den Ordensnamen Lycarion. Am 15. August 1893 legte er seine ewige Profeß ab und wurde in die Gemeinschaft von Girona versetzt, wo er seine erzieherische Mission an der ersten von den Maristenbrüdern in Spanien geleiteten Schule begann.
Als Leiter einer Kindertagesstätte im Baskenland wurde er später nach Barcelona zurückgerufen, um dort die Schule Patronato Obrero de San José im bevölkerungsreichen und armen Stadtviertel Pueblo Nuevo zu gründen und zu leiten. In demselben Viertel existierte die Bewegung der radikal-republikanischen Jugend „Jóvenes Bárbaros“ („Junge Barbaren“), aus deren Umfeld als Gegengewicht zur maristischen Bildungsarbeit die antiklerikale Escuela Moderna (Moderne Schule) hervorging.
In der letzten Juliwoche des Jahres 1909 brach in Barcelona ein Volksaufstand aus, der als die „Tragische Woche“ in die Geschichte einging. Arbeiter der Stadt und aus ganz Katalonien protestierten gewaltsam gegen das Militär – unterstützt von Anarchisten, Kommunisten und Republikanern. Auslöser des Aufstands war die vom spanischen Staat angeordnete Zwangsrekrutierung von Reservisten für den Kolonialkrieg in Marokko. Es kam zu Gewalttaten, Plünderungen, Kirchenbränden und Verwüstungen von Klöstern und katholischen Schulen. In der Nacht vom 26. auf den 27. Juli 1909 wurde das Schulgebäude der Maristenbrüder in Brand gesteckt. Am Morgen des 27. wurden die Ordensleute durch eine List aus dem Haus gelockt. Kaum waren sie auf die Straße getreten, wurden sie erschossen. Bruder Lycarion, der sich mit großer väterlicher Hingabe der christlichen Erziehung der Kinder widmete, war der erste, der getötet wurde. Sein Leichnam, durch Steine und Macheten entstellt, wurde später geborgen und in einem Massengrab auf dem Friedhof von Montjuïc beigesetzt.
Laut dem Bericht der World Watch List 2024 werden heute weltweit rund 365 Millionen Christen in unterschiedlicher Weise verfolgt, vor allem in Afrika und Asien. Historiker schätzen, daß im Lauf der Geschichte etwa siebzig Millionen Christen wegen ihres Glaubens getötet wurden – davon allein 45 Millionen im 20. Jahrhundert, dem Jahrhundert nach Aufklärung, Französischer Revolution und dem liberal-positivistischen 19. Jahrhundert. Die Treue zum katholischen Glauben war auch Auslöser des bewaffneten Aufstands in der französischen Region Vendée im Jahr 1793, der nach Jahren erbitterter Kämpfe von der jakobinischen Armee mit grausamer Härte niedergeschlagen wurde – ein Völkermord, der als erster der Moderne gilt und etwa 117.000 Opfer forderte.
Antiklerikales und freimaurerisches Gedankengut hat sich nach und nach viele Staaten einverleibt, auch außerhalb Europas – so etwa in Mexiko, wo die politische Führung versuchte, die katholische Tradition des Landes systematisch zu zerstören. 1926 regte sich als Antwort der bewaffnete Volksaufstand der Cristiada, dem sich rund 50.000 Männer anschlossen. Auch dieser wurde brutal niedergeschlagen. Der Nationalsozialismus und der Kommunismus führten die Ära brutaler Christenverfolgung fort. In der Sowjetunion erzeugte der staatlich verordnete Atheismus die sogenannte „Kirche des Schweigens“, deren unzählige Opfer in Russland und den Satellitenstaaten im Namen Christi ihr Leben ließen.
Papst Pius XI. bezeichnete 1937 in seiner Enzyklika Divini Redemptoris den Kommunismus als eine „satanische Geißel“, die „darauf abzielt, die gesellschaftliche Ordnung umzustürzen und die Fundamente der christlichen Zivilisation zu zerstören“, wodurch eine Barbarei entstehe, „schlimmer als jene, in der sich die Welt noch befand, als der Erlöser erschien“. Aus diesem Grund wurde der Kommunismus mit dem Kirchenbann belegt. Doch auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil wurde der kommunistische Gedanke mit keinem Wort verurteilt… und so konnte sich dieses antichristliche Denken auch in Europa ausbreiten, wo es heute die Wurzeln des Christentums mißachtet und entweiht.
Die Verfolgungen unserer Zeit gehen mit unerbittlicher Härte weiter. Laut der Tageszeitung Avvenire vom 28. Januar 2011 sind Christen Opfer von 75 % aller religiös motivierten Gewaltakte weltweit. Thomas Schirrmacher von der International Society for Human Rights schätzt, daß jedes Jahr etwa 7.000 bis 8.000 Christen als Märtyrer sterben. Die World Watch List der Organisation Open Doors stellte für das Jahr 2015 fest, daß Nordkorea, der Irak und Eritrea die drei Länder mit der schwersten Christenverfolgung waren – mehr als 7.100 Christen wurden im selben Jahr wegen ihres Glaubens getötet (im Vergleich zu 4.344 im Jahr 2014). Heute geschehen Christenverfolgungen weltweit – durch islamistische oder kommunistische Regime ebenso wie durch fundamentalistische islamische oder hinduistische Gruppen, durch staatliche Repression oder durch gezielte Anschläge auf Kirchen. Auch in buddhistisch geprägten Ländern werden Christen diskriminiert und attackiert.
Ein Bericht des Observatoriums für Intoleranz und Diskriminierung gegenüber Christen in Europa, einer in Wien ansässigen NGO, zeigt, daß auch auf unserem Kontinent die Fälle von Intoleranz und Diskriminierung gegen Christen zunehmen. Kürzlich wurde in Damaskus eine griechisch-orthodoxe Kirche angegriffen – 25 Menschen starben, 63 wurden verletzt. In Nigeria, im Bundesstaat Benue, wurden rund 200 Christen von Dschihadisten ermordet. Am 25. Juni erklärte Papst Leo XIV. am Ende der Generalaudienz auf dem Petersplatz:
„Am vergangenen Sonntag wurde ein feiger Terroranschlag auf die griechisch-orthodoxe Gemeinde in der Kirche Mar Elias in Damaskus verübt. Wir empfehlen die Opfer der Barmherzigkeit Gottes und beten für die Verletzten und ihre Familien. Den Christen im Nahen Osten sage ich: Ich bin euch nahe! Die ganze Kirche ist euch nahe!“
In seiner Ansprache an die Teilnehmer der Vollversammlung der Riunione delle Opere per l’Aiuto alle Chiese Orientali (Zusammenschluß der Hilfswerke für die Ostkirchen) am 26. Juni in der Sala Clementina fragte und antwortete der Papst:
„[…] Ich frage mich: Was können wir als Christen – neben unserer Empörung, dem Erheben unserer Stimme und unserem tatkräftigen Einsatz für den Frieden und den Dialog – wirklich tun? Ich glaube, das erste ist: beten. Wir müssen jede schreckliche Nachricht, jedes Bild, das uns erschüttert, in einen Schrei der Fürbitte zu Gott verwandeln. Dann: helfen – wie ihr es tut und wie viele durch euch helfen können. Aber es gibt noch mehr, besonders im Blick auf den christlichen Osten: das Zeugnis. Es ist der Ruf, Jesus treu zu bleiben, ohne uns in den Tentakeln der Macht zu verfangen. Es heißt, Christus nachzuahmen, der das Böse am Kreuz durch Liebe besiegt hat – mit einer Herrschaft, die ganz anders ist als die von Herodes und Pilatus: Der eine ließ aus Angst vor Machtverlust Kinder ermorden – wie auch heute noch Kinder durch Bomben zerrissen werden; der andere [Pilatus] wusch sich die Hände – so wie auch wir heute Gefahr laufen, uns täglich die Hände zu waschen, bis wir an die Schwelle des Unumkehrbaren gelangen.
Schauen wir auf Jesus, der uns aufruft, die Wunden der Geschichte einzig mit der Sanftmut seines glorreichen Kreuzes zu heilen – aus dem die Kraft der Vergebung, die Hoffnung auf einen Neuanfang und die Pflicht zur Ehrlichkeit und Transparenz in einem Meer aus Korruption hervorgehen. Folgen wir Christus, der die Herzen vom Haß befreit hat, und geben wir ein Beispiel dafür, wie man die Spiralen von Spaltung und Vergeltung durchbrechen kann.
Ich möchte allen Christen des Orients danken und sie sinnbildlich umarmen, die dem Bösen mit dem Guten begegnen: Danke, Brüder und Schwestern, für das Zeugnis, das ihr gebt – besonders dann, wenn ihr in euren Heimatländern bleibt, als Jünger und als Zeugen Christi.“
*Cristina Siccardi, Historikerin und Publizistin, zu ihren jüngsten Buchpublikationen gehören „L’inverno della Chiesa dopo il Concilio Vaticano II“ (Der Winter der Kirche nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Veränderungen und Ursachen, 2013); „San Pio X“ („Der heilige Pius X. Das Leben des Papstes, der die Kirche geordnet und erneuert hat“, 2014), „San Francesco“ („Heiliger Franziskus. Eine der am meisten verzerrten Gestalten der Geschichte“, 2019), „Quella messa così martoriata e perseguitata, eppur così viva!“ „Diese so geschlagene und verfolgte und dennoch so lebendige Messe“ zusammen mit P. Davide Pagliarani, 2021), „Santa Chiara senza filtri“ („Die heilige Klara ungefiltert. Ihre Worte, ihre Handlungen, ihr Blick“, 2024),
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Corrispondenza Romana