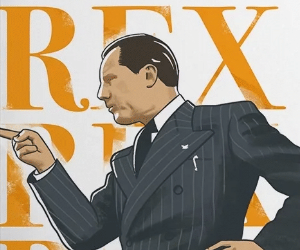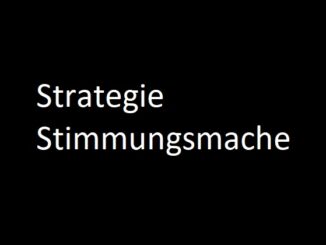(Rom) Am 9./10. September fand in Assisi, im Schatten der Basilika Santa Maria degli Angeli mit der Portiunkula-Kapelle, in der der heilige Franziskus starb, die Tagung „Le Tavole di Assisi“ zur Wiederbelebung des christlichen, konservativen und identitären Denkens statt. Erzbischof Giampaolo Crepaldi, ein herausragender Vertreter der katholischen Soziallehre und emeritierter Bischof von Triest, hielt das bemerkenswerte Einführungsreferat.
Organisiert wurde die Tagung vom International Observatory Cardinal Van Thuan for the Social Doctrine of the Church (Internationale Beobachtungsstelle Kardinal Van Thuan für die Soziallehre der Kirche). Es ist nach dem vietnamesischen Kardinal François Xavier Nguyên Van Thuân benannt, der von 1967 bis 1975 Bischof von Nha Trang war. 1975, als die Kommunisten nach dem katastrophalen Vietnamkrieg der USA auch in Südvietnam die Macht übernahmen, ernannte ihn Papst Paul VI. zum Erzbischofkoadjutor von Saigon, das von den neuen Machthabern in Ho-Chi-Min-Stadt umbenannt wurde. Zwei Tage nach seiner Ernennung wurde er verhaftet und dreizehn Jahr lang eingesperrt, davon neun Jahre in Einzelhaft. 1988 gelang durch diplomatischen Einsatz seine Freilassung, die mit seiner Exilierung gekoppelt wurde. Bis zu seinem Tod 2002 galt er als „lebender Märtyrer“. Unter Papst Johannes Paul II. wurde der ausgewiesene Fachmann für die kirchliche Soziallehre 1994 zum stellvertretenden Vorsitzenden und von 1998 bis zu seinem Tod zum Vorsitzenden des Päpstlichen Rats für Gerechtigkeit und Frieden (Iustitia et Pax). 2010 wurde sein Seligsprechungsverfahren eingeleitet.
Erzbischof Crepaldi war ab 1994 Untersekretär und ab 2001 Sekretär dieses Päpstliches Rates. Im Jahr nach Van Thuans Tod gründete er das International Observatory for the Social Doctrine of the Church, das er nach dem von ihm so geschätzten Kardinal benannte und als Gründungsvorsitzender leitete. Als Direktor konnte mit dem politischen Philosophen Stefano Fontana ein weiterer herausragender Vertreter der katholischen Soziallehre gewonnen werden.
2009 ernannte Papst Benedikt XVI. Msgr. Crepaldi zum Bischof von Triest und verlieh ihm zum Zeichen seiner besonderen Wertschätzung ad personam den Rang eines Erzbischofs. 2022 gab Msgr. Crepaldi den Vorsitz des Observatory ab.
Weniger Wohlwollen signalisierte Papst Franziskus, der den Erzbischof im vergangenen Februar, kurz nach Vollendung seines 75. Lebensjahres, als Bischof von Triest emeritierte.

Hier nun einige wichtige Auszüge aus dem Einführungsreferat von Erzbischof Crepaldi bei der Tagung „Le Tavole di Assisi“ vom 9. September:
I
Wir müssen die Überzeugung wiedererlangen, daß das Christentum und die Kirche direkt in das gesellschaftliche Leben eingreifen, nicht um andere eindeutige und legitime Zuständigkeiten zu ersetzen, sondern um das gesamte öffentliche Leben auf seinen wahren, letzten Zweck auszurichten, nämlich den transzendenten. Wir müssen die Idee wiedergewinnen, die uns auch Benedikt XVI. gelehrt hat, daß das Quaerere Deum [Gott suchen] direkte soziale Konsequenzen hat, da es nicht möglich ist, den unkultivierten Boden des gesellschaftlichen Lebens zu bebauen, ohne zuvor unsere Seelen bebaut zu haben. Da ich mich ein Leben lang für die Soziallehre der Kirche interessiere, möchte ich sagen, daß ohne diese Voraussetzung selbst der Reichtum der Soziallehre vernachlässigt wird. Wenn dieses Erbe heute in Schwierigkeiten steckt, wie es mir scheint, liegt der tiefere Grund im Glauben und auch in der Vernunft, aber vor allem im Glauben. Wir geben zu viel dem Naturalismus nach und denken, daß die Welt nicht den Christus des Glaubens, sondern möglicherweise nur den Christus der Vernunft braucht, um dann schrittweise auch von dieser Ebene herabzusteigen und zum Christus der globalistischen Ethik und damit zum Christus des individuellen Gewissens zu gelangen. Mit diesem Ergebnis endet die Diskussion über das Christentum in der Gesellschaft. Ich bin der Überzeugung: Entweder haben das Christentum und die Kirche im öffentlichen Raum etwas Eigenes und Einzigartiges zu sagen, oder was sie sagen, löst sich zu einer der vielen Meinungen auf, die im täglichen Lärm geäußert werden, der zu Unrecht als „öffentliche Debatte“ bezeichnet wird.
II
Wenn das Christentum und die Kirche im öffentlichen Raum etwas Eigenes und Einzigartiges zu sagen haben, folgt daraus, daß Katholiken nicht mit allen zusammenarbeiten können, weil sie nicht beliebig für alles eintreten können. Benedikt XVI. schrieb: „Christus heißt alle willkommen, aber nicht alles.“ Dieses „alles“ muß im Lichte dessen geprüft werden, was die Kirche als Eigenes und Einzigartiges auf dem öffentlichen Platz zu sagen hat. Ich bin mir bewußt, daß ich einen heiklen und kontroversen Aspekt in der heutigen Kirche hervorhebe… Es reicht nicht aus, sich in der Umweltfrage nominell einig zu sein, um mit allen zusammenzuarbeiten, die sich damit befassen und sich dafür engagieren. Es ist auch nicht vernünftig anzunehmen, daß der Sinn der Zusammenarbeit während des Weges der Zusammenarbeit entstehen werde, denn das würde bedeuten, das zu leugnen, was ich oben gesagt habe, nämlich daß die Kirche ihr eigenes, einzigartiges Wort zur sozialen Frage zu sagen hat. Negativ fällt einem zum Beispiel auf, wie viele katholische Realitäten sich heute die UNO-Agenda 2030 zu eigen machen.
III
Ich nehme diese letzten Überlegungen als Anregung, um eine weitere Bewertung zu einem Thema vorzuschlagen, das ich „katholischen Agnostizismus“ nennen würde. Wenn wir zum Beispiel den Bereich der Moral nehmen, sehen wir heute die Neigung, zu sagen, daß der Intellekt nicht beanspruchen kann, mit seinem eigenen Licht die „Form“ einer Handlung zu sehen, genausowenig wie er die „Form“ der Dinge sehen kann. Die Vernachlässigung der Lehren von Fides et ratio und Veritatis splendor hat ziemlich negative Folgen. Was beispielsweise die konkrete Form des Ehebruchs ist, ist heute tendenziell nicht mehr klar, und auch die Frage nach der sicheren Erkennbarkeit (negativer) moralischer Absolutheiten wird nicht mehr als wichtig erachtet. Es wird angenommen, daß diese kognitiven Kategorien abstrakt seien und uns daran hindern würden, die Erfahrungen der Menschen zu erfassen…
IV
Nominalismus und Agnostizismus sind heute unter Katholiken und Kirchenmännern sehr präsent, manchmal ohne das nötige Bewußtsein, und machen sie offen für Abenteuer, auch die seltsamsten. Es unterstreicht auch eine gewisse „Verflüssigung“ des Katholischseins in der Gesellschaft in einem vielleicht hektischen, aber unproduktiven Aktivismus. Der „katholische Agnostizismus“ ist der eigentliche Grund, daß die „nicht verhandelbaren Werte“ vergessen werden, von denen Benedikt XVI. zu uns gesprochen hat, ein Vergessen, das die Politik verabsolutiert, indem ihr alles erlaubt wird und sie gleichzeitig entwertet, weil es sie blind macht. Die Politik darf alles tun, aber blindlings. Der Schaden, der durch das Vergessen nicht verhandelbarer Werte entsteht, ist überaus groß, denn einer derart reduzierten Politik hat die Soziallehre der Kirche nichts Wesentliches mehr zu sagen.
V
Mein Eindruck als Bischof und als Beobachter, oder besser: als beobachtender Bischof, ist, daß sich der Kreis schließt und die Freiheitsräume für die Katholiken immer enger werden, bis sie verschwinden. Indem die Säkularisierung mit großen Schritten voranschreitet, unterstützt in ihren zerstörerischen Auswirkungen durch die neue Globalisierung des aufgeklärten Nihilismus, wird der Manipel der Katholiken kleiner, die sich ausdrücklich und uneingeschränkt im Licht der kirchlichen Soziallehre, die als Verkündigung Christi in den zeitlichen Realitäten und nicht als simpler, vage solidarischer und brüderlicher Humanismus zu verstehen ist, für die soziale Frage einsetzen. Wir stehen vor einer sehr kohärenten operativen Konvergenz vieler Machtzentren. Kein Bereich bleibt ausgenommen.
VI
An diesem Punkt stellt sich die ernste Frage: Passen sich die Katholiken, Laien und Kirchenmänner, diesem kohärenten und geschlossenen Druck an, der die Zerstörung der Natur und des Übernatürlichen anstrebt, oder versuchen sie, sich ihm zu widersetzen? Um dagegen vorzugehen, braucht es Ideen, aber auch Hände, womit wir wieder bei dem wären, was oben schon mehrfach gesagt wurde: Das Christentum und die Kirche haben der Welt etwas Eigenes und Einzigartiges zu sagen. Wenn sie es nicht tun oder wenn sie es nicht so tun, wie sie es tun sollten, werden sie nicht neutral in einer Welt für sich bleiben, sondern von anderen Ideen durchdrungen werden, die mit ihren eigenen nichts zu tun haben.
Einleitung/Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: MiL/Vanthuanobservatory.com (Screenshot)