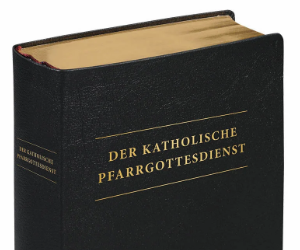Von Roberto de Mattei*
Ein geheimnisvoller Schleier umgibt das Coronavirus, oder Covid-19, von dem wir weder den Ursprung noch die wirklichen Verbreitungsraten oder mögliche Folgen kennen. Was wir jedoch wissen, ist, daß Pandemien in der Geschichte immer als Geißeln Gottes gesehen wurden und daß das einzige Mittel, das die Kirche ihnen entgegengesetzt hat, Gebet und Buße war.
So war es in Rom im Jahr 590, als Gregor aus der Senatorenfamilie der gens Anicia mit dem Namen Gregor I. (540–604) zum Papst gewählt wurde.
Italien wurde von Krankheit, Hunger und sozialen Unruhen heimgesucht und von den eindringenden Langobarden verheert. Zwischen 589 und 590 verbreitete eine aggressive Pestepidemie, die schreckliche Lues Inguinaria, Schrecken und Tod auf der Halbinsel und in der Stadt Rom, nachdem sie bereits das Gebiet von Byzanz im Osten und das der Franken im Westen verwüstet hatte. Die Bürger Roms interpretierten diese Epidemie als Strafe Gottes für die Verdorbenheit der Stadt.
Das erste Opfer, das in Rom von der Pest dahingerafft wurde, war Papst Pelagius II., der am 5. Februar 590 starb und in Sankt Peter begraben wurde. Der Klerus und der römische Senat wählten Gregor zu seinem Nachfolger, der, nachdem er das Amt des Praefectus urbi ausgeübt hatte, in seiner Mönchszelle auf dem Caelius, einem der sieben Hügel, lebte. Nachdem der neue Papst am 3. Oktober 590 geweiht worden war, sah er sich sofort der Geißel der Pest gegenüber. Gregor von Tours (538–594), der Zeitgenosse und Chronist dieser Ereignisse, sagt, daß Gregor in einer denkwürdigen Predigt in der Basilika Santa Sabina auf dem Aventin die Römer aufforderte, zerknirscht und reuig dem Beispiel der Einwohner Ninives zu folgen:
„Schaut Euch um: Hier ist das Schwert des Gotteszorns, das über dem ganzen Volk geschwungen wird. Der plötzliche Tod entreißt uns der Welt, fast ohne uns eine Minute Zeit zu geben. In diesem Moment, oh wie viele werden vom Bösen geholt, ohne überhaupt an Buße denken zu können.“
Der Papst drängte darauf, den Blick auf Gott zu richten, der solch furchtbare Strafen zuläßt, um seine Kinder im eigentlichen Sinn des Wortes zurechtzuweisen; und um den göttlichen Zorn zu besänftigen, befahl er eine Litania septiformis, d. h. eine Prozession der gesamten römischen Bevölkerung, unterteilt in sieben Prozessionszüge nach Geschlecht, Alter und Stand. Die Prozession zog von den verschiedenen Kirchen Roms in die Vatikanische Basilika und begleitete den Weg mit dem Gesang der Litaneien. Das ist der Ursprung der sogenannten Großen Litaneien oder Rogationen der Kirche, Bittgebete, mit denen wir zu Gott beten, um uns vor Widrigkeiten zu schützen. Die sieben Prozessionen bewegten sich barfuß, langsamen Schrittes und mit aschebestreutem Haupt durch die Straßen des alten Rom. Als die Menge in dieser Grabesstille durch die Stadt zog, erreichte die Pest eine solche Heftigkeit, daß in der kurzen Zeit von einer Stunde achtzig Menschen tot zu Boden fielen. Aber Gregor hörte nicht auf, das Volk zu drängen, weiter zu beten, und er wollte, daß das Bild der Gottesmutter, das vom Evangelisten Lukas gemalt war und in Santa Maria Maggiore aufbewahrt wurde, vor der Prozession hergetragen wird (Gregor von Tours, Historiae Francorum, liber X, 1, in Opera omnia, herausgegeben von J. P. Migne, Paris 1849, S. 528).
Die Legenda aurea des Jacobus de Varagine, ein Kompendium der Traditionen aus den ersten Jahrhunderten der christlichen Ära, besagt, daß die Luft, je weiter das heilige Bild vorrückte, gesünder und klarer wurde, und sich die Miasmen der Pest auflösten, als ob sie seine Anwesenheit nicht ertragen könnten. Man hatte die Brücke erreicht, die die Stadt mit dem Mausoleum von Hadrian verbindet, das im Mittelalter als Castellum Crescentii bekannt war, als plötzlich ein Engelschor sang:
„Regina coeli, laetare, Alleluia, quia quem meruisti portare, Alleluia, resurrexit sicut dixit, Alleluia!“
Gregor antwortete laut:
„Ora pro nobis rogamus, Alleluia!“
So wurde das Regina Coeli geboren, die Antiphon, mit der die Kirche zur Osterzeit Maria Königin grüßt wegen der Auferstehung des Erlösers.
Nach dem Lied ordneten sich die Engel in einem Kreis um das Bild der Gottesmutter, und Gregor sah, als er die Augen erhob, auf der Spitze der Burg einen Engel, der sein bluttriefendes Schwert reinigte und in die Scheide zurücksteckte zum Zeichen, daß die Bestrafung zu Ende war.
„Tunc beatus Gregorius vidit supra Castrum Crescentii angelum Domini, qui gladium cruentatum detergens in vaginam remittebat: intellexitque Gregorius, quod pestis illa cessasset, et sic factum est. Unde et castrum illud castrum angeli deinceps vocatum est.“
Gregor verstand, daß die Pest vorbei war, und so geschah es: Und diese Burg wurde fortan nach dem Engel benannt (Jacobus de Varagine, Legenda aurea, kritische Ausgabe, herausgegeben von Giovanni Paolo Maggioni, Sismel-Edizioni del Galluzzo, Florenz 1998, S. 90).
Papst Gregor I. wurde heiliggesprochen und zum Kirchenlehrer erhoben, und er ging mit dem Beinamen „der Große“ in die Geschichte ein. Nach seinem Tod nannten die Römer die Mole Adrianorum „Engelsburg“ und stellten zur Erinnerung an das Wunder die Statue des Heiligen Michael, des Fürsten der himmlischen Heerscharen, auf die Spitze der Burg, wie er das Schwert zurück in die Scheide steckt. Noch heute befindet sich in den Kapitolinischen Museen ein kreisförmiger Stein mit Fußabdrücken, die der Erzengel der Überlieferung nach hinterlassen haben soll, als er innehielt, um das Ende der Pest anzukündigen. Auch Kardinal Cesare Baronio (1538–1697), der wegen seiner strengen Forschung als einer der größten Historiker der Kirche gilt, bestätigt das Erscheinen des Engels am höchsten Punkt der Burg (Odorico Ranaldi, Annales ecclesiastici, hrsg. von Kardinal Baronio, Mascardus, Rom 1643, S. 175–176).
Wir wollen nur anmerken: Wenn der Engel dank des Aufrufs des Heiligen Gregor das Schwert in die Scheide steckte, bedeutet das, daß es zuvor gezogen worden war, um die Sünden des römischen Volkes zu bestrafen. Die Engel sind in der Tat die Vollstrecker der göttlichen Bestrafung der Völker, wie uns die dramatische Vision des Dritten Geheimnisses von Fatima in Erinnerung ruft und uns zur Umkehr auffordert:
„Ein Engel, der ein Feuerschwert in der linken Hand hielt; es sprühte Funken, und Flammen gingen von ihm aus, als sollten sie die Welt anzünden; doch die Flammen verlöschten, als sie mit dem Glanz in Berührung kamen, den Unsere Liebe Frau von ihrer rechten Hand auf ihn ausströmte: den Engel, der mit der rechten Hand auf die Erde zeigte und mit lauter Stimme rief: Buße, Buße, Buße!“
Hat die Verbreitung des Coronavirus irgendeine Beziehung zur Vision des Dritten Geheimnisses? Die Zukunft wird es uns sagen. Aber der Aufruf zur Buße bleibt die erste Dringlichkeit unserer Zeit und das erste Mittel, um unser Heil in Zeit und Ewigkeit zu sichern. Die Worte des heiligen Gregor des Großen müssen in unseren Herzen widerhallen:
„Was werden wir über die schrecklichen Ereignisse sagen, die wir erleben, wenn nicht, daß sie Boten des zukünftigen Zorns sind? Denkt also, liebe Brüder, mit äußerster Aufmerksamkeit an diesen Tag, ändert Euer Leben, ändert Eure Gewohnheiten, besiegt die Versuchungen des Bösen mit all Eurer Kraft, bestraft mit Tränen die begangenen Sünden“ (Erste Predigt über die Evangelien, in: Il Tempo di Natale nella Roma di Gregorio Magno, Acqua Pia Antica Marcia, Rom 2008, S. 176–177).
Diese Worte sind es, und nicht der Traum der Amazonia felix, die die Kirche heute brauchen würde, die sich in einem Zustand zeigt, wie ihn der heilige Gregor zu seiner Zeit beschrieben hat:
„Ein altes, stark beschädigtes Schiff; von allen Seiten dringen die Wogen in es ein, und in den täglichen heftigen Stürmen gebrochen und morsch geworden, droht den Planken der Schiffbruch“ (Registrum I, 4 ad Ioann. Episcop. Constantinop.). Aber da erweckte Gott einen Steuermann, der eine starke Hand besaß, das ihm anvertraute Steuerruder zu lenken, wie der heilige Pius X. erklärt, „und es nicht nur verstand, aus den schäumenden Stürmen den Hafen zu erreichen, sondern auch das Schiff vor künftigen Unwettern zu sichern“ (Enzyklika Jucunda sane vom 12. März 1904).
*Roberto de Mattei, Historiker, Vater von fünf Kindern, Professor für Neuere Geschichte und Geschichte des Christentums an der Europäischen Universität Rom, Vorsitzender der Stiftung Lepanto, Autor zahlreicher Bücher, zuletzt in deutscher Übersetzung: Verteidigung der Tradition: Die unüberwindbare Wahrheit Christi, mit einem Vorwort von Martin Mosebach, Altötting 2017 und Das Zweite Vatikanische Konzil. Eine bislang ungeschriebene Geschichte, 2. erw. Ausgabe, Bobingen 2011.
- Bücher von Prof. Roberto de Mattei in deutscher Übersetzung die Bücher von Martin Mosebach können Sie bei unserer Partnerbuchhandlung beziehen.
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Corrispondenza Romana