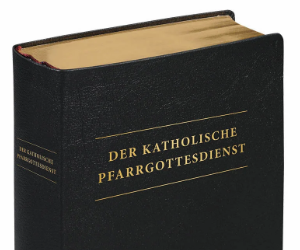(Genf) Fast 500 Jahre ist es her, daß die Heilige Messe aus der Kathedrale von Genf verbannt wurde. Nun soll sie dorthin zurückkehren. Eine vermeintlich großzügige Geste läuft Gefahr, in Wirklichkeit den Vorwand zu einem gigantischen Sakrileg zu liefern.
Die Geschichte des Bistums Genf reicht bis ins 4. Jahrhundert zurück. Damals entstand noch in römischer Zeit die erste Bischofskirche. Daran änderte auch nichts, daß 443 die germanischen Burgunden die Stadt zum Vorort ihres Reiches machten, die damals noch arianische Christen waren. Ihr König Sigismund bekehrte sich 506 zur katholischen Kirche und bat Papst Symmachus um Reliquien des Apostels Petrus, dem die Genfer Nordkathedrale geweiht war. 534 wurden die Burgunden von den Franken unterworfen.
Insgesamt gab es seit dem 6. Jahrhundert im bischöflichen Zentrum der Stadt drei Bischofskirchen, die unterschiedlichen liturgischen Zwecken dienten. Im 10. Jahrhundert wurde die dritte und jüngste, die sogenannte Ostkathedrale, vergrößert, sodaß in ihr die drei Kirchen zu einer zusammengefaßt wurden. Seit 1032 gehörte Genf zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation.
1160 erfolgte unter Bischof Ardizo (Hartwich), latinisiert in Arducius, Neffe von Bischof Girold, der Neubau der Kathedrale als dreischiffige Pfeilerbasilika, wie sie sich noch heute zeigt. Die Bischöfe von Genf hatten damals als treue Gefolgsleute des Kaisers mehrfach das Amt des Reichskanzlers für Burgund inne. Dafür machte Kaiser Friedrich I. den Arducius zum Fürstbischof und verlieh seinem Hochstift die Reichsunmittelbarkeit.
Im Konflikt der Stadt mit den Herzögen von Savoyen stellte sich Fürstbischof Pierre de La Baume, entstammten doch mehrere seiner Vorgänger dem Herzogsgeschlecht, auf die Seite der Herzöge. Die Stadt, die sich dagegen mit Bern und Zürich verbündet hatte, vertrieb 1533 den Bischof aus der Stadt. Er mußte seine Residenz in Annecy aufschlagen. Wie an vielen anderen Orten auch begünstigte der politische Konflikt die Ausbreitung der Reformation.

Bischof de La Baume war zudem 1530 vom Papst zusätzlich zum Erzbischof-Koadjutor von Besançon ernannt worden, was ohnehin dazu führte, daß er sich kaum noch in Genf aufhielt und den Keim der nahenden Revolution weder ausreichend erkannte noch dagegen einschritt. Überhaupt waren die Familien de La Baume und de Rye vor allem bedacht, die Bistümer Genf und Besançon in Familienhand zu behalten. In Genf folgte 1544 auf den nunmehrigen Kardinal Pierre de La Baume sein Neffe Louis de Rye, der aber nie in Genf residierte, da sein Bistum und das Herzogtum Savoyen damals vom französischen König besetzt waren.
Der Genfer Bildersturm
Am 8. August 1535 wurde in der Bischofskirche die letzte Heilige Messe zelebriert. An jenem Tag wiegelte der französischen Reformator Guillaume Farel die Genfer gegen die Kirche auf. Farel, der Frankreich wegen seiner Lehren verlassen hatte müssen, begab sich in deutsches Gebiet, um in Straßburg, Basel und Zürich Gleichgesinnte zu finden. Er unterstützte zunächst die Waldenser und begann schließlich in Genf zu predigen.
Ein Teil der Stadtbevölkerung folgte ihm und sah die Gelegenheit, sich ihres Landesherrn, des Bischofs, ganz zu entledigen. An jenem Tag wurde in Genf Jagd auf Priester gemacht. Die Kathedrale wurde zur Zeit der Vesper vom Mob gestürmt und ihre Inneneinrichtung zertrümmert. Im Genfer Bildersturm wurden die Altäre, liturgischen Ornamente, heiligen Utensilien und Heiligenstatuen zerstört. Der Rat der Stadt beschloß vorerst die Zelebration der heiligen Liturgie auszusetzen. Was als Vorsichtsmaßnahme gedacht war, wurde zur faktischen Abschaffung der katholischen Liturgie.
Farel war es, der 1536 den durchreisenden Calvin veranlaßte, in der Stadt zu bleiben. Im Mai jenes Jahres wurde offiziell die Reformation in Genf eingeführt, was auch das formale Ende der katholischen Kirche in der Stadt bedeutete.
Da dem Glaubensbekenntnis der beiden Reformatoren zunächst nur wenige Bürger folgten, die Stadtväter zudem außenpolitische Komplikationen mit Frankreich fürchteten, da beide Franzosen waren, und es zu Lehrstreitigkeiten mit den Zürcher Reformatoren kam, wurden Farel und Calvin nach Ostern 1538 aus der Stadt verwiesen, was aber keine Rückkehr zum katholischen Glauben bedeutete. Die Kathedrale wurde vielmehr zur Hauptkirche der Église protestante de Genève, der reformierten Protestantischen Kirche Genfs. Und nach Calvins Rückkehr 1541 zur Kirche, in der er predigte und von wo aus er sein fanatisches Regiment über die Stadt ausübte.
Der Bischofsstuhl von Genf wurde von den Päpsten zwar weiterhin besetzt, unter anderem mit dem heiligen Franz von Sales (1602–1622), doch der Bischof konnte seine Bischofsstadt, auch nach der katholischen Erneuerung durch das Konzil von Trient, nicht betreten, sondern residierte in Annecy.
Am 12. September 1609 nach der Heiligen Messe beschloß Franz von Sales, der vor seiner Bischofsweihe mehrfach nur geheim die Stadt Genf betreten konnte, um private Streitgespräche mit dem Anführer der Calvinisten zu führen, für seine Weiterreise nach Challex den kürzesten Weg zu nehmen, der ihn durch die Hochburg der Calvinisten führte. Obwohl er als katholischer Bischof dort um sein Leben fürchten mußte, hatte er sich dafür entschieden. Am Stadttor angekommen, wurde er nach seinem Namen gefragt. Er antwortet wahrheitsgemäß: „Franz von Sales, der Bischof dieser Diözese“. Daraufhin wurde er eingelassen, durchquerte in aller Ruhe die Stadt und verließ sie am anderen Ende wieder. Erst später verursachte dieser Ritt durch die Stadt großen Aufruhr unter den Calvinisten. Franz von Sales schrieb selbst darüber:
„Ihr habt erfahren, daß ich unter dem Geleit meines Schutzengels Genf durchquert habe, u. zw. nur, um nicht als Feigling dazustehen und das Wort zu bewahrheiten: ‚Wer in Einfalt wandelt, geht voll Vertrauen‘, und unter Angabe meines Titels. Ich rühme mich dessen nicht, denn in diesem Entschluß war wenig Klugheit; aber wie Sie wissen, ist das nicht meine Tugend.“
1756 setzten die reformierten Genfer der ehemaligen Kathedrale eine neoklassizistische Fassade vor, die heute ihr äußeres Erscheinungsbild prägt. Dabei wurde die protestantische Nationalkirche des Kantons erst 1907 zur legalen Eigentümerin der Kirche erklärt, was von katholischer Seite nicht unbestritten blieb.
Das Bistum Genf wurde im frühen 19. Jahrhundert mit dem Bistum Lausanne und später auch mit dem Bistum Freiburg im Üechtland vereint. Der Bischof von Lausanne gilt als Rechtsnachfolger. Seit 2010 ist der Dominikaner Charles Morerod Bischof von Lausanne, Genf und Freiburg.
Die ökumenische Falle
Fast 500 Jahre nach der Unterdrückung des katholischen Kultus wird am kommenden 29. Februar der Bischofsvikar für den Kanton Genf des Bistums, Msgr. Pascal Desthieux, erstmals wieder die Eucharistiefeier in der ehemaligen Bischofskirche zelebrieren dürfen.
Wirkliche Freude kommt darüber aber nicht auf. Der Vorsitzende des calvinistischen Kathedralrates, Daniel Pilly, der die Nachricht bekanntgab, forderte zugleich die Protestanten der Stadt auf, an der Zelebration teilzunehmen und die Kommunion zu empfangen.
Aus seiner Sicht ist diese Interkommunion offenbar etwas Normales, aus katholischer Sicht ist sie aber großes Problem, nämlich ein schwerwiegendes Sakrileg. Die heilige Kommunion darf nur empfangen, wer sich im Stand der Gnade befindet, wozu die Glaubenseinheit gehört, was voraussetzt, daß kein Glaubensdogma bewußt geleugnet wird. Das aber widerspricht jeder protestantischen Logik, will sie sich nicht selbst ad absurdum führen.
Pilly betrachtet daher den Kommunionempfang auch strikt aus protestantischer Sicht:
„Es hat keine Opposition gegeben, was von Bedeutung ist. Die Idee fand großen Anklang, denn sie entspricht unserem Wunsch, die Kathedrale zum Treffpunkt aller Genfer Christen zu machen. Ein Raum, der über konfessionelle Grenzen hinausgeht.“
Das ist aus katholischer Sicht aber nicht machbar, außer man bricht mit der kirchlichen Überlieferung, wie es deutsche Bischöfe mit päpstlicher Zustimmung seit Sommer 2018 bei protestantischen Ehepartnern tun. Es erstaunt auch die offensichtlich fehlende Bereitschaft von reformierter Seite, sich mit dem katholischen Eucharistieverständnis zu befassen.
Laut Pilly sei die Interkommunion in Genf nichts Besonderes:
„Das geschieht bereits in vielen Gemeinden vor Ort während ökumenischer Feiern, bei denen Protestanten und Katholiken sich gegenseitig zum Abendmahl und zur Kommunion einladen.“
Und Bischof Morerod schweigt dazu?
Emmanuel Fuchs, Vorsitzender der protestantischen Gemeinschaft von Genf und Pastor an der ehemaligen Bischofskirche, betonte, daß die Zelebration am 29. Februar im Einklang „mit dem ökumenischen Weg der vergangenen Jahre“ stehe, der vor allem von Msgr. Desthieux mitgetragen werde. Fuchs wörtlich:
„Wir haben unbestreitbare Fortschritte erzielt in der Ökumene, insbesondere mit der 2017 unterzeichneten Gemeinsamen Erklärung, in der unsere jeweiligen Ämter anerkannt werden.“
Wie das mit dem Kirchenrecht vereinbar sein sollte, erklärte Fuchs natürlich nicht. Es ist auch nicht seine Aufgabe, aber sehr wohl die von Weihbischof Desthieux.

Fuchs weiter:
„Es ist ein starkes Zeichen, das wir geben, indem wir mit unserer Kathedrale die Bereitschaft zeigen, uns zu öffnen, die Kirche zusammenzubringen, das Evangelium zu verkünden und unsere Liebe zu Christus zu bezeugen. Wie Papst Franziskus sagte, erfolgt die Ökumene, indem man gemeinsam geht. Wir versuchen, gemeinsam zu gehen, in der Hoffnung, daß die Hindernisse, die heute unüberwindlich erscheinen, nicht länger bestehenbleiben, wenn wir erst einmal lang genug gegangen sind.“
Und was sagen die Kirchenverantwortlichen?
Verpackt in die Rückkehr des katholischen Kultes in die ehemalige Bischofskirche, die jeden Katholiken freuen muß, ist damit ein unentschuldbares Sakrileg. Die Einladung an den Bischofsvikar, in der Kathedralkirche zu zelebrieren, erweist sich als vergiftetes Geschenk. Die Communion pour tous („Kommunion für alle“) eines Oecuménisme en Marche („Ökumene in Bewegung“, wobei die Anspielung auf die politische Bewegung von Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron unüberhörbar ist) spiegelt den calvinistischen Geist wider.
Kardinal Kurt Koch, der Vorsitzende des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen und selbst Schweizer, bezeichnete den 29. Februar als „große Premiere“. In Genf werde ein „symbolisches Ereignis für die Einheit der Christen gefeiert“. Ist das der Fall? Zur Verteidigung des Kardinals muß gesagt werden: Als er seine Aussage machte, habe er noch nichts von Pillys Aufruf zur „Kommunion für alle“ gewußt. Das ist glaubwürdig, da der Kardinal 2017 auch seine Ablehnung gegenüber der erwähnten „Gemeinsamen Erklärung“ zum Ausdruck brachte. Dennoch zeigt das Beispiel, daß eine Bereitschaft zum leichtfertigen Lob besteht, das sich im konkreten Fall als schwerer Fehler herausstellte, aber seither in Genf vielfach zitiert wurde.
Kardinal Koch und Bischof Morerod ließen es zudem, seit die Fakten auf dem Tisch liegen, an einer Reaktion fehlen. Weder korrigierte bisher der eine seine Aussage noch schritt der andere gegen das angekündigte Sakrileg ein. Letzteres wäre um so dringlicher, da behauptet wurde, daß die sakrilegische Kommunionspendung im Zuge einer fahrlässigen „eucharistischen Gastfreundschaft“ in Genf an der Tagesordnung sei. Mit der Zelebration am 29. Februar soll unter Berufung auf Papst Franziskus die sakrilegische Interkommunion auf eine neue Ebene und Sichtbarkeit gehoben werden.
Und die verantwortlichen Kirchenvertreter schweigen dazu?
Text: Giuseppe Nardi
Bild: Wikicommons