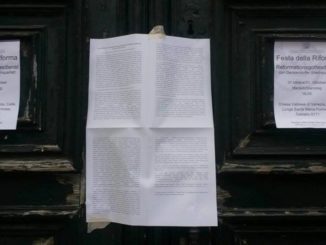Von Roberto de Mattei*
Am 15. Dezember 2019 gab der französische Historiker Jean de Viguerie in Montauban seine Seele Gott zurück. Zwei Wochen später, am 30. Dezember, jährte sich der 30. Todestag des italienischen Philosophen Augusto Del Noce. Was hatten diese beiden Persönlichkeiten der katholischen Kultur des 20. Jahrhunderts gemeinsam?
Jean de Viguerie, geboren 1935 in Rom, wurde nach einer brillanten akademischen Karriere als Professor an der Universität Lille-III emeritiert, ohne sich je mit der vorherrschenden Kultur auf Kompromisse eingelassen zu haben. Einer seiner Schüler, Philippe Pichot Bravard, schrieb:
„Der Glaube ist in Jean de Vigueries gesamtes Leben eingeflossen und hat sein Wirken als Professor angetrieben.“
Viguerie war ein gründlicher und gewissenhafter Kenner des 18. Jahrhunderts. Sein grundlegendes Werk ist meines Erachtens „Christianisme et Révolution. Cinq leçons d’Histoire de la Révolution française” („Christentum und Revolution”, Nouvelles Editions Latines, 1986). Die Lektüre dieses Buches bietet neben Pierre Gaxottes „La Révolution française“ („Die französische Revolution“, herausgegeben von Jean Tulard, Complexe, 1988) ein knappes, aber aufschlußreiches Bild dessen, was zwischen 1789 und 1795 in Frankreich geschehen ist.
Das originärste Werk von de Viguerie ist jedoch „Les deux patries. Essai historique sur l’idée de patrie en France“ („Die zwei Vaterländer. Historischer Essay über die Idee des Vaterlandes in Frankreich“, Dominique Martin Morin, 1998). Der französische Historiker zeigt darin auf, wie das traditionelle Verständnis der „Patria“, die an einem konkreten Ort und in einem präzisen historischen Gedächtnis verwurzelt ist, im 18. Jahrhundert von einem neuen Verständnis überlagert wird: vom abstrakten Vaterland der Menschenrechte, das von den Aufklärern und der französischen Revolution proklamiert wird.
Im Namen dieser Ideologie zog Frankreich im Ersten Weltkrieg ins Feld. Die Union Sacrée von 1914, ein Burgfrieden zwischen linken und rechten Nationalisten, war eine Fortsetzung des 1792 von der Nationalversammlung ergangenen Rufs zu den Waffen, als sie die Erklärung „La Patrie en danger“ („Das Vaterland ist in Gefahr“) abgab. Mit der französischen Revolution wurde die Parole von der „Vernichtung des Feindes“, des inneren wie des äußeren, in die Welt gesetzt, wie sie mit den Colonnes infernales, den „Höllenkolonnen“, betrieben wurde, die zwischen 1793 und 1794 die Aufständischen in der Vendée ausrotteten. Der Weltkrieg kostete Frankreich eine Million dreihunderttausend Tote. Allein die Offensive vom 16. April 1917 zwischen Soissons und Compiègne, wie de Viguerie in Erinnerung ruft, kostete für die Eroberung von fünf Kilometern einhundertsiebzehntausend Tote. 360.000 Opfer forderte die erste Offensivschlacht von Verdun im Oktober 1916. Diese Opfer wurden dem revolutionären Moloch gebracht als Preis für die Zerstörung der österreichisch-ungarischen Monarchie, des letzten katholischen Bollwerks gegen die politische und kulturelle Zerstörung der französischen Revolution.

De Viguerie war Biograph von Ludwig XVI. und von dessen Schwester Elisabeth von Frankreich, der er die Studie „Le sacrifice du soir“ („Das Abendopfer“, Cerf, 2010) widmete, die sicherlich der Causa der Seligsprechung der französischen Prinzessin zugute kommen wird. Er ist Autor vieler anderer Werke, einige davon autobiographisch wie „Itinéraire d’un historien“ („Weg eines Historikers“, Dominique Martin Morin, 2000) und „Le passé ne meurt pas“ („Die Vergangenheit stirbt nicht“, Via Romana, 2016), reich an Episoden und Anekdoten, die uns helfen, nicht nur sein Privatleben zu verstehen, sondern auch das Frankreich des 20. Jahrhunderts.
Augusto Del Noce, der einer piemontesischen Familie entstammte, wurde 1910 in Pistoia geboren, studierte aber in der ersten Nachkriegszeit des 20. Jahrhunderts in Turin. Sein intellektuelles Schaffen kann als spiegelverkehrt zu jener Linie progressiven Denkens verstanden werden, die sich in der Stadt Turin entwickelte und Norberto Bobbio und Umberto Eco zu ihren bekanntesten Vertretern zählte.
Als die Revolution von 1968 ausbrach, hatte Augusto Del Noce, Professor an der Universität Triest, beeindruckende Werke zur Philosophiegeschichte vorzuweisen wie „Il problema dell’ateismo. Il concetto di ateismo e la storia della filosofia come problema“ („Das Problem des Atheismus”, Il Mulino, 1964) und „Riforma cattolica e filosofia moderna“ („Katholische Reform und moderne Philosophie“, Il Mulino, 1965).
Seitdem verlagerte sich seine Aufmerksamkeit als Philosoph auf das philosophische Verständnis der Gegenwart. Seit Ende der 60er Jahre veröffentlichte er Werke wie „Il problema politico dei cattolici“ („Das politische Problem der Katholiken“, UIPC, 1967), „L’epoca della secolarizzazione“ („Das Zeitalter der Säkularisierung“, Giuffrè, 1970), „Tramonto o eclissi dei valori tradizionali“ („Untergang oder Verdunkelung der traditionellen Werte“, Rusconi, 1972) und „Il suicidio della Rivoluzione“ („Der Selbstmord der Revolution“, Rusconi, 1978) sowie postum „Giovanni Gentile. Per una interpretazione filosofica della storia contemporanea“ („Giovanni Gentile. Für eine philosophische Interpretation der Zeitgeschichte”, Il Mulino, 1990). Del Noce zeigt in diesen Büchern die kulturelle Kontinuität auf, die zwischen den verschiedenen politischen Regimen besteht, die im vergangenen Jahrhundert in Italien aufeinanderfolgten: Liberalismus, Faschismus und Antifaschismus. Das Denken von Francesco de Sanctis, Unterrichtsminister des Risorgimento-Italien, Giovanni Gentile, Kulturminister und Ideologe des Faschismus, und Antonio Gramsci, Haupttheoretiker des Antifaschismus nach dem Zweiten Weltkrieg, speist sich aus Hegels Immanentismus und folgt dem Weg eines fortschreitenden Abrückens von den traditionellen Werten. Die Ära der Revolution ist für Del Noce die Ära, diese Werte im Namen der Säkularisierung zu leugnen, die als positiver und notwendiger historischer Prozeß behauptet wird.
Del Noce identifizierte das Übel der zeitgenössischen Kultur in der Fortschrittsgläubigkeit, die er als „Progressismus“ bezeichnete, einer Geschichtssicht, die unter anderem auf der Idee beruht, daß nicht der Kommunismus, sondern der Faschismus das radikale Übel des 20. Jahrhunderts gewesen sei. Dies bedeutet für den Progressismus folglich die Notwendigkeit, daß mit dem Untergang des Faschismus auch jedes Ideal unterzugehen habe, das in irgendeiner Weise damit in Verbindung gebracht werden könnte, ausgehend von den traditionellen Werten, auf denen jahrhundertelang die christliche Zivilisation des Abendlandes gegründet war.
Der Idee der Revolution und dem „Geist der Moderne“, die sich auf den Primat des Werdens und damit auf den Mythos eines unaufhaltsamen und unumkehrbaren Fortschritts stützen, setzt Del Noce die Idee der Tradition entgegen, die auf der Philosophie des Primats des Seins oder der Kontemplation beruht und seiner Meinung nach zwangsläufig dazu bestimmt ist, Platon wiederzuentdecken, so wie die revolutionäre Philosophie des Primats des Werdens ihre kohärentesten Schlußfolgerungen in Marx hat.
Im Gegensatz zu Jean de Viguerie, der der konterrevolutionären Schule angehörte, bezog sich Augusto Del Noce nicht auf die großen Denker der französischen Restauration, sondern auf die italienische Schule von Antonio Rosmini und von Giambattista Vico, jenem Denker, dem er gerne sein letztes Buch gewidmet hätte, das zu schreiben der Tod ihn hinderte. Wie de Viguerie sah auch Del Noce in der französischen Revolution einen kulturellen Scheidepunkt, der den politischen und kulturellen Niedergang des christlichen Westens markierte.[1] Kardinal Carlo Maria Martini sagte im letzten Interview, das wenige Tage nach seinem Tod veröffentlicht wurde: „Die Kirche ist zweihundert Jahre zurückgeblieben“. Mit diesem Zitat schloß Papst Franziskus am 21. Dezember 2019 seine Weihnachtsansprache an die Römische Kurie. Die These von Kardinal Martini lautet, daß die Kirche zwei Jahrhunderte zurückgeblieben ist, weil sie ihre französische Revolution nicht vollzogen habe, und Papst Franziskus, der Erbe von Kardinal Martini, beabsichtigt, diesen Rückstand aufzuholen, indem er das Zweite Vatikanische Konzil zur Vollendung bringt.
Sowohl der französische Historiker als auch der italienische Philosoph waren dagegen überzeugt, daß die vom Zweiten Vaticanum proklamierte Akzeptanz der modernen Welt die Hauptursache für den Prozeß der Selbstzerstörung der Kirche ist.
Am 13. Mai 1989 fand im Palazzo Pallavicini in Rom eine wichtige Tagung über die französische Revolution statt. Bei dieser Gelegenheit trafen sich Augusto Del Noce und Jean de Viguerie. Was sie verband, war die Ablehnung der revolutionären Utopie, die Liebe zur Tradition und die Sorge wegen der Krise der Kirche, deren Tragweite sie spürten.
Augusto Del Noce starb einige Monate später, als die Berliner Mauer fiel und der Eiserne Vorhang einstürzte. Jean de Viguerie überlebte ihn um 30 Jahre und erlebte den Zerfall und den Zusammenbruch des Westens und der Kirche. Beide gehören zu unserem historischen Gedächtnis, von dem de Viguerie sagte, „die Vergangenheit stirbt nicht“.
*Roberto de Mattei, Historiker, Vater von fünf Kindern, Professor für Neuere Geschichte und Geschichte des Christentums an der Europäischen Universität Rom, Vorsitzender der Stiftung Lepanto, Autor zahlreicher Bücher, zuletzt in deutscher Übersetzung: Verteidigung der Tradition: Die unüberwindbare Wahrheit Christi, mit einem Vorwort von Martin Mosebach, Altötting 2017.
- Bücher von Prof. Roberto de Mattei in deutscher Sprache können Sie bei unserer Partnerbuchhandlung beziehen.
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Corrispondenza Romana
[1] s. Roberto de Mattei: La critica alla Rivoluzione nel pensiero di Augusto Del Noce („Die Kritik der Revolution im Denken von Augusto Del Noce”), Le Lettere, 2019.