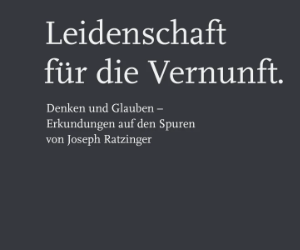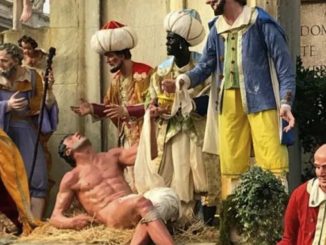(Rom) Papst Franziskus empfing heute Kardinal Reinhard Marx in Audienz. Der Erzbischof von München und Freising und Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz ist der Wortführer der deutschen Bischöfe, die derzeit „mit allem drohen, womit man nur drohen kann“ (Il Foglio), sollte ihre progressive Agenda im Zuge der bevorstehenden Amazonassynode nicht angenommen werden.
Das Tagesbulletin des vatikanischen Presseamtes gab bekannt, daß Kardinal Marx als erster heute vormittag zu Papst Franziskus vorgelassen wurde. Der einflußreiche Kardinal wird vom Presseamt in seiner Funktion als „Koordinator des Wirtschaftsrat“ ausgewiesen.
Der Hinweis ist deshalb erwähnenswert, weil Marx in der Vergangenheit bereits in ganz unterschiedlichen Funktionen in Audienz empfangen wurde: als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, als Mitglied des C9-Kardinalsrats, als Begleiter einer Delegation von Lutheranern, als Vorsitzender der COMECE, als Begleiter einer Delegation von katholischen und protestantischen Journalisten, so im vergangenen April.
Der Verweis auf den Wirtschaftsrat vermittelt den Eindruck, daß ökonomische Fragen, etwa die Finanzsorgen des Heiligen Stuhls, Gegenstand der Audienz gewesen sein könnten.
Die jüngste Ankündigung der deutschen Bischöfe, den „synodalen Weg“ nützen und eine „deutsche Synode“ abhalten zu wollen, der darauf folgende Schlagabtausch zwischen Kardinal Ouellet, Präfekt der Bischofskongregation, und Kardinal Marx und die Gerüchte über deutsche Schisma-Drohungen, lassen anderes vermuten.
Papst Franziskus sagte auf dem Rückflug von Mauritius, angesprochen auf eine zunehmende Gereiztheit konservativer Kreise in den USA, daß er kein Schisma wolle, aber auch keines fürchte. Da konservative Kreise aber keine Schisma-Neigungen zeigen, vermuteten Beobachter, Franziskus habe mehr die deutschen Bischöfe unter Führung von Kardinal Marx im Auge gehabt.
Es ist ein offenes Geheimnis, daß hinter der Sondersynode über das so ferne und exotische Amazonasgebiet vor allem Bischöfe des deutschen Sprachraumes stehen. Die damit verknüpften Interessen sind vielfältig. Sie reichen vom „synodalen Weg“ – der nationale Sonderwege im Sinne einer „Dezentralisierung“ ermöglichen soll, wie es mit der Umsetzung von Amoris laetitia bereits der Fall ist (jede Bischofskonferenz und jeder Bischof entscheidet, welche Interpretation er umsetzten will) – über das Kippen des Zölibats durch Zulassung verheirateter Männer, die Zulassung von Frauen zum Weihesakrament bis zur „Anpassung“ der Morallehre und ökosozialen Trends.
Es ist auch unüberhörbar, daß den in der deutschen Kirche tonangebenden Progressiven das Tempo des „neuen Kurses“ zu langsam geht. Beklagt wird, daß Franziskus „Erwartungen geweckt“ habe, die sich aber nicht oder nicht ausreichend schnell verwirklichen. In der Tat haben jene Kreise, die hinter der Wahl von Franziskus zum Papst stehen, allen voran die Kardinäle Kasper und Lehmann, eine Erwartungsspirale mit einer Eigendynamik in Bewegung gesetzt.
Vor wenigen Tagen richtete nach Kardinal Ouellet auch Antonio Kardinal Cañizares, der Erzbischof von Valencia und ehemalige Präfekt der römischen Gottesdienstkongregation, eine Mahnung an die deutschen Bischöfe.
Was Papst Franziskus und Kardinal Marx heute besprochen haben, wurde nicht bekanntgegeben. Es darf aber angenommen werden, daß die jüngsten Entwicklungen an oberster Stelle standen.
Die Erwähnung von Marx als Koordinator des Wirtschaftsrates des Heiligen Stuhls läßt eine Verquickung anklingen, die nicht nur in Rom, sondern auch unter deutschen Katholiken mit gemischten Gefühlen gesehen wird.
Geld öffnet viele Türen, manchmal auch in der Kirche. Die Kirche in Deutschland ist sehr reich, während den Heiligen Stuhl einige Finanzsorgen plagen, wie jüngst beklagt wurde.
Das Geld der deutschen Kirche hat bereits viel Gutes bewirkt, allerdings auch manchen Schaden angerichtet, etwa in Brasilien, dem Schwergewicht bei der bevorstehenden Amazonassynode.
Die Sorge über einen eventuellen Handel geht um. Allein schon, daß es solche Stimmen gibt, zeigt an, wie angespannt die Stimmung derzeit ist – nicht nur in Rom. Noch schwerwiegender ist, daß immer häufiger von Gläubigen die Meinung zu hören ist, der Grund für das Schlamassel im deutschen Sprachraum sei, weil manche Bischöfe „nicht mehr glauben“.
Bei allen kirchlichen Autoritäten sollten Alarmsirenen heulen.
Text: Giuseppe Nardi
Bild: jesus.ch (Screenshot)