
„Der Nachfolger Petri, der Papst, hat eine ihm von Gott streng aufgetragene Pflicht als Inhaber der Kathedra der Wahrheit (cathedra veritatis), die Wahrheit des katholischen Glaubens, der göttlichen Verfassung der Kirche, der von Christus gestifteten Ordnung der Sakramente und des apostolischen Erbgutes priesterlicher Ehelosigkeit in ihrer Reinheit und Unversehrtheit zu bewahren und an seinen Nachfolger und die nächste Generation weiterzugeben.
Er darf die offenkundig gnostisch und naturalistisch geprägten Inhalte einiger Teile des Instrumentum laboris sowie die Abschaffung der apostolischen Pflicht der priesterlichen Ehelosigkeit (die zunächst regional ist und dann naturgemäß schrittweise universal wird) durch sein Schweigen oder durch ein zweideutiges Verhalten nicht im geringsten unterstützen.
Selbst wenn der Papst das in der kommenden Amazonassynode tun würde, dann würde er seine Pflicht als Nachfolger Petri und Stellvertreter Christi schwer verletzen und kurzzeitig eine geistige Sonnenfinsternis in der Kirche verursachen.
Aber diese kurze Eklipse wird Christus, die unbesiegbare Sonne der Wahrheit, wieder erhellen, in dem Er Seiner Kirche erneut heilige, mutige und treue Päpste schenken wird, denn die Pforten der Hölle können den Felsen Petri nicht überwältigen (vgl. Mt. 16, 18) und das Gebet Christi für Petrus und seine Nachfolger ist unfehlbar, dass sie nämlich nach ihrer Bekehrung, die Brüder im Glauben wieder stärken werden (vgl. Lk. 22, 32).“
Auszug aus dem Kommentar von Msgr. Athanasius Schneider, Weihbischof von Astana, zu Aussagen des emeritierten Missionsbischofs Erwin Kräutler und zum Instrumentum Laboris der bevorstehenden Amazonassynode. Das Arbeitspapier, das mit Billigung von Papst Franziskus Grundlage der Synodenarbeit sein wird, machen katholische Kritiker den Vorwurf eine pantheistisch und relativistische Ökobefreiungstheologie zu vertreten und durch die beabsichtigte Zulassung verheirateter Priester durch Aufhebung der priesterlichen Zölibatsverpflichtung, ein Attentat auf das Weihesakrament zu beabsichtigen. Der Österreicher Kräutler nimmt seit 2014 eine zentrale Rolle bei den Vorbereitungen der Amazonassynode ein. Bischof Schneider stellt Bischof Kräutler (letztlich aber Papst Franziskus) die Frage, ob er statt der von Jesus Christus gestifteten römisch-katholischen Kirche eine amazonische Sekte wolle. Seinen Kommentar von Bischof Schneider veröffentlichte er am 17. Juli 2019 bei Kath.net.
Bild: MiL



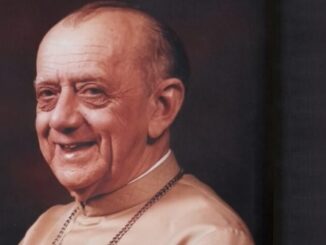

Verheiratete Priester gab es in den frühchristlichen Gemeinden, und noch heute gibt es sie in vielen Kirchen, u.a. in der orthodoxen Ost-Kirche. Ich sehe es als Affront gegen all diese Christen an, verheiratete Priester als minderwertige Christen zu betrachten. Weder Paulus noch Petrus haben den Zölibath für Priester erfunden oder ihn dogmatisch angeordnet, ja, Petrus selbst war verheiratet. Was allerdings die politische Einmischung des Papstes in weltliche Dinge angeht, bin ich zu hundert Prozent auf Seiten des Bischofs! Der Papst sollte sich um die Botschaft Jesu und die Verbreitung des Evangeliums und ganz besonders um die verfolgten christlichen Gemeinden in aller Welt kümmern, wie es die Apostel uns vormachten. Wenn er all dies täte, würde er damit bereits viele Fluchtursachen bekämpfen und könnte den Menschen die Bewahrung der Schöpfung dann ebenfalls glaubhaft ans Herz legen.
Sehr geehrte Frau Werner,
vielleicht helfen Ihnen die folgenden moraltheologischen Darstellungen um den gottgewollten Zölibat zu verstehen.
„Der Priester soll in seinem Leben als Opfernder und als Geopferter Christus, den Hohenpriester und das Opfelamm, darstellen. Sein Umgang mit dem eucharistischen Heiland soll sich in einem ‚himmlischen‘ Leben spiegeln. Seine ganze Liebe soll nächst Christus und in Christus den Seelsorgsbefohlenen gehören. Er soll der geistliche Vater der Gläubigen sein, ohne durch die Sorge für eine Familie geteilt oder abgelenkt zu sein. … An zweiter Stelle empfehlen auch praktische, seelsorgliche Gründe den Zölibat: Er hilft mit, dem katholischen Priester das einzigartige Vertrauen zu bewahren, das er in Seelsorge und Beichtstuhl genießt. … Er verleiht dem Klerus und damit der Gesamtkirche eine größere Unabhängigkeit und Freiheit gegenüber dem Zwang der weltlichen Gewalt.“ Das Gesetz Christi. Moraltheologie dargestellt für Priester und Laien von Bernhard Häring.
Die Ehelosigkeit als Lebensform des Klerus wird begründet:
1. im Beispiel Jesu und des Apostels Paulus („Ich wollte, alle Menschen wären wie ich“ 1. Kor 7,6).
2. In der Lehre vom Basileia-Geschlechtsverzicht (Mt 19,10–12).
3. Psychologisch-seelsorgerlich in dem völligen Freisein für Gott und seine Königherrschaft.
Begriff der Basilei-Virginitas: Die Eigenheit einer natürlichen Schau der Jungfräulichkeit ist das „Verschnittsein um der Basileia willen“ (Mt. 19,12). Jesus stellt ein Ideal auf, das nicht für alle und nicht für viele bestimmt ist. Die meisten Menschen drängen zur Ehe. Nur wer sich dazu berufen glaubt und die sittliche Kraft aufbringen will, diese Ideale überdurchschnittliche Leistung auf Heilsantrieb zu vollbringen, der soll die Ehelosigkeit ergreifen. Dazu gehört besondere Berufung. Mt 19,11: „Nicht alle fassen dieses Wort, sondern nur die, denen es gegeben ist.“ Mt 19,12c: „Wer es fassen kann, der fasse es.“ zitiert aus Stelzenberger – Lehrbuch der Moraltheologie.
Danke!
Ein zölibatärer Priester ist realistisch, er will dem Herrn ganz dienen und weiß, dass er keinerlei Zeit für Frau und Kinder hat. Ihm fehlt Gott sei Dank die heutige Sexsucht unserer total sexualisierten Gesellschaft, er will keine Frau deswegen in ein Nischendasein drängen. Ein zölibatärer Priester hat Hochachtung vor den Frauen.
Und, werte Frau Werner, was machen denn alle Verheirateten in der himmlischen Ewigkeit? Dort leben alle zölibatär, die Liebe zu Gott erfüllt sie ganz. Wunderschön, wer dies mit der Hilfe Gottes schon auf Erden gewählt hat. Auch wer verheiratet war, ist nicht mehr verheiratet.
Es rächt sich immer mehr, das so viele Gute und traditionstreue Priester stillschweigend das Konzil mit seinen Häresien geduldet haben.
Spätestens bei dem Assisi-Gräuel hätte der Aufschrei kommen MÜSSEN, spätestens ! !
Aber man hat geschwiegen, darüber weggesehen, ignoriert !
Eine Katastrophe, denn der Fall des Zölibats, die Homoehe und die Priesterweihe für Frauen, ist nur noch ein ganz kleiner Schritt für die Modernisten.
Solange keiner widerspricht (nicht einmal die FSSP oder andere Treue), geht der Abbruch fleißig weiter und ganz ehrlich, bei soviel Lauheit im Klerus, kann man sich das doch nur wünschen.
Je brutaler der Zusammenbruch, umso besser geht nachher der Aufbau aus den Trümmern.
Christus weiß genau was er zulassen kann und was nicht, vertrauen wir auf ihn!
An Frau Monika Werner:
Roger Schutz, Gründer der ökumenischen Mönchsbewegung Taize, äußerte sich zu Wesen und Sinn des Zölibats:
Die Keuschheit des Zölibats ist allein durch Christus und das Evangelium mög-lich. Daran muss man die, die Frau, Kinder, Äcker verlassen haben, immer wieder erinnern. Wenn man das Zölibat nicht so sieht, ist man von vorherein zur Bitterkeit, zum Versagen und vielleicht zur Versäumnis dessen, wofür man berufen ist, verurteilt: dann wird die Fülle des christlichen Lebens, die im Zölibat so groß ist wie in der Ehe, im Grunde zerstört.
Diese Wirklichkeit ist so schwer zu verstehen, dass man denen nicht bös sein kann, die nicht begreifen, was Christus über den Zöibat gelehrt hat. Er selber betont: „Wer es fassen kann, der fasse es.“
Es muss unterstrichen werden: Was Chrstus über Ehe und Ehelosigkeit gelehrt hat, ist heute wie am ersten Tag revolutionär, und wenn man es begreifen will, bleibt nur die Möglichkeit, sich ins Klima des Alten Bundes hineinzuversetzen.
Tasächlich wird in Israel die Ehe als eine Naturnotwendigkeit verstanden, die von dem „seid fruchtbar und mehret euch“ her geprägt ist. Es ist vor allem wichtig, Abraham eine Nachkommenschaft zu sichern; daher der Nachdruck, der im Blick auf das Weiterleben des Volkes Israel auf der Zeugung liegt. Aber wenn man die außerordentliche Leichtigkeit aus der Nähe besieht, mit der die Ehescheidung sich vollzieht – genügt doch ein Scheidebrief, um die ehelichen Bande zu lösen – , wird man sich schnell klar, dass die Monogamie in Israel in Gefahr ist, eine in aufeinanderfolgenden monogamen Ehen bestehende Polygamie zu sein. So erhält man das ursprüngliche Gebot „Du sollst nicht ehebrechen“ aufrecht und beruhigt gleichzeitig das Gewissen des Menschen.
Da sich um des religiösen Gesetzes willen alle verheiraten müssen, kann man behaupten, dass es im Augenblick der Ankunft Christi in Israel keine wirkliche eheliche Berufung gibt, denn es gibt keine Wahl aus freier Zustimmung.
Christus stiftet also eine neue Ordnung. Von nun an steht jeder in der Kirche vor zwei schwierigen Berufungen, die beide aus Verzicht, Einschränkung und Opfern bestehen. Die tatsächlich monogame Ehe, die die Scheidung ausschließt, ist für das Herz der gefallenen Kreatur nicht natürlicher als das Zölibat. Von nun an ist es nicht mehr nötig, dem Abraham um jeden Preis für Nachkommen zu sorgen. Jesus selbst, wahrer Mensch und wahrer Gott, wählt für sich selbst das Zölibat um des Reiches Gottes willen.
Ehe und Ehelosigkeit sind beide christliche Absoluten. Um Christi willen werden beide zu Zeichen des Reiches Gottes, das kommt. Beide auferlegen gefährliche Lebensbedingungen, die man nur um Christi und des Evangeliums willen auf sich nehmen kann.
Die Reformation, die so sehr um die Rückkehr zu den biblischen Grundlagen besorgt ist, kehrt im Blick auf das Zölibat doch recht oft zur alttestamentlichen Lage zurück. Im 16. Jahrhundert sah man vor allem gewisse Missbräuche des kirchlichen Zölibats und kümmerte sich wenig um seinen evangelischen Wert. Ganz bestimmt hat das Fehlen einer Theologie des Zölibats in der breiten Masse der Evangelischen dazu geführt, dass sie die Verplichtung zum christlichen Zölibat nicht eingehen wollen. Tatsächlich wehren sich die meisten gegen den Verzicht des Mannes auf die Liebe zur Frau.
Wie soll aber die Ehelosigkeit bewältigt werden, solange man sich weigert, das christliche Zölibat als einen Ruf Gottes anzusehen? Höchstens ist man bereit, die praktische Nützlichkeit des Zölibats anzuerkennen, und beruft sich dann auf Paulus. Doch ist das, was die Berufung zum Zölibat ausmacht, vielmehr in den Zeichen des Anstoßes zu sehen, das dieses Zölibat in einer verhärteten Welt darstellt, die nicht hören kann und sichtbare Zeichen nötig hat. Im sexualisierten Klima der westlichen Welt stellt ein in einer glaubwürdigen Reinheit im Namen Christi gelebtes Leben eine Frage von großer Tragweite.
Warum verzichten? Es handelt sich um den Gehorsam gegenüber einem Gebot des Evangeliums, das nicht das der Natur ist. Deshalb zeigt sich der ganze Wert der Berufung zum Zölibat, wenn sie in Männern und Frauen verkörpert ist, die Wesen von Fleisch und Blut und manchmal mit einer feurigen Seele begabt sind, Wesen, die oft sehr reich an menschlichen Möglichkeiten und gar nicht empfindungsarm sind. Durch die cenobitische Berrufung kann dieses Zeichen des Anstoßes durch die Gegenwart von Männern und Frauen in der Fabrik, im bäuerlichen Leben oder auch in geistlichen Kreisen überall aufgerichtet werden.
Aber es muss hier noch einmal gesagt werden, christliche Ehe und christliches Zölibat haben ihren Wert nur darin, dass sie Bemühung um den Gehorsam gegenüber dem Herrn der Kirche sind; ihr einziges Ziel ist, ihn mehr zu lieben. Niemals werden sie zur Verarmung führen, wenn sie aus Liebe zu Christus und dem Nächsten angenommen werden. Ist das nicht der Fall, dann werden sie sehr schnell zum Rückfall in die Selbstliebe: wir lieben dann nicht mehr um Christi willen, unsere Liebe ist weit davon entfernt, sich hinzugeben, und will vor allem besitzen und an sich reißen. So können die besten Eheleute aus ihrem Haus eine Zelle des Todes machen, weil sie alles in ihm vom natürlichen Glück abhängig machen; man kann christliche Eltern beobachten, die ihre Kinder nur zu ihrer eigenen Befriedigung lieben. Und gibt es nicht auch Unverheiratete, die nach und nach diesen Abhang hinabschlittern? Weil sie Angst davor haben, sich zu öffnen, verwandelt sich ihr starkes Empfindungsvermögen in eine introvertierte Empfindlichkeit und macht sie zu Wesen, die nur noch aus Reizbarkeit bestehen.
Wenn sich die Liebe Christi nicht unseres ganzen Wesens bemächtigt, wenn wir uns nicht von seiner Liebe durchglühen lassen, können wir nicht hoffen, dass sich uns die Fülle der christlichen Ehe oder des chrislichen Zölibats schenkt.
Für alle, die in die große Mönchsfamilie eingetreten sind, bedeutet die endgültge Verpflichtung zum Zölibat den Willen, Menschen einer einzigen Liebe zu werden. Die Berufung zum mönchischen Leben – wie das schon ihr ursprünglicher Sinn, die Berufung zur Einsamkeit, zeigt – bringt für den, der sie annimmt, eine gewisse Einsamkeit mit Gott mit sich. Wer also aus dieser Berufung heraus lebt, speist seine Liebeskraft aus der einzigen Quelle, aus Christus, da er den unsichtbaren Gott lieben soll, ohne die Menschen, die er sieht, zu hassen. Durch die Reinheit des Zölibats strebt er danach, der Mensch einer einzigen Liebe zu werden.
Eine Frage bleibt noch offen. Wie kann man sich, wenn Ehe und Zölibat derarti-ge Foderungen stellen, fürs Leben binden? Das ist ungefähr die Frage der Jünger. Im Blick aufs Zölibat werden wir gefragt, mit welchem Recht wir uns fürs Leben binden: heißt das nicht dem Heiligen Geist die Freiheit nehmen? Aber denken wir damit nicht über die Freiheit Gottes nach, nur um uns seinem Ruf zu entziehen? Als Gott nicht frei und mächtig genug wäre, diesen seinen Ruf deutlich zu machen! Für uns war die einzige Antwort die, dass wir uns allein um der Verheißungen Christi willen verpflichten konnten: „Wer verlässt Vater oder Mutter oder Weib oder Kinder …, wird’s hundertfältig nehmen und das Leben ererben.“ Wenn wir uns mit Christus engagieren, dann engagiert auch er sich sofort mit uns. Darin steckt eine Erfahrungswahrheit, die uns einen Ruf bestätigte, den vielleicht nur der voll und ganz verstehen wird, dem er gegeben ist.
Wenn der Zölibat eine größere Verfügbarkeit für Gottes Sache ermöglicht, so kann man es nur annehmen, um sich mit der Liebe Christi selbst mehr dem Nächsten hinzugeben.“
Unser Zölibat bedeutet nicht, dass wir mit den Menschen brechen müssten, de-nen wir in Zuneigung verbunden sind, und nicht, dass wir gefühlskalt wären, sondern es beruft uns zur Verwandlung unserer natürlichen Liebe. Christus allein bewirkt die Verwandlung der Leidenschaften in eine völlige Liebe zum Nächsten. Wenn der Egoismus der Leidenschaften nicht von einer wachsenden Hingabe übertroffen wird, wenn das Herz nicht dauernd erfüllt ist von einer unermesslichen Liebe, kannst du nicht Christus in dir lieben lassen, und dein Zölibat wird dir lästig.
Dieses Werk Christi in dir verlangt unendlich viel Geduld (Regel von Taize).
Die Verpflichtung zur Keuscheit ist der Ruf, eine völlige Reinheit zu leben, und das manchmal in gefährlichen Lebensbedingungen. Man sagt nicht zuviel, wenn man von einer heldenhaften Keuschheit spricht, in einem Kampf, der uns mit Leib und Seele an Christus bindet.
Die Reinheit des Herzens hat zum Ziel, uns Gott schauen zu lassen. „Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen.“ Auf diese Verheißung, dass man Gott schauen wird, ihn sehr bald, ihn schon in diesem Leben schauen wird, muss man sich stützen. Das allein wird künftig zählen. Ohne die Sehnsucht, Christus zu sehen, darf man nicht hoffen, dass man in der Reinheit des Herzens und des Fleisches festbleiben wird. Ohne diese Erwartung, die man in der stillen Kontemplation der Person des Gottessohns Christus selbst in sich erhält und erneuert, ist keine Reinheit denkbar, weil, wie es scheint, jeder andere endgültige und unaufhebbare Verzicht auf das fleischliche Begehren, sogar das in der Phantasie, zu einer dumpfen Auflehnung führen muss und weil in jedem Menschen das Bedürfnis nach einer völligen Intimität lebt, das dananch drängt, durch die körperliche Intimität befriedigt zu werden.
Will man in der Keuschheit festbleiben, will man auf den Ruf des Herzens zur Einheit antworten, will man fortan glaubwürdig sein, so wird nur der brennende Wunsch, Christus zu schauen, fähig sein, diesen Durst zu stillen. Nach und nach fällt das, was verworren und uneingestanden ist, durch die Kontemplation Christi, wie er in den Evangelien lebt, und Christi, wie er im Gebet der Kirche verherrlicht wird, gegen seinen Willen von uns ab.
„Das Auge von sich werfen, die Hand abhauen, die einem Ärgernis schafft“, „seinen Leib hart in Zucht nehmen“ … Außer Christi und des Evangliums wegen kann man keine derartige Zucht auf sich nehmen. Gewiss muss man kämpfen wie ein guter Sportler in der Arena, wenn man den Preis erringen will; das Auge von sich werfen mit dem Ziel, neue Gewohnheiten zu schaffen und einen ganzen inneren Mechanismus zu beherrschen, der es fertigbringt, in der oder jener Lage das ganze Gefolge der Phantasiebilder in Gang zu setzen. Und am Ende des Weges mit Christus die Ruhe unseres fleischlichen Lebens in Gott zu finden.
Aber man darf niemals vergessen, dass kein Versuch, zur Reinheit zu kommen und dadurch Gott zu schauen, ohne die Kontemplation gelingen kann. Ohne diese wendet sich die Askese gegen sich selbst, sie sucht, eine unerreichbare Reiheit zu verwirklichen, kommt dahin, dass sie diese um ihrer selbst willen liebt, und hascht also nach sich selbst.
Allein unser Blick auf Christus ermöglicht die langsame Verwandlung. Nach und nach wird aus unserer natürlichen Liebe lebendige Nächstenliebe; die eine ist über die andere hinausgewachsen. Das Herz, das Gefühl, die Sinne, die Menschlichkeit sind dann immer noch durchaus lebendig, aber ein anderer als man selbst gestaltet sie um.
An Monika Werner:
Erzbischof Johannes Joachim Degenhard an seine Mitbrüder im Jahre 1995
Einer der besten und integersten Erzbischöfe des deutschen Sprachraums war der verstorbene Paderborner Kardinal Johannes Joachim Degenhard. Degenhard war mildherzig und gleichzeitig kosequent in seiner Haltung. Persönlich war er völlig bedürfnislos. Unablässig kümmerte er sich um das seelische Befinden seiner priesterlichen Mitbrüder. Alte und kranke Priester besuchte er in ihrer Wohnung. Nie unterließ er es, insbesondere die noch jüngeren Priester auf die Verpflichtung zum priesterlichen Zölibat hinzuweisen. Für ihn war der Zölibat mehr als nur ein belangloses Kirchengebot, das jederzeit nach Belieben aufgehoben werden könnte, wie man es heute so leicht fordert und was selbst von Bischöfen zu hören ist. Wer so spricht, missachtet leicht das Wesen des Zölibats. Degenhard war sehr enttäuscht, wenn er feststellen musste, dass gerade junge Priester ihr Gelübde brachen. Hier der in meinen Augen sehr wertvolle Rundbrief:
Liebe Mitbrüder,
in den letzten Monaten haben mehrer jüngere Priester im Erzbistum Paderborn den priesterlichen Dienst aufgegeben. Es sind sechs, die ich aufgrund der Tatsache, dass sie die übernommene priesterliche Lebensform mit der Verpfichtung zum Zölibat nicht mehr eingehalten haben oder nicht mehr einhalten wollten, entsprechend den kirchlichen Regelungen suspendiert habe.
Schon in der Vergangenheit ist es vorgekommen, dass Mitbrüder um Beurlau-bung gebeten haben zur ‚Klärung des Priesterberufes‘. Zur Zeit sind es zwei Mitbrüder, denen ich eine solche Beurlaubung gegeben habe.
Auch wenn die Zahl der Priester, die wegen der Zölibatsverpflichtung aus dem priesterlichen Dienst ausscheiden, nicht nur unser Bistum allein betrifft und somit die Gründe nicht allein bei uns zu suchen sind, können wir darüber doch nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.
Die aus dem Dienst ausgeschiedenen Mitbrüder nennen unterschiedliche Gründe. Es ist jedoch die Beziehung zu einer Frau, die meist Anlass zu ihrer Suspendierung gegeben hat. Diese Beziehung hat die Mitbrüder bewogen, ihr vor der Weihe gegebenes Versprechen nicht mehr zu halten, nämlich die beim Skrutinium vor der Weihe mir persönlich gegebene Versicherung, dass sie ungezwungen und freiwillig die priesterliche Lebensweise auf sich nehmen wollen, für Lebenszeit ehelos um des Reiches Gottes willen, um Jesu und des Evangeliums willen zu leben.
Jeden, der jetzt aus dem Dienst ausgeschieden ist, habe ich vor der Priesterweihe gefragt, ob er sich das sorgfältig überlegt habe, ob er es mit seinem Beichtvater und mit seinem geistlichen Begleiter besprochen habe, ob er innerlich Ja dazu sage und nicht nur aus äußeren Gründen, etwa weil er sonst nicht zum Priester geweiht würde, auch ob ich mich auf sein Versprechen verlassen könne.
Alle haben diese Fragen überzeugt und für mich überzeugend mit Ja beantwortet. Jetzt stehen sie nicht mehr zu ihrem Versprechen, dass sie als Erwachsene nach etwa sieben Jahren Vorbereitungszeit freiwillig gegeben haben.
Wir empfinden Trauer und Schmerz darüber, dass uns diese Priester für den Dienst in den Gemeinden fehlen werden. Wir werden den in der Vergangenheit liegenden Gründen für die Amtsaufgabe nachgehen und mögliche Versäumnisse, etwa in der Ausbildung, in der Prüfung der Kandidaten oder in der Einführung der Neupriester in ihren Dienst auszumachen suchen. Es geht nicht darum, Schwäche und Versagen einzelner in der Öffentlichkeit herauszustellen oder einseitig die Schuld bei einer Frau zu suchen.
Aber das genügt nicht.
Wichtig und notwendig erscheint mir, dass wir uns als Presbyterium insgesamt und persönlich als Priester immer wieder um die Vertiefung und Erneuerung ‚unserer ersten Liebe‘ (vgl. Offenbarung 2,4) mühen, damit unser Lebenszeugnis als Priester nicht entleert und unser Dienst fruchtbar bleibt.
Wir dürfen uns dabei aber keiner Selbsttäuschung hingeben und müssen uns in aller Nüchternheit bewusst bleiben: Die Ehelosigkeit des Priesters ist zu keiner Zeit selbstverständlich gewesen.
Sie ist verständlich und lebbar im Blick auf Jesus Christus und in der Verbundenheit mit ihm und seiner Sendung, das heißt: Einerseits ist Christus und sein Wille das bleibende Maß, das ‚Bild‘ des Priesters, andererseits ist der Priester und das Priesterbild nicht zeitlos; denn der Priester ist ‚aus den Menschen ausgewählt und für die Menschen eingesetzt zum Dienst vor Gott‘ (Hebr 5,1). Er ist auch ‚Kind seiner Zeit‘, nicht unberührt von der Zeit, nicht nur von der Freude und der Hoffnung, der Trauer und der Angst der Menschen (vgl. Gaudium et spes, Nr. 1), sondern auch vom Zeitgeist und seinen Strömungen. Darum gilt nicht nur der Kirche insgesamt, sondern insbesondere auch dem Priester das mahnende Wort des Apostels Paulus: „Angesichts des Ernbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder, euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist“ (Röm 12, 1–2).
Auch den aus dem priesterlichen Dienst ausgeschiedenen, die sich noch einmal zu einem Gespräch mit mir treffen, sage ich, ob sie vielleicht auch ihr Versprechen, das sie mit einer eventuellen Hochzeit ihrer Freundin geben, für belanglos halten, wenn er oder seine Frau einige Jahre später dem Partner sagen: „Was ich damals versprochen habe, das gilt nicht mehr.“? Solche Handlungsweise ist wohl kaum als ein Zeichen von menschlicher Reife anzusehen. Ich bin mir bewusst, dass Ehe und Zölibat der Sache nach nicht gleichzusetzen sind, aber die psychologische Struktur der Entscheidung ist durchaus vergleichbar: Beide Male geht es um ein lebenslang gegebenes Versprechen.
Genau so wenig wie es ein Grund ist wegen der hohen Zahl von Ehescheidungen die Ehe als überflüssig anzusehen, scheint mir auf der anderen Seite es genau so wenig richtig zu sein, wegen des Ausscheidens von Priestern, die ihr Versprechen nicht gehalten haben oder nicht halten wollen, den Zölibat aufzugeben.
Die Kirche erwartet, dass ein Versprechen, das ein Priester frei und ungezwungen gegeben hat, auch eingehalten wird. Niemand muss ja Priester werden. Es gibt heute viele Berufe in der deutschen Kirche, die von verheirateten Männern ausgeübt werden.
Heute werden die katholischen Spezifica weithin abgelehnt und nicht verstanden. Dazu gehören auch der Zölibat, die hierarchische Struktur der Kirche, die Nichtzulassung der wiederverheirateten Geschiedenen zur Kommunion, die Ablehnung des Frauenspriestertums, die Stellung zur Homosexualität und manches andere. Wir sind uns sicher einig, dass eine Reform der Kirche nicht darin besteht, sich dem heutigen Zeitgeist anzugleichen, sondern darin, die radikale Nachfolge Jesu voranzubringen. Ich bin jedenfalls der festen Überzeugung, dass wir nur dadurch zu einem tieferen Glauben und zu einer lebendigen glaubwürdigen Kirche kommen. Viele Beispiele der Kirchengeschichte bis in die jüngste Zeit zeigen, dass die bloße Anpassung an jeweils vorherrschende Zeitströmungen nicht zu einem lebendigeren Glaubensleben geführt haben.
Wenn Mitbrüder aus ihrem Dienst ausscheiden, ist das für mich – und sicherlich auch für alle priesterlichen Mitbrüder – eine bedrückende und schmerzliche Erfahrung.Wir fragen nach den Gründen und Ursachen. In diesem Brief kann ich die verschiedenen Gründe nicht aufführen und gegeneinander abwägen. Jedoch wird im Priesterrat wie auch im Diözesan-Pastoralrat ein eingehendes Gespräch darüber erfolgen.
Schon in der Zeit der Aufklärung vor etwa zweihundert Jahren hat es eine heftige Kampagne gegen den priesterlichen Zölibat gegeben. Nachdem etwa vierzig Jahre lang die Angriffe gegen das ehelose Leben um des Reiches Gottes willen – übrigens fast mit den gleichen Begründungen wie heute – stets wiederholt worden waren, schrieb Johannes Adam Möhler ein kleines Buch ‚Vom Geist des Zölibats‘. Er äußert darin sein Auffassung, „dass die neueren Angriffe auf den Zölibat aus einer Zeit stammen, die höchst unkirchlich und unevangelisch war. Wenn sie mit frivolen, geistlosen und wahrhaft stumpfsinnigen Betrachtungsweisen über das gesamte Christen- und Kirchentum aus einer Quelle kamen, so muss dieser Umstand schon einen Gegner der besprochenen Disziplin sehr bedenklich machen“ (Seite 17). Ich empfehle Ihnen dieses Büchlein von Johannes Adam Möhler, das Professor Hattrup von der Teologischen Fakultät Paderborn 1992 mit einem Nachwort im Bonifatius-Verlag neu herausgegeben hat.
Ich darf auch hinweisen auf meine Ausführungen zum Zölibat, die 1993 mit dem Titel ‚Vom Zölibat des Diözesanpriesters‘ ebenfalls im Bonifatius-Verlag erschienen sind.
Gern lege ich Ihnen auch ein bedenkenswertes Wort zur priesterlichen Ehelosig-keit von Bischof Reinhard Lettmann, Münster, bei, den viele Mitbrüder noch in guter Erinnerung haben von den Priesterexerzitien, die er vor einigen Jahren im Leokonvikt gehalten hat.
In einer Zeit, in der eine mit einem Menschen, Gott oder der Kirche eingegan-gene Bindung oder ein Treueversprechen nicht selten nach kurzer Zeit aufgegeben und gebrochen werden und die Fähigkeit des Menschen, sich für ein ganzes Leben etwa an einen anderen Menschen in der Ehe oder aber an Jesus Christus im Versprechen der Ehelosigkeit zu binden, in Frage gestellt wird, sollten wir uns an die mit der Freiheit und damit mit der Würde des Menschen gegebene Fähigkeit erinnern, solche endgültigen Bindungen einzugehen und dazu auch ein Leben lang in Treue zu stehen.
Dabei sind wir uns immer mit dem Apostel Paulus bewusst: „Diesen Schatz tra-gen wir in zerbrechlichen Gefäßen. So wird deutlich, dass das Übermaß der Kraft von Gott und nicht von uns kommt“ (2 Kor 4,7).
Was wird uns helfen, liebe Mitbrüder, in unserem Dienst treu zu bleiben? Ich bin gewiss, die lebendige Gemeinschaft mit dem dreieinen Gott im Gebet und in der Betrachtung täglich zu vertiefen und zu erneuern, gerade auch in Enttäuschung, Schwierigkeiten, Schwächen und Versagen.
Durch gelebte Gemeinschaft als Priester in einem Presbyterium unseres Bistums können wir uns gegenseitig helfen, nicht als isolierte einzelne dazustehen und unseren Dienst zu tun. Es ist hoffnungsvoll, das heute eine wachsende Bereitschaft zur Zusammenarbeit festzustellen ist. Gerade jüngere Priester suchen nach Formen von Zusammenleben, Zusammenarbeiten und geistlicher Gemeinschaften. Ich bitte darum alle, mitzuhelfen, dass unsere jüngeren Mitbrüder im Weihekurs, im Dekanat, in geistlichen Gemeinschaften und Freundeskreisen, im Konveniat sich auf- und angenommen wissen.
Jesus Christus wird den, den er in seine Nachfolge ruft, nicht allein lassen. Er wird ihn auch gerade in seiner Begrenztheit, seiner Schwäche und auch in seinem Versagen mit seiner reichen Gnade mittragen und stärken. Wenn Jesus Chistus uns Anteil gibt an seinem Kreuz und wir selbst – der bei der Priesterweihe an uns ergangenen Aufforderung folgend – unser Leben unter das Geheimnis des Kreuzes stellen, werden wir auch teilhaben an seiner Auferstehung und der österlichen Seite christlicher und priesterlicher Existenz. Quellen der Kraft und der Gnade sind für uns nicht zuletzt das Stundegebet der Kirche und die Feier der heiligen Eucharistie.
Ich bitte Sie auch um Ihr Gebet für geistliche Berufe gemäß der Bitte des Herrn „Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende“ (Mt 9,38). Beten wir aber auch noch mehr füreinander im Presbyterium, wie es schon in den Hochgebeten der heiligen Messe geschieht und vertrauen wir seinem Wort: „Alles, um was ihr in meinem Namen bitten werdet, das wird euch gegeben werden.“ In diesem Vertrauen wollen wir den Herrn rufen, dass er Arbeiter in seine Ernte sende; denn „die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige“ (Mt 9,37).
Abschließend möchte ich daran erinnern, dass die Bischofssynoden 1971 und 1990 die Fragen des priesterlichen Lebens und insbesondere die Beibehaltung des Zölibats eingehend behandelt haben. Im apostolischen Schreiben Papst Johannes Paul II. ‚Pastor dabo vobis‘ sagt er: „Die Synode will bei niemandem den geringsten Zweifel an der Entschlossenheit der Kirche aufkommen lassen, an dem Gesetz festzuhalten, das den zur Priesterweihe nach dem lateinischen Ritus ausersehenen Kandidaten freigewählten ständigen Zölibat auferlegt“ (Artkel 29).
Wir alle sollten uns bemühen, liebe Mitbrüder, dass der Zölibat in seinem vollen biblischen, theologischen und spirituellen Reichtum von uns gelebt und dargestellt wird uns auch erläutert werden kann.
Vereint in der Nachfolge Jesu Christi und in seinem Dienst für das Heil der Menschen grüße ich alle Mitbrüder mit den besten Segenswünschen
Ihr Erzbischof
(gez. + Johannes Joachim)
An Frau Werner:
Das ist unsere Rettung gewesen
In einem Brief an Pater Werenfried van Straaten von ‚Kirche in Not‘ gesteht ein ‚abgefallener‘ Priester dem ‚Speckpater‘ seine tiefe innere Zerrissenheit nach dem Ausscheiden aus dem priesterlichen Dienst und dem Aufgeben des Zölibatgelübdes:
„Nach langem Zögern schreibe ich diesen Brief, um Ihnen zu danken und Sie zu Ihrem Werk zu ermutigen. Früher war ich Ordensmann, jetzt bin ich ein Priester, der sein Amt niedergelegt und geheiratet hat. Ich war einer der vielen, die nicht mehr an den Teufel glaubten. Mit großer Überheblichkeit bin ich gegen mittelalterliche Überlieferungen der Kirche in den Krieg gezogen. Jetzt glaube ich wieder, dass es einen Satan gibt. Ich kann Ihnen sagen, dass ich am Rande des Selbstmordes gestanden bin. Durch die Bekanntschaft mit einem Konvertiten haben meine Frau und ich wieder angefangen, den Rosenkranz zu beten. Das ist unsere Rettung gewesen. Obwohl wir wegen unserer ‚konservativen‘ Glaubenspraxis zum Gespött unserer Angehörigen und Freunde geworden sind.
Diese wenigen Sätze können unmöglich die Tragödie beschreiben, die sich in meiner Seele abgespielt hat. Jeder Tag beginnt für mich mit einem Kampf gegen Verzweiflung, Ekel, Verbitterung, Hass und einem Verlangen nach Einkehr, Buße und Vergebung. Dass Jesus uns in seiner Liebe noch aufsuchen und heimholen wollte, ist für mich ein Wunder seiner unbegreiflichen Barmherzigkeit. Am eigenen Leib habe ich erfahren, was viele ‚progressive‘ Auffassungen in der Theologe aus einem machen können: ein Sohn des Verderbens. Der Papst (Paul VI. – Verf.) hat uns mit Judas verglichen. Meines Erachtens mit Recht, und ich bin ihm dankbar, dass er uns diese harte Wahrheit nicht vorenthalten hat …
Gestatten Sie mir, dass ich mich selbst und meine Schicksalsgenossen einiger-maßen entschuldige: wir waren durch den Satan und durch unseren eigenen Hochmut verblendet. Wir glaubten, der Erneuerung zu dienen, in Wirklicheit haben wir Gottes Haus niedergerissen. Wir glaubten Tabus zu durchbrechen; in Wirklichkeit sind wir Sklaven des Fürsten dieser Welt geworden. Aber wenn ich jetzt alles ehrlich überlege, haben mein Hochmut, meine Sinnlichkeit, mein Mangel an Demut und Gehorsam den Ausschlag gegeben. Gott gebe, dass ich sühnen darf. Ich wünsche nicht, dass uns die Kirche als Priester rehabilitiert, dessen sind wir nicht würdig. Aber ich hoffe, doch noch einmal als Laienbruder in einem strengen Kloster büßen zu dürfen. Jedenfalls hat Gottes Gnade mich nicht verlassen …
Ich bin sicher, dass viele in meiner Lage genau so denken wie ich, aber nicht wagen, es zu äußern. Der Weg zurück ist sehr hart! … Darf ich auf ihr Gebet rechnen? Das haben wir besonders nötig … Sie arbeiten für jene, die sich im Kerker befinden wegen ihrer Glaubenstreue. Denken Sie auch an uns, die wir im Kerker der Untreue gefangen sind …“1
Pfarrer B.M. Weiß schreibt zu diesem Fall im ‚Rundbrif der kleinen Seelen‘: „Ein abgefallener Priester ist immer eine besondere Tragik, weil je höher die Berufung um so tiefer ist das Elend, wenn ihr nicht entsprochen oder sie gar ins Gegenteil verkehrt wird. Und nun bedenken wir die ungeheuerliche Tatsache, die menschlich überhaupt nicht erklärbar ist: nach einer Pressemeldung vom 1.9.1983 haben weltweit 70 000 Priester in der katholischen Kirche nach dem Konzil ihr Amt aufgegeben. [Heute geht man von einer Zahl von 100 000 Priestern aus.] Nur Gottes Augen können ermessen, welcher Schaden dadurch dem mystischen Leib, der Kirche, zugefügt wurde. Denn ‚wer das Priestertum verlässt‘, sagt Paul VI. – mitten in der Krise am 6.8.1971 – vor Klerikern, ‚gibt nicht nur seine eigene Berufung, sein eigenes Versprechen auf, sondern er verlässt auch die Armen; er verlässt all jene, die Anleitung brauchen, die um die Sakramente bitten, er flüchtet vom wichtigsten Posten, den es in der Kirche gibt.‘ Voll Sorge fragen wir uns.
Frau Werner:
Wie kann es soweit kommen? Wo liegen die Hauptursachen für den Abfall der Priester?
Schwere Gefahr droht dem Priester, durch allzu große Anpassung an die Welt, um zum Erfolg zu kommen. Deshalb warnte gleich zu Anfang seines Pontifikats unser Heiliger Vater Johannes Paul II. die Priester in seiner Ansprache am 9.11.1978: ‚Bilden wir uns nicht ein, es wäre ein Dienst am Evangelium, wenn wir unser priesterliches Charisma zu ‚verwässern‘ versuchen durch ein übertriebenes Interesse, für das weite Interesse der irdischen Probleme, wenn wir den Stil unseres Lebens und Handelns verweltlichen, wenn wir auch die äußeren Zeichen unserer priesterlichen Berufung verwischen. Wir müssen uns den Sinn für unsere einzigartige Berufung bewahren, und die Einzigartigkeit muss sich auch in unserer priesterlichen Kleidung zeigen. Schämen wir uns ihrer nicht! Gewiss leben wir in der Welt, doch wir sind nicht von der Welt!“ „Wer Freund der Welt sein will, macht sich zum Feinde Gottes!“ (Jak 4, 4)
Wodurch wurde dieser weltweite Einfluss auf den Klerus ausgelöst? Auf der Bischofssynode in Rom 1983 nannte Bischof Tshibangu Sshishihu aus Zaire (Afrika) als Grund für die „Orientierungslosigkeit der Priester die nachkonziliaren Entwicklungen“! (ebd., Rundbrief 43, S. 25 – 26)
Ein älterer Ordenspriester bemerkte: „Ein Leben nach der Ordensregel war [plötzlich, nach dem II. Vatic.] nicht mehr zumutbar. Man trug Weltkleidung, möglichst bunt und schrill. Man liebte die Tanzfläche, bemühte sich um Damenbekanntschaft, ging mit ihnen zu Gesellschaftsabenden, vergnügte sich in Schwimmbädern und vieles mehr.
Bis zum II. Vatic. Konzil war es üblich, dass die Ordensleute ihren Urlaub bei Verwandten oder in anderen Ordenshäusern verbrachten.
Nun aber waren Weltreisen an der Tagesordnung. Und jeder konnte den als Mitreisenden wählen, der ihm genehm war.
Wen wundert es noch, wenn zigtausende ihr priesterliches Amt aufgaben und heirateten.“ Der Priester fasst das Resultat zusammen: Mehr als die hälfte seines Weihejahrgangs „haben eine Ordenschwester geheiratet“.
Im letzten handelt es sich also um eine Glaubenskrise.
Es ist ein bitterer, doch berechtigter Vorwurf, den Pater Werenfried van Straaten von einem tschechischen Priester hören musste, der zwei Monate durch Westeuropa gereist war. Beim Abschied sagte er ihm: „Ich war 12 Jahre im Gefängnis, weil ich der Kirche treu bleiben wollte. Ich bin gefoltert worden, weil ich den Papst nicht verleugnen wollte. Für den Glauben habe ich die Gesundheit verloren. Aber dieser Glaube war mir die Ruhe und die Sicherheit, die meine Kerkerjahre zu den glücklichsten meines Lebens gemacht haben. Ihr habt die Ruhe in Gott verloren. Ihr habt den Glauben so untergraben, dass es keine Sicherheit mehr gibt. Ihr werft in eurer Freiheit das weg, wofür wir in Unterdrückung leiden. Der Westen hat mich enttäuscht. Ich möchte lieber 12 weitere Jahre in einem kommunistischen Gefängnis leben, als noch länger bei euch bleiben.“
Pater Werenfried fügt noch hinzu: „Dieses Urteil sollte uns zum Nachdenken bringen. Es entspricht der Überzeugung derer, die in Blut und Tränen gereinigt wurden. Jene, die reinen Herzens sind, sehen Gottes Wahrheit besser als die falschen Propheten, die verblendeten Hohenpriester und die stolzen Schriftgelehrten …“
Eben diese unlautere Gesinnung verstärkt heute die Not in der Kirche. Der französiche Schriftsteller Francois Mauriac spricht sie offen aus, wenn er schreibt:
„Ich bin beunruhigt, weil die wahre Krise eine Glaubenskrise innerhalb des Klerus, der lehrenden Kirche, ist, und weil in dieser schweren Krise gewisse Leute, die außerhalb der Kirche sein sollten, in ihr bleiben …“
Aber es ist nicht die Glaubenskrise allein, die über einen Priester hereinbrechen kann, vielmehr kann er auch noch die Feuerprobe einer Zölibatskrise … durchstehen müssen. Es ist hinlänglich bekannt, dass gerade durch die zu große Annäherung an die Welt, sehr viele Priester ihr Versprechen, „um den Himmelreichs willen“ jungfräulich zu bleiben, gebrochen haben. (ebd., Rundbrief 43, S. 25 – 26)
Frau Werner:
Kardinal Stickler über den Zölibat:
Der Klerikerzölibat
Weit verbreitet, nicht nur unter Modernisten, ist heute die Ansicht, der Zölibat sei bloß eine mittelalterliche Rechtsvorschrift der Westkirche. In seinem Buch „Der Klerikerzöilbat (1993) weist Alfons Maria Card. Stickler klar nach, dass der Klerikerzölibat allgemeine Norm der gesamten frühen Kirche war, im Osten wie im Westen. Er geht auf die Apostel zurück, letztlich auf Christus selbst. Dieses Ergebnis der geschichtlichen Forschungen Card. Sticklers, stimmt überein mit anderen Untersuchungen, wie denen von Stefan Heid (Zölibat in der frühen Kirche).
Schon knapp nach dem Jahre 300 bestimmte die spanische Synode von Elvira: Bischöfe, Priester und Diakone müssen sich ihrer Ehefrauen enthalten und dürfen keine Kinder zeugen: wer aber solches getan hat, soll aus dem Klerikerstande ausgeschlossen werden. 390 beschloss das gesamte afrikanische Konzil von Karthago: Bischöfe Priester und Diakone müssen sich des Gebrauchs der Ehe enthalten, wie die Apostel lehrten und gemäß der Überlieferung.
Verheiratete Kleriker mussten sich also nach ihrer Weihe des Gebrauchs der Ehe enthalten. Erforderlich war allerdings vor der Weihe die Zustimmung der Ehefrau. Auch aus Rom liegen aus der frühen Kirche klare Zeugnisse dreier Päpste vor: Siricis (385 – 386), Innozenz (401 – 17) an die Bischöfe Galliens, Leo der Große (465).
Auch aus dem Osten gibt es frühe Zeugnisse für den Klerikerzölibat: Bischof Epiphanius v. Salamis (315 – 403) spricht diesbezüglich von der „von den Aposteln in Weisheit und Heiligkeit festgesetzten Norm“. Ebenso der hl Hieronymus (+ 430 in Palästina).
In der Praxis wurden allerdings die kirchlichen Vorschriften nicht immer und überall eingehalten. Vor allem im Osten ergab sich im 6. und 7. Jahrhundert durch die fehlende zentrale (päpstiche) Gewalt und Aufsicht eine laxe Praxis.
Um diesen Notstand zu rechtfertigen, wurden im Osten auf der Trullischen Synode von 692 in Konstantinopel neue Zölibatsbestimmungen erlassen.
Man berief sich dabei jedoch paradoxerweise auf die Synode von Karthago (390), deren Beschlüsse – so der nun augenfällige Beweis von Card. Stickler – bewusst gefälscht wurden. Sergius I. (selbst aus Syrien, 687 – 701) hat diesen Beschlüssen die Anerkennung verweigert.
Tragisch ist nun, dass die heutigen Zölibatsvorschriften der Ostkirche, die die Fortfürung einer vor der Weihe abgschlossenen Priesterehe erlauben, auf den Beschlüssen des II. Trullanum (samt gefälschten Dokumenten) beruhen.
In einem Brief vom 03. Februar 1996 schreibt Card. Stickler folgende Worte, die eine theologische Sensation (!) darstellen:
… „was die Ostkirche im Trullanum II in bewusster Fälschung getan hat, das hat – für die Diakone – die römische Kirche aus Unwissenheit getan (im Vaticanum II). [Es] würde mich – nach dem Besagten nicht wundern, wenn auch in der Kirche selbst das Schweigen über den Fehler vorgezogen werden würde in der gegenwärtigen Situation und trotz der Tendenz, für die Fehler der Vergangenheit um Verzeihung zu bitten.“
Card. Stickler sagt also ausdrücklich, dass der Zölibat (bzw. die Priesterehe) in der Ostkirche nachweislich auf einer Fälschung gründet, und dass das Diakonat, wie es seit dem II. Vaticanum gehandhabt wird, nicht auf soliden theologischen Fundamenten, sondern – ganz im Gegenteil – auf „Unwissenheit“ gebaut ist. [….] Eines steht […] fest: Der Klerikerzölibat war eine allgemeine Norm in der frühen Kirche; er geht auf die Apostel, ja auf Christus selbst zurück.
Die Ehelosigkeit der Priester ist keine rein kirchenrechtliche Frage. Es besteht ein tiefer Zusammenhang zum Wesen des Priestertums, der Hl. Messe, ja dem Wesen der Kirche. Das wissen die Gegner der Kirche, und das sollten auch wir wissen.