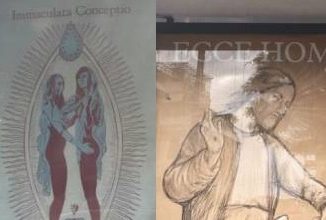1893 war aus finanziellen Gründen und über nicht ganz durchschaubare Empfehlungen dem freimaurerischen Großorient von Italien gelungen, einen Teil des berühmten Palazzo Borghese in Rom anzumieten. Zwei Jahre später konnte Fürst Scipione Borghese eine Klausel im Mietvertrag geltend machen, die es ihm erlaubte, die ganze Immobilie zurückzuerhalten und die ungewöhnlichen Mieter wieder loszuwerden. Als der Fürst die Einrichtungsgegenstände der Freimaurer entfernen ließ, stand man vor einer Tür, die verschlossen war. Nur die Drohung, die Polizei zu rufen und die Tür aufbrechen zu lassen, zeitigte Erfolg. Die damaligen Zeitungen berichteten, was in dem Raum gefunden wurde.

Die Wände waren mit schwarzem und rotem Damast verkleidet. In dem Raum befand sich ein Altar, über dem ein Wandteppich mit einer großen Luzifer-Darstellung hing. Es war eine Darstellung des Lucifer Triumphans. Auf dem Altar befand sich ebenfalls eine Luzifer-Statue umgeben von schwarzen Kerzen. Der Raum wurde von einer Lampe erhellt, die in Form eines dreieckigen Auges von der Decke hing. Vor dem Altar standen mehrere kostbar verzierte Knieschemel für die Anbetung.
Die antiklerikalen Kräfte, unter denen die Freimaurer führend waren, zeigten damals Fahnen und Standarten mit Luzifer-Darstellungen ganz öffentlich, wenn sie auf die Straßen gegen die katholische Kirche agitierten. P. Maximilian Kolbe wurde in Rom als junger Theologiestudent im Herbst 1917 Augenzeuge einer Freimaurer-Prozession.
Eine andere Episode veranschaulicht das antiklerikale Klima, das im damals soeben gewaltsam geeinten Italien herrschte.
A m 7. Februar 1878 war Papst Pius IX., der letzte Monarch des Kirchenstaates, gestorben, der zwischen 1860–1870 stückweise durch die italienischen Truppen und von Giuseppe Garibaldi angeführte Freischaren erobert und zerschlagen wurde. Pius IX. war zunächst in der Gruft der Päpste im Petersdom bestattet worden. Der Papst hatte testamentarisch verfügt, in der Basilika San Lorenzo fuori le mura begraben zu werden. Wegen der kirchenfeindlichen Spannungen, die im neuen Königreich Italien dominierten, war nicht daran zu denken, diesen letzten Willen zu erfüllen.
m 7. Februar 1878 war Papst Pius IX., der letzte Monarch des Kirchenstaates, gestorben, der zwischen 1860–1870 stückweise durch die italienischen Truppen und von Giuseppe Garibaldi angeführte Freischaren erobert und zerschlagen wurde. Pius IX. war zunächst in der Gruft der Päpste im Petersdom bestattet worden. Der Papst hatte testamentarisch verfügt, in der Basilika San Lorenzo fuori le mura begraben zu werden. Wegen der kirchenfeindlichen Spannungen, die im neuen Königreich Italien dominierten, war nicht daran zu denken, diesen letzten Willen zu erfüllen.
Es vergingen drei Jahre, ehe man sich an die Umsetzung wagte. Nachdem alle Vorbereitungen getroffen worden waren, fand in der Nacht vom 12. auf den 13. Juli 1881 in bescheidener Prozession die Überführung des Leichnams statt. Alles sollte möglichst geheim stattfinden, um den Staat nicht zu provozieren und schon gar nicht die Organisationen der Kirchenfeinde, darunter vor allem die Logen. Die Päpste hatten Rom mehr als eintausend Jahre regiert und nun mußten die sterblichen Überreste des letzten Regenten fast schleichend durch die Straßen und Gassen gefahren werden. Nicht ohne Grund. Als der Leichenzug den Tiber überqueren wollte, wurde er von einer Horde erwartet. 300 Kirchenfeinde, mit Stöcken bewaffnet, wollten die Weiterfahrt verhindern. In Sprechchören schrien sie: „Werft das Schwein von Papst in den Fluß“. Sie griffen den Leichenzug an und versuchten den Sarg in den Tiber zu stürzen. Die Katholiken, die den Zug begleiteten, konnten mit Mühe den Angriff abwehren. Soldaten mußten eingreifen, um die Weiterfahrt zu ermöglichen.
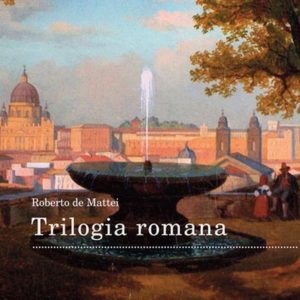
Der Historiker und bekannte katholische Intellektuelle Roberto de Mattei beschreibt dieses Klima in seinem neuesten Buch: Trilogia romana (Römische Trilogie, Verlag Solfanelli, 160 Seiten, 12 Euro). De Mattei wählte dafür nicht nicht die Form einer historisch-wissenschaftlichen Darstellung, sondern die einer Erzählung. Die Freiheit der Erzählung ist jedoch von zahlreichen, kaum bekannten, historischen Fakten und Details durchsetzt. Sie bilden die Grundlage und den Rahmen der Erzählung.
So findet sich darin ein Gespräch zwischen Kardinal Giuseppe Mezzofanti, einem hyperpolyglotten Genie – das 78 Sprachen verstehen, 39 fließend sprechen und 30 fast perfekt schreiben konnte – mit dem Historiker Jacques Crétineau-Joly. Crétineau-Joly war der Historiker der Geheimgesellschaften. Ihm sagte der Kardinal: „Gott ist das Sein, während die Geheimgesellschaften uns beibringen wollen, daß das Nichts das große Geheimnis des Universums ist“.
Aus dem Buch erfährt man, daß die bekannte Pädagogin Maria Montessori ein Verhältnis mit dem Psychiater Giuseppe Montesano hatte. Am 31. März 1898 wurde aus der Beziehung ein Sohn geboren, der jedoch ihre Karrieren störte. Daher verschwand das Kind der „Kinderfreundin“ in einem Heim, registriert als „Kind von unbekannt“. Montessori und Montesano handelten wie ein anderer berühmter Erzieher und „Menschenfreund“, Jean-Jacques Rousseau, der seine Kinder in ein Waisenhaus steckte.

Im neuen Buch von Roberto de Mattei begegnet der Leser auch Annie Besant (1847–1933), die auf Helena Blavatsky an der Spitze der Theosophischen Gesellschaft folgte. Besant war in ihrer Jugend Feministin, Gründerin der Malthusian League für Geburtenkontrolle und Fabian-Sozialistin. Später, nachdem sie Blavatsky kennengelernt hatte, behauptete sie, in einem vorherigen Leben ein Affe gewesen zu sein, der Buddha das Leben gerettet habe und daher in einem nächsten Laben als Mensch wiedergeboren wurde. Sie sei, so Besant über sich selbst, die Wiedergeburt von Giordano Bruno. Im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin verfügte sie aber nicht über Kräfte eines „Mediums“.
Ihr steht eine Dominikaner-Tertiarin gegenüber, Giuseppina Berettoni (1875–1927), die über die Gabe der Bilokation verfügte und direkte Zwiesprache mit der Gottesmutter hielt. Sie verließ ihr Kloster an der Kirche San Carlo al Carso in Rom nie und wurde dennoch an verschiedenen Orten gesehen, wo sie Menschen zu Hilfe kam.
De Mattei schildert auch die Primiz, die erste Heilige Messe, die der Modernist Don Ernesto Bonaiuti (1881–1946), im Jahr 1903 in der römischen Kirche Chiesa Nuova (Santa Maria in Vallicella) zelebrierte. Als Ministrant assistierte ihm der junge Giuseppe Roncalli, sein Jahrgangskollege. Beide hatten zur selben Zeit am Römischen Priesterseminar all’Apollinare studiert. Mit dem Namen Johannes XXIII. sollte Roncalli, als Bonaiuti bereits tot war, den Papstthron besteigen. Bonaiuti war von Msgr. Umberto Benigni, einem erklärten Anti-Modernisten und Gründer des Sodalitium Pianum, als Nachfolger für seinen Lehrstuhl für Kirchengeschichte vorgeschlagen worden. Benigni ahnte nichts von dem Sinneswandel seines Schülers, der die Seiten wechselte und schließlich exkommuniziert wurde.
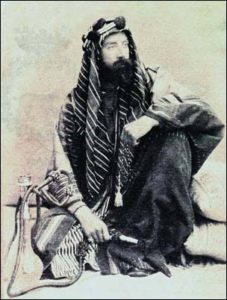
Der eigentliche Begründer des italienischen Modernismus war aber der Priester Salvatore Minocchi (1869–1943). Sein Mitbruder und Freund Don Romolo Murri (1870–1944) war „der Vordenker der damaligen Christdemokratie“ und ein früher Verfechter einer Verbindung von Christentum und Sozialismus. Beide gaben ihr Priestertum auf und ließen sich laisieren. Minocchi heiratete 1911 standesamtlich Flavia Corradini Cialdini, mit der er zwei Kinder hatte. Murri tat es ihm gleich und heiratete im Jahr darauf Ragnhild Lund, die Tochter des norwegischen Senatspräsidenten. Trauzeuge war Fürst Leone Caetani, ein bekannter Islamkundler, dessen Freidenkertum de Mattei zahlreiche Seiten widmet. „Deren Lektüre lohnt sich, um diese beunruhigende Persönlichkeit wirklich kennenzulernen“, so der Publizist Rino Cammilleri.
Text: Giuseppe Nardi
Bild: Corrispondenza Romana/Wikicommons