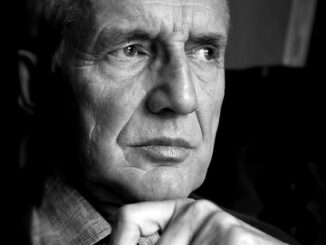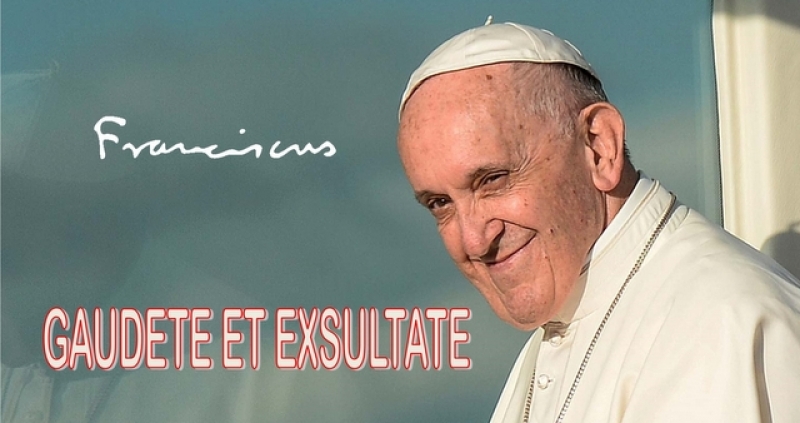
Von Christoph Blath
Katholiken, die dafür eintreten, daß die göttliche Offenbarung voll Ehrfurcht gehört, heilig bewahrt und treu ausgelegt wird, sind Papst Franziskus bekanntlich ein Dorn im Auge. Auf vielfältige Weise sucht er sie auszugrenzen. Eine Option besteht darin, sie als Gnostiker oder Pelagianer zu diffamieren, so auch in dem Apostolischen Schreiben „Gaudete et Exsultate“ (GeE), das am 9. April d. J. veröffentlicht worden ist.
Im 2. Kapitel dieses Schreibens werden der Gnostizismus und Pelagianismus als „zwei Verfälschungen der Heiligkeit“ vorgestellt, „die uns vom Weg abbringen könnten“ (GeE 35). Es handle sich um zwei alte Häresien, „die aber weiterhin von alarmierender Aktualität“ seien“ (Ebda.).
„Der gegenwärtige Gnostizismus“
Besonderes Interesse verdienen die Äußerungen zum „gegenwärtigen Gnostizismus“. Dieser hat übrigens weder etwas mit dem antiken Gnostizismus noch mit dem „Neu-Gnostizismus“ im Sinne des Schreibens „Placuit Deo“ der Glaubenskongregation vom 22. Februar d. J. zu tun, sondern ist eine willkürliche begriffliche Setzung des Papstes.

Sehr aufschlußreich ist GeE 43: „Es gelingt uns kaum, die Wahrheit, die wir vom Herrn empfangen haben, zu verstehen. Unter größten Schwierigkeiten gelingt es uns, sie auszudrücken. Deshalb können wir nicht beanspruchen, dass unsere Art, die Wahrheit zu verstehen, uns ermächtigt, eine strenge Überwachung des Lebens der anderen vorzunehmen. Ich möchte daran erinnern, dass in der Kirche unterschiedliche Arten und Weisen der Interpretation vieler Aspekte der Lehre und des christlichen Lebens berechtigterweise koexistieren, die in ihrer Vielfalt helfen, den äußerst reichen Schatz des Wortes besser deutlich zu machen.“
Vor diesem Hintergrund macht Papst Franziskus den „Gnostikern“ schwere Vorwürfe: Sie stellten sich einen Geist vor, „der in das Korsett einer Enzyklopädie von Abstraktionen geschnürt wird“ (GeE 37); pflegten eine „selbstgefällige Oberflächlichkeit“ und zögen unter dem „Anschein einer gewissen Harmonie oder einer allumfassenden Ordnung“ andere „mit einer betrügerischen Faszination in den Bann“ (GeE 38); glaubten, dass sie mit ihren Erklärungen den ganzen Glauben und das ganze Evangelium vollkommen verständlich machen können“ (GeE 39); strebten danach, „die Lehre Jesu auf eine kalte und harte Logik zu reduzieren, die alles zu beherrschen sucht“ (Ebda.); wollten „es ganz klar und deutlich haben“ und beabsichtigten, „die Transzendenz Gottes zu beherrschen“ (GeE 41); beanspruchten „festzulegen, wo Gott nicht ist“, aber zu Unrecht „weil er geheimnisvoll im Leben jeder Person anwesend ist, im Leben eines jeden, so, wie er will“ (GeE 42).
Dieses „Sündenregister“ ließe sich fortsetzen. Es ist ebenso anmaßend wie die Kritik am „gegenwärtigen Pelagianismus“ (GeE 47–62), läßt aber in Verbindung mit GeE 43 die Intention des Papstes deutlich erkennen: Es geht ihm um nicht weniger als um die Relativierung des Wahrheitsanspruchs der überlieferten Lehre der katholischen Kirche.
Im Widerspruch zu „Dei verbum“
Der Widerspruch zur dogmatischen Konstitution über die göttliche Offenbarung „Dei Verbum“ (DV) des Zweiten Vatikanischen Konzils liegt auf der Hand.
Wie kann uns die Tiefe der durch die Offenbarung erschlossenen Wahrheit in Christus aufleuchten (DV 2) und das Evangelium „die Quelle jeglicher Heilswahrheit und Sittenlehre“ sein (DV 7), wenn wir die vom Herrn empfangene Wahrheit kaum verstehen und nur unter größten Schwierigkeiten auszudrücken können?
Welchen Sinn hat es, daß die Offenbarung „für alle Zeiten unversehrt erhalten“ bleibt (DV 7) und die Nachfolger der Apostel sie „in ihrer Verkündigung treu bewahren, erklären und ausbreiten“ (DV 9), wenn das Wort Gottes mehr oder weniger eine „Quantité négligeable“ ist?
Wozu ist das kirchliche Lehramt gehalten, „das geschriebene oder überlieferte Wort Gottes verbindlich zu erklären“, wobei es dieses Wort „voll Ehrfurcht hört, heilig bewahrt und treu auslegt“ (DV 10), wenn sein Inhalt dem Menschen fast immer verborgen bleibt und der sprachlichen Kundgabe widerstrebt?
Geht es hier noch um den Gott, der einst zu den Vätern durch die Propheten und zuletzt zu uns durch den Sohn gesprochen hat (vgl. Hebr 1, 1–2 a)?
Probleme mit der Logik
Das 2. Kapitel von „Gaudete et Exsultate“ ist auch in anderer Hinsicht eine Zumutung. Denn Papst Franziskus hat Probleme mit der Logik im allgemeinen und der Folgerichtigkeit seiner Äußerungen im besonderen.
So spricht er im Zusammenhang mit den Vorwürfen gegenüber den „Gnostikern“ von der Reduktion der Lehre Jesu auf eine „kalte und harte Logik“.
Ohne Logik gibt es allerdings kein sinnvolles Denken und Sprechen, auch nicht im Blick auf die Lehre Jesu. Da die Logik nicht hintergehbar ist, scheint sie manchmal „kalt“ und „hart“ zu sein. Die Alternative ist jedoch nicht eine „wohltemperierte“ und „weiche“ Logik, sondern die denkerische Willkür, mir der man alles und jedes rechtfertigen kann.
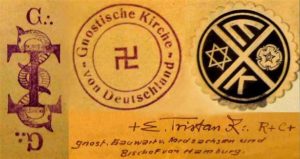
Wenn wir die vom Herrn empfangene Wahrheit angeblich kaum verstehen und nur unter größten Schwierigkeiten auszudrücken können, welchen Sinn hat dann z. B. die Auslegung der acht Seligpreisungen der Bergpredigt (Mt 5, 3–12), die uns im 3. Kapitel (63–109) des päpstlichen Schreibens vorgelegt wird?
In GeE 63 wird gesagt, nichts sei „erhellender, als sich dem Wort Jesu zuzuwenden und seine Art, die Wahrheit weiterzugeben, umfassender zu betrachten“, und Jesus erkläre in den Seligpreisungen „mit aller Einfachheit, was es heißt, heilig zu sein“.
Warum gilt diese erhellende „Einfachheit“ nicht auch für die Rede Jesu vom Ehebruch und der Ehescheidung? Sie findet sich ebenfalls in der Bergpredigt (Mt 5, 27–32), nicht weit von den Seligpreisungen entfernt, und zeichnet sich übrigens – auch ohne „Reduktion“ durch die „Gnostiker“ – durch eine „kalte und harte Logik“ aus!
Diese Inkonsequenz zeigt in aller Deutlichkeit, wohin die Geringschätzung der Logik führen kann.
Abseits einer seriösen Argumentation ist es ebenfalls, wenn es in GeE 43 heißt, daß in der Kirche unterschiedliche Interpretationen „vieler Aspekte der Lehre und des christlichen Lebens berechtigterweise koexistieren“ und sogar „helfen, den äußerst reichen Schatz des Wortes besser deutlich zu machen“.
Wie können unterschiedliche Interpretationen, die alle mit dem Mangel behaftet sind, die zu interpretierende Sache kaum erfassen und sprachlich mitteilen zu können, dazu beitragen, das Wort Gottes besser verständlich zu machen. Mit welchem Recht kann man überhaupt von dem „äußerst reichen Schatz des Wortes“ sprechen, wenn sein Sinn zum größten Teil unerklärlich bleibt. Das Wort Gottes ist in diesem Fall kein Schatz im Sinne von DV 10, sondern wertlos, da es zu kaum etwas zu gebrauchen ist.
„Einheit in versöhnter Beliebigkeit“
Diese Wertlosigkeit kann aber für den modernen Menschen in anderer Hinsicht wiederum ein „Schatz“ sein. Denn in dem Maße, wie das Wort Gottes seine Bedeutung und somit auch seine Verbindlichkeit verliert, eröffnet sich dem Menschen ein Freiraum, in dem er nach eigenem Gutdünken schalten und walten kann. So kann er sich beispielsweise Gott nach seinen eigenen Vorstellungen schaffen und die Moral selber machen. „Aller Dinge Maß ist er Mensch“ hat bereits im 5. Jahrhundert v. Chr. der Sophist Protagoras proklamiert. Dieser alte Menschheitstraum scheint sich jetzt sogar innerhalb der katholischen Kirche zu erfüllen.
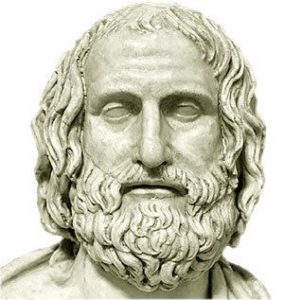
Es versteht sich von selbst, daß dieses Konzept ein gemeinsames Glaubensbekenntnis und einen verbindlichen Moralkodex im herkömmlichen Sinn ausschließt. Denn letztlich gibt es nur noch „unterschiedliche Interpretationen“, d. h. verschiedene Meinungen, die sich auch widersprechen können, in Ermangelung eines verbindlichen Maßstabes jedoch dieselbe Geltung beanspruchen dürfen.
Aufgabe des kirchlichen Amtes ist es dann nur noch, die verschiedenen Meinungen miteinander zu „versöhnen“, d. h. darauf zu achten, daß jeder das Recht des anderen, ebenfalls den Glauben und die Moral selbst zu konfigurieren, toleriert. „Einheit in versöhnter Verschiedenheit“ wird das in der Ökumene genannt. „Einheit in versöhnter Beliebigkeit“ wäre eine treffendere Bezeichnung.
Diese Art von Toleranz meint Papst Franziskus offensichtlich, wenn er in GeE 43 bestimmt: „Deshalb können wir nicht beanspruchen, dass unsere Art, die Wahrheit zu verstehen, uns ermächtigt, eine strenge Überwachung des Lebens der anderen vorzunehmen.“
Der Vorwurf fällt zurück
Diejenigen, die der skeptischen, wenn nicht sogar agnostischen Position des Papstes hinsichtlich des Verstehens des Wortes Gottes widersprechen und den innerkirchlichen Meinungspluralismus ablehnen, also „intolerant“ sind, werden als „Gnostiker“ und „Häretiker“ diffamiert. Das ist eine Ungeheuerlichkeit!

Jesus Christus – so „Dei Verbum“ – ist „zugleich der Mittler und die Fülle der ganzen Offenbarung“ (DV 2). Wenn Jesus Christus „das fleischgewordene Wort“ (DV 4) ist, muß das auch für die Worte Gottes gelten, die er gesprochen hat. Die Väter des Zweiten Vatikanischen Konzils sehen sogar in der ganzen Heiligen Schrift „eine wunderbare Herablassung der ewigen Weisheit“ (DV 13) und stellen fest: „Denn Gottes Worte, durch Menschenzunge formuliert, sind menschlicher Rede ähnlich geworden, wie einst des ewigen Vaters Wort durch die Annahme menschlich-schwachen Fleisches den Menschen ähnlich geworden ist.“ (Ebda.)
Vor diesem Hintergrund stellt derjenige, der behauptet, wir könnten die Wahrheit der Worte Gottes kaum verstehen und nur unter größten Schwierigkeiten ausdrücken, praktisch die Inkarnation der Worte Gottes und somit ein wesentliches Element der Inkarnation überhaupt in Frage.
Die Leugnung der Inkarnation der zweiten göttlichen Person, der „Fleischwerdung“ des „Wortes“ (griech. „lógos“) war übrigens ein zentrales Merkmal der christlichen Ausprägung des antiken Gnostizismus.
Der Gnostizismus-Vorwurf fällt also auf Papst Franziskus zurück – zwar nicht im Blick auf den von ihm postulierten Sinngehalt, wohl aber wegen der Nähe zur ursprünglichen Bedeutung des Begriffs. Insofern ist der Gnostizismus tatsächlich „weiterhin von alarmierender Aktualität“.
Bild: Diocesis de Gaudix/Wikicommons/Ortodoxia (Screenshots)