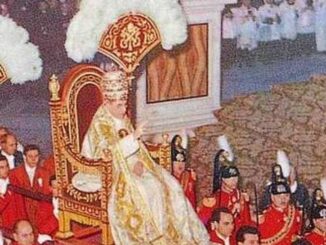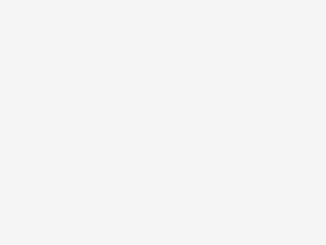Gastbeitrag von Felix Lanz
Das Katholische Sonntagsblatt, die „Kirchenzeitung der Diözese Bozen-Brixen“ veröffentlichte am 16. April den Artikel „Fürbitten im Geiste des Konzils“. Im Vorspann heißt es:
„Nirgends spiegelt sich das neue Verhältnis des Zweiten Vatikanischen Konzils zu anderen Religionen, zu den Juden und den Heiden deutlicher wider als bei den großen Fürbitten am Karfreitag.“
Was hier am „Rand“ des deutschsprachigen Raums geschrieben wurde, spiegelt die derzeit, offiziell vorherrschende Meinung im katholischen deutschen Sprachraum wider.
Der Mainstream-Theologe Paolo Renner

Der Artikel ist gezeichnet mit dem Kürzel „pr“. Es steht für Paolo Renner. Renner ist Professor für Fundamentaltheologie und Religionswissenschaft an der Theologisch-Philosophischen Hochschule Brixen, an der auch die Seminaristen der Diözese ausgebildet werden. Zuletzt war er Dekan der Hochschule, derzeit ist er Prodekan. Nach seinem Studium an der Gregoriana wurde Renner 1985 zum Priester geweiht. Kurz darauf übernahm er die Leitung einer „Basisgemeinde“ in Meran, der er seit seiner Jugend angehörte. Seit 2009 ist er zudem Direktor des „Ökumenischen und Interreligiösen Instituts für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung“, einer jener kirchlichen Zeitgeist-Einrichtungen, denen ein Wortschwall zu sozialen Fragen, zugunsten von Masseneinwanderung und Islam sowie ökologischen und anderen Themen des linksgrünen Spektrums einfällt, aber nichts zum himmelschreienden Unrecht der Abtreibung.
Als Mainstream-Theologe weiß Renner natürlich auch etwas zum Verhältnis zwischen Christentum und Judentum zu sagen, was er im genannten Artikel anhand der großen Karfreitagsbitte für die Juden tut.
„pr“ schreibt darin:
„Diese neue Bitte ist vorsichtig formuliert. Sie nimmt Rücksicht auf die vom Konzil erneuerte Lehre von der Gültigkeit des ersten Bundes.“
Es folgt ein (obligater) Seitenhieb gegen die Tradition:
„Leider klingen in der seit 2007 zugelassenen ‚außerordentlichen Form‘ des römischen Ritus die alten Töne wieder an. Hier wird darum gebetet, dass ‚unser Gott und Herr ihre Herzen erleuchte, damit sie Jesus Christus als Retter aller Menschen erkennen‘.“
„pr“ dazu:
„Das hat heftige Reaktionen ausgelöst. Viele Juden fragten mit Recht, ob sie um ihres Heiles willen verpflichtet seien, an Christus als Erlöser aller Menschen zu glauben.“
Renner: Juden müssen für ihr Heil „nicht an Christus als Erlöser aller Menschen glauben“
Renner macht sich die jüdische Position vorbehaltlos zu eigen. Wer nicht weiß, von wem diese Kritik an der in der außerordentlichen Form des römischen Ritus enthaltenen Karfreitagsbitte stammt, würde kaum erraten, daß sie aus dem Mund eines Christen kommt. Ein seltsames Verhalten für einen Theologen, Priester und Ausbilder künftiger Priester.
Es geht noch weiter:
„Die von Papst Paul VI. vorsichtige Formulierung gilt weiterhin als ‚ordentliche Form‘ des römischen Ritus. Für die ‚Erleuchtung‘ der Juden zu beten, ist deshalb in der heutigen Zeit mit einer gewissen Anmaßung verbunden. Da ist der Gedanke nicht weit, ‚Bekehrung‘ sei für die Juden notwendig, damit sie zum Heil gelangen.“

Spätestens an dieser Stelle, mit all ihren Konjunktivformen, bleibt man fast sprachlos. Redet so ein katholischer Priester? Für das Heil eines anderen Menschen zu beten ist eine „Anmaßung“? Auch in diesem Fall macht sich Renner unkritisch die jüdische Position zu eigen. Er spricht nicht als Priester, nicht als Theologe, nicht als Christ. Die Identifikation mit dem Objekt seiner Darstellung scheint „perfekt“. Ist das das Ziel einer „interreligiösen“ Camouflage? Renner versteigt sich faktisch zur Behauptung – ohne jede Distanz, ohne jede Kritik, ohne jedes Hinterfragen -, daß es mindestens zwei Heilswege geben muß: einen christlichen Heilsweg mit Christus und einen jüdischen Heilsweg ohne Christus.
Das Gegenteil lehren die Heilige Schrift und die kirchliche Überlieferung. Christus ist ausdrücklich Mensch geworden, um die Juden zur Bekehrung zu rufen. Wenn dem nicht so wäre – dem ist aber so – war es geradezu absurd, daß er ausgerechnet unter den Juden und als Jude Mensch geworden ist. Seine Reden über die Hartherzigkeit und Umkehr richteten sich ganz konkret vor allem an die Juden. Er ging in die Synagogen und in den Tempel von Jerusalem. Er ging nie in irgendeinen Heidentempel. Gleiches taten seine Jünger, bis die Pharisäer, die nach der Zerstörung des Tempels die Kontrolle im Judentum übernahmen, sie um 100 nach Christus in der Synode von Jamnia endgültig aus der Synagoge ausschlossen.
Renners Geschichtstheologie: „Nach dem Holocaust …“
Renner ist damit noch nicht am Ende seiner befremdenden Ausführungen. Wie begründet er einen jüdischen „Heilsweg“ ohne Christus? Mit einem saloppen, aber bedingungslosen Diktum:
„Nach dem Holocaust verbietet sich aber für Christen jede Form von ‚Judenmission‘.“
Renner schreibt willkürlich einem schrecklichen, historischen Ereignis, das sich irgendwann in der Geschichte, irgendwo auf der Welt ereignet hat, eine heilsgeschichtliche Bedeutung höchst zweifelhafter Art zu. Die Aussage des getauften Katholiken, gefühlten Juden, politischen Marxisten und praktizierenden Atheisten Theodor Adorno „Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch“ (1949) ist in der Sache dümmlich und substanzlos, mag aber als subjektive Meinung im Raum stehen. Renners Behauptung, „nach Auschwitz“ hätten Christen sich nicht mehr für die Bekehrung und das Seelenheil anderer Menschen einzusetzen, jedenfalls nicht mehr für die Juden, ist vertikal von einer schrecklichen Hartherzigkeit und horizontal geradezu blasphemisch. Sie richtet sich direkt gegen Christus und sein Kreuzesopfer, und sie richtet sich direkt gegen die (jüdischen) Mitmenschen.
Hat der Nationalsozialismus das Heilswerk Jesu Christi annulliert?
Annulliert ein 1900 Jahre nach Christi Tod am Kreuz im Namen einer neuheidnischen Ideologie, des Nationalsozialismus, verübtes Verbrechen das Heilswerk Jesu Christi? Laut Renner offenbar schon. Damit spricht er dem Nationalsozialismus nachträglich heilsgeschichtliche Bedeutung zu. Das hätte Hitler in seinem „Vorsehungs“-Denken zwar gefallen, trifft die Sache aber wohl kaum. In der Heiligen Schrift finden sich weder Nationalsozialismus noch „Holocaust“. Dieses Verbrechen läßt sich vielleicht auch geschichtstheologisch deuten, allerdings dann ganz anders, nämlich im Kontext von Sünde und Ablehnung Christi – der Weg, Wahrheit und Leben ist (Joh 14,6).
Der „Holocaust“ spaltet – folgt man Renner – die Erlösungstat Christi auf in einen auch nach dem „Holocaust“ gültigen Teil für … ja, für wen, für die Christen, die Heiden, die Nicht-Juden (?) …, und einen nach dem „Holocaust“ nicht mehr gültigen, annullierten, aufgehobenen Teil. Denn „nach dem Holocaust“ gilt die Heilstat Jesu, so Renner, für die Juden jedenfalls nicht mehr. Renner legt hier eine geradezu abstruse „Geschichtstheologie“ vor.
Oder ist Renner gar der Meinung, daß Menschwerdung, Lehre, Leiden, Tod, Auferstehung und Himmelfahrt Christi nie für die Juden galten? Das wäre ein nicht minder abschüssig-schlüpfriges Terrain, weil seit der Verkündigung des Erzengels Gabriel an die Jungfrau Maria alles in der Menschheitsgeschichte dagegen spricht.
„Wir haben den Messias gefunden“
Renner will offenbar, so sein bestreben, als besonderer Freund der Juden auftreten, das ehrt ihn, entpuppt sich in Wirklichkeit aber als das genaue Gegenteil. Natürlich bedürfen auch die Juden des Heils wie jeder andere Mensch auf dieser Welt. Sie warten 2000 Jahre nach Christi Tod noch immer auf die Ankunft des Messias. Der Tod führt sie weiterhin nur hinab ins Reich der Toten. Die Auferstehung ist ihrem eigenen Verständnis fremd. Jesus ist für die gesamte Menschheit in die Welt gekommen, aber – und das ist eine historische Tatsache – ganz konkret inmitten der Juden und als Jude. Das kann auch Renner nicht auslöschen.
Das jüdische Volk hat sich durch die Menschwerdung Gottes gespaltet in jene, die den Messias erkannt haben und in jene, die ihn ablehnten und bis heute ablehnen. Der künftige Apostel Andreas, so berichtet das Johannesevangelium bereits im Ersten Kapitel, eilte zu seinem Bruder Simon, dem späteren Apostel Petrus, um ihm außer Atem zu berichten:
„Wir haben den Messias gefunden“ (Joh 1,41).
Beide waren Juden. Die tonangebende Elite, der damalige jüdische Mainstream, ließ Christus aber ans Kreuz schlagen. So wie die Protestanten sich aus der Ablehnung der katholischen Kirche definieren, definieren sich die Juden auch heute aus der Ablehnung Christi. Das Kreuz ist den Juden ein „Ärgernis“ und den Heiden eine „Torheit“, sagt die Heilige Schrift. Renner macht sich diese Haltung zu eigen, indem er es als Ärgernis darstellt, daß Christen für die Bekehrung der heutigen Juden beten, die Nachkommen jenes Teils des alten Volkes, das Christus abgelehnt hat, damit auch sie, wie der andere Teil des alten Volkes, aus dem Jesus alle Apostel und die ersten Jünger berief, Christus erkennen und das ewige Seelenheil erlangen.
Jesus: „Niemand kommt zum Vater außer durch mich“
Denn es gibt nur einen Heilsweg für den Menschen, ob Jude oder nicht, und der heißt Christus. Jesus sagt ausdrücklich:
„Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater außer durch mich“ (Joh 14,6).
Er sagt nicht, niemand – außer die Juden – kommt zum Vater außer durch mich. Allein die Vorstellung ist absurd, da er fast nur von Juden umgeben war. Seine Worte richtet Christus an alle Menschen zu allen Zeiten, damals aber stand ganz konkret nicht irgendwer vor ihm, sondern ein vorwiegend jüdisches Publikum. Die Aussage bedeutet: „Niemand“ erlangt das Heil ohne Christus. Einen Heilsweg ohne Christus gibt es nicht.
Für das Heil anderer Menschen zu beten, ob Juden, Heiden, Ungläubige, Gottlose, schlechte Christen, ist ein Werk der Barmherzigkeit. In der „Anmaßung“, die Renner der Karfreitagsbitte für die Juden unterstellt, spiegelt sich letztlich jene Ablehnung wider, die Christus vor 2000 Jahren erfahren hat und seit 2000 Jahren erfährt. Renner spricht zwar nicht für sich, rechtfertigt aber die Ablehnung Christi durch andere. Macht das die Sache besser?
Ein Freund der Juden sein, heißt, sie – wie jeden anderen Menschen – zu Christus hinzuführen, für Christus zu gewinnen, für ihr Heil und ihre Erleuchtung zu beten. Diese Barmherzigkeitstat im Namen einer fiktiven „Irreligiosität“ und einer abwegigen Geschichtstheologie abwürgen zu wollen, kommt im besten Fall einer Unterlassungssünde gleich, im schlimmeren Fall aber …
Bild: Autor/Sonntagsblatt/Neue Südtiroler Tageszeitung (Screenshots)