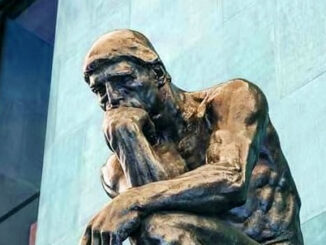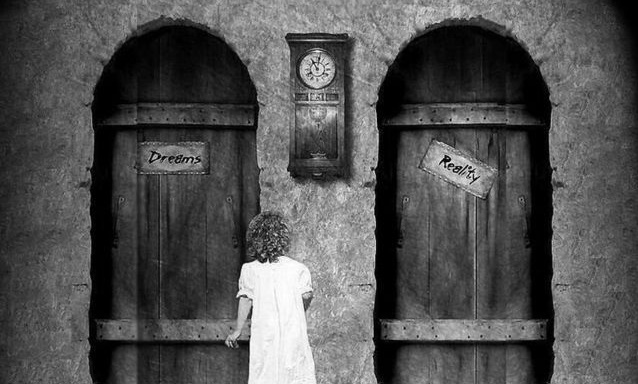
von Endre A. Bárdossy* (1)
„Man darf nichts Unmögliches wollen.“
(Ignatius von Loyola)
Einleitung
Das vorangestellte Lemma des hl. Ignatius müßte man heutzutage weniger als Aussage, sondern vielmehr als Fragesatz bedenken: Darf eine für unmöglich gehaltene, antiquiert empfundene Sache oder Haltung wirklich nicht mehr von den Christen verlangt werden? Können wir in der einen, globalisierten Welt mit liberalen Grundsätzen und einem autonomen Gewissen nach Jesuitenart unterscheiden und entscheiden, was noch gerade innerhalb der möglichst schwere- und substanzlosen Alternativen zu ertragen sei? Entsagung, Buße, Sühne, Opfer sind in der Überflußgesellschaft, aber auch in der modernistischen Kirchensprache Fremdwörter geworden.

Als ich einem hochgebildeten, progressiv denkenden, intellektuellen Katholiken die vage Andeutung machte, daß ich gerade über die „Unterscheidung der Geister“ Nachforschungen anzustellen gedenke, blickte er mich nachsichtig, beinahe mit Beileid an: „Aber laß das Thema! In der Welt von morgen…, in den Wissenschaften…, in der Ökumene…, [und dann zu allem Unglück!] in der Union von Jean-Claude Juncker und Angela Merkel werden die alten Gegensätze abgetragen! Überholte Grenzen werden aufgehoben, Definitionen werden ad acta gelegt, die Dogmen geglättet – wozu soll die Trennung der Geister noch gut sein, wenn wir in Freiheit und Gleichheit verbrüdert sind?“
Ein anderer konservativer, getreuer Katholik meinte dagegen bloß, als ich ihm mein Ansinnen erwähnte, daß er sich in diesem Fragenkreis nicht auskennt.
Hie und da ist also das Wissen klein und das Interesse kümmerlich. In dieser dünnen Luft wird unter Modernisten das Geschäft der „Unterscheidung der Geister“ eher noch den „charismatischen“ Pfingstlern und dem Jesuitenpapst überlassen. Bergoglio und seine Konsorten werden in einem grundsätzlich dogmen- und traditionsfreien Vakuum nicht müde, die Kaspersche Relativitätstheorie, die Rahnersche Situationsethik sowie die Schönbornsche Hypothese der Gradualität jenseits des schlichten Guten zu untermauern.
Aus aktuellem Anlaß mußte Katholisches.Info gleich dreimal Haarsträubendes berichten. Wozu sich der Jesuitenpapst und seine Generäle hinreißen lassen, brauchen wir aus Platzgründen an dieser Stelle nicht alles wiederholen. Der geneigte Leser kann selber die Skandalgeschichten nachschlagen, die unter anderem binnen eines kurzen Zeitraums von 10 Tagen wie folgt verliefen:
- 13. Februar: Adolfo Nicolás Pachón S.J., der abgetretene Ex-General, erklärt, daß die Evangelisierung Japans nur durch eine Allianz mit dem Buddhismus und Schintoismus möglich sei;
- 17. Februar: Päpstliche Anpassung an das lutherische Gewissen ohne kirchliche Normierung;
- 22. Februar: Der aktuelle General, Arturo Sosa Abascal S.J., will Jesus neu interpretieren… Nach seinen eigenen Worten mag er das Wort Glaubenslehre nicht besonders.
Was können wir von Jesuiten erwarten, wenn sie die Glaubenslehre nicht mögen? Dabei plaudert der immer noch einflußreiche Adolfo Nicolás Pachón redselig wie folgt weiter:
Adolfo Nicolás Pachón: Der „Schlüssel dieses Pontifikats“ ist die „Unterscheidung“, das habe Papst Franziskus gegenüber den polnischen Jesuiten angemahnt. Es brauche mehr „Vorbereitung“ für die Unterscheidung. Es gebe noch zu viele, die der Meinung seien, daß der Wille Gottes schon feststehe, der aber sei „offen“ [?!]. Das habe zur Folge, daß das „Licht in anderen Religionen immer als Schatten gesehen“ [?!] werde, „und das bringt uns einige Probleme“. Dazu gehöre es „zu verstehen, daß die anderen Religionen das Beste sind, das uns eine Kultur bieten kann [?!]. Die asiatischen Kulturen zum Beispiel haben den Buddhismus hervorgebracht: Das ist ihre beste Frucht [?!]. Und doch gab es eine Zeit, da wir dachten, und ich dachte es auch, daß diese Religion ein Produkt des Teufels sei, in Wirklichkeit ist sie das Werk des Geistes [?!]. Heute verstehen wir das besser.“
Frage: Wie aber könne man unterscheiden, welche Teile einer Religion „ein Produkt der Menschen und welche göttliche Bewegungen sind“, will [der fragende Journalist der…] Wochenzeitung [Alfa y Omega] vom ehemaligen Jesuitengeneral wissen:
Adolfo Nicolás Pachón: „Die Synthese liegt in den menschlichen Beziehungen [?!]. Darüber denke ich viel nach: Wenn ich nach Asien reise, fühle ich mich in Hong Kong, Bangkok oder Tokio sofort zu Hause, während ich mich in Europa nicht zu Hause fühle. [Wie schade!!]“
In Anspielung auf das Herrenwort „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“ sagte Nicolás Pachón:
Europa stütze sich „in seinen Beziehungen vielleicht auf die Wahrheit“. Die Religionen Asiens „sind der Weg“ [?!]. Die Missionare seien nach Asien gekommen und hätten von der Wahrheit gesprochen, aber die Menschen nicht getroffen. Asien sei der Weg, während Europa und die USA sich um die Wahrheit sorgen „und wie sie definieren“. Lateinamerika und Afrika hingegen seien „das Leben“ [?!]
„Inhaltsanalyse“ nennt man das Verfahren, wenn man statistische Überlegungen über die Verteilung und Häufigkeit der fixen Ideen anstellt, die in einem ideologisch belasteten Diskurs das tragende Gerüst darstellen. So zum Beispiel untersuchte der amerikanische Geheimdienst seinerzeit Hitlers Reden, um aus der Konzentration der Wortwahl möglicherweise einige Rückschlüsse auf kommende Tathandlungen zu ziehen. Die Denk- und Ausdrucksweise eines jeden Entscheidungsträgers ist ein verläßliches Menüblatt seiner künftigen Handlungsspielräume – aber auch ein probates Mittel für die Gehirnwäsche der Zuhörer. Die absonderlichen Ansichten von Pater Nicolás Pachón verdienten wohl so dringend wie möglich eine eingehende Inhalts- und Gewissensanalyse!
Die schäkernden Schlagworte der Verwirrung

Für das leichtfertige Tändeln mit Gottes Barmherzigkeit sind „Unterscheidung, Mündigkeit, Autonomie, Gewissen, Offenheit“ die Schlagworte, welche für eine allgemeine Verwirrung unters Volk gestreut werden. Das Lehramt wird kleingeredet. Das Triumvirat Bergoglio, Kasper, Reinhard Marx – stets vom einstimmigen Chor der modernistischen Jesuitenkompanie begleitet –, überrascht uns beinahe schon täglich mit den neuesten Gags. Aus dem Vatikanischen Presseamt, den Medien der Deutschen Bischofskonferenz und aus den lockeren Interviews von höchsten Stellen erfahren wir laufend etwas Sensationelles. Brauchen wir einen Eugenio Scalfari, der seines Zeichens Freimaurer und Chefredakteur der linken italienischen Zeitung La Repubblica ist, als Interpreten des päpstlichen Lehramtes? Dürfen wir uns auf die zweideutigen Dementis von Pater Federico Lombardi S.J. oder Pater Antonio Spadaro S.J. verlassen? Was nützt uns die „Offenheit“ von Pater Adolfo Nicolás Pachón S.J., wenn er sich für die Wahrheit nicht interessiert? Wenn er für die grauslichen Gestalten des Buddhismus und Schintoismus mehr übrig hat als für die griechisch-römische Überlieferung? Um die Wahrheit muß es ja gehen, sonst ist alles andere sinnlos.
Auch ein Nichtfachmann in Theologie, wie meine Wenigkeit, merkt dabei den Pferdefuß und möchte meinen, daß Ìñigo López Oñaz de Recalde y Loyola, ein Edelmann, Soldat und Ordensgründer aus dem Baskenland, sich wohl wundern müßte über die Weichlinge, die zur Zeit in seinem Generalat schalten und walten. Vielleicht sind aber die Nachfolger dieses wahrhaft Heiligen gar keine „Weichlinge“, sondern knallharte Konspiratoren, persönlich durchaus asketisch und arbeitsstark.
Die Problemstellung
Die Unterscheidung der Geister ist ein Schlüsselbegriff bei Johannes mit der breit gefächerten existentiellen Aufforderung „…prüfet die Geister“ (1 Joh 4,1–6) zwecks kritischer Differenzierung von Gedanken und Gefühlsregungen, ob sie wirklich von Gott stammen oder nicht. Aber auch im Ersten Korintherbrief (12,8–11) gilt das Unterscheidungsvermögen als eine der dramatischsten, charismatischen Gaben, die seit den ersten, vom hl. Paulus selbst gegründeten Gemeinden bis heute für Hochspannung sorgen. Aber gerade an dieser sensiblen Stelle setzt eine große Verwirrung ein. Daher ist es ratsam, das deutschsprachige Zitat aus dem Ersten Korintherbrief direkt mit der Vulgata – die bis heute gültige lateinische Vollversion der Bibel, welche nach 382 entstand, – in der Sprache des hl. Hieronymus zu vergleichen:
8 ALII QUIDEM PER SPIRITUM DATUR SERMO SAPIENTIÆ
ALII AUTEM SERMO SCIENTIÆ SECUNDUM SPIRITUMDem einen nämlich wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben,
einem anderen dagegen das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. (2)9 ALTERI FIDES IN EODEM SPIRITU
ALII GRATIA SANITATUM IN UNO SPIRITUEinem andern der Glaube in dem nämlichen Geist,
einem andern wieder Heilungsgaben in ein und demselben Geist.10 a) ALII OPERATIO VIRTUTUM
b) ALII PROPHETATIO
c) ALII DISCRETIO [!] SPIRITUUM
d) ALII GENERA LINGUARUM
e) ALII SERNONUMa) Wieder einem andern die Gabe, Wunder zu wirken,
b) einem andern die Prophetengabe,
c) einem andern Unterscheidung [!] der Geister,
d) einem andern mancherlei Zungenrede,
e) einem andern die Auslegung der Zungenreden.11 HAEC AUTEM OMNIA OPERATUR
UNUS ATQUE IDEM SPIRITUS
DIVIDENS SINGULIS PROUT VULT.All das aber wirkt
der eine und selbe Geist,
indem er jedem nach seiner Eigenart zuteilt je nachdem, wie er will.
Aus diesem Staccato einer kurz hingespielten lateinisch-deutschen Übersetzungsübung geht bereits unser Grundproblem der „Discretio spirituum“ hervor. Jedermann weiß, was Diskretion heißt: Verschwiegenheit, Taktgefühl, Rücksichtsnahme. Indiskretion ist dagegen ein takt- und rücksichtsloses Gerede mit bösen Zungen. Andererseits „Unterscheidung“ heißt schlicht und einfach Differenzierung. Wie sollen aber Diskretion und Differenzierung deckungsgleich übereinstimmen? Es klingt in unseren Ohren doch merkwürdig nach, ob der Hl. Geist an dieser Stelle wirklich nur etwas diskret Verschwiegenes oder etwas tiefer Greifendes kundgeben wollte, das Welt- und Heilsgeschichte gemacht hat. Die Diskrepanz mag uns bereits im Deutschen spontan auffallen. Noch gröber wird jedoch der Verdacht einer unpräzisen Übersetzung, wenn man im Spanischen an der betreffenden Stelle (1 Kor 12,10) noch einmal etwas anderes lesen kann:
c) EL SABER DISTINGUIR [!] ENTRE LOS ESPÌRITUS FALSOS Y EL ESPÌRITU VERDADERO: (3)
Anstelle der Diskretion oder Differenzierung der Geister
steht hier das „Distinguieren können zwischen den falschen Geistern und dem wahren Geist“.
d) EL HABLAR LENGUAS EXTRAÑAS:
Anstelle mancherlei Zungenredens
steht hier das „Sprechen mit sonderbaren Zungen (= Sprachen)“.
e) EL SABER INTERPRETARLAS:
Anstelle der Auslegung des Zungenredens
steht hier die Auslegung (= Interpretation) der sonderbaren Sprachen.
Selbstverständlich können wir Bibeltexte nur unter der Voraussetzung einem idiomatischen Vergleich unterziehen, wenn sie alle katholisch approbiert sind. Dabei müssen wir verwundert zugeben, daß nicht nur die Verfasser sondern auch die Übersetzer unter der besonderen Ägide des Hl. Geistes stehen, wenn sie der menschlich unerfüllbaren Aufgabe, in Hunderten Idiolekten übereinstimmend dasselbe zu sagen, erfolgreich entsprechen können. Sprachbedingte Nuancen (nicht Irrtümer!) können freilich auftreten.
– So wirkt im Deutschen das Item d etwas befremdend, weil der bereits allzu abgegriffene Topos von „mancherlei Zungenrede“ (anstelle „einer sonderbaren Sprache“, Diskurs, Mundart oder dergleichen) den Sinn der Aussage völlig verstellt.
Das spanische Item d „HABLAR“ (sprechen) „LENGUAS EXTRAÑAS“ (mit sonderbaren Zungen) ist dagegen ein unmittelbar verständlicher Volltreffer der Sache, da in den meisten Sprachen das entsprechende, homonyme Wort zugleich „Zunge & Sprache“ bedeutet. Zum Beispiel: „lingua ± / glossa“, lat. „lingua“, spanisch „lengua“, englisch „tongue“, ungarisch „nyelv“. Viel seltener gibt es dagegen, – zum Beispiel im Schwedischen wie im Deutschen, – eine punktgenaue Differenzierung zwischen „tunga“ und „språk“.
Das barbarische Theologen-Kunstwort „Zungenrede“ ist eine deutsche Pedanterie der buchstabengerechten Übersetzung, denn Glossalgie (Lingua ±, eine unmäßige Geschwätzigkeit, Redseligkeit) oder Glossolalie, d. h. mit verschiedenen Zungen zu reden besagt nicht, den Verstand mit lallendem Blabla zu verlieren, – wie dies die Pfingstler, aber auch andere Leute mit großer Vorliebe tun, – sondern lediglich zu einer anderen „Zunge“ (= Sprache oder Mundart) zu wechseln, deren Sinn bewußt oder unbewußt, gewollt oder ungewollt verdeckt werden kann. So verlieren die Lallenden meist doch nicht den Verstand. Man hat öfter den Eindruck, daß sie eine bewußte Show abziehen.
Wir wechseln nicht nur von einer Fremdsprache zu einer anderen Fremdsprache im engeren Sinne, wie vom vertrauten Deutschen zu etwas, was uns völlig „spanisch“ (unverständlich) vorkommt, sondern öfters noch zu etwas, was auch innerhalb ein und derselben Sprache die „Zungen“ aufs Kreuz legt: Goethe spricht Deutsch, Hitler spricht Deutsch – sie sprechen dennoch verschiedene Sprachen! Freilich, selbst Goethe, Fidel Castro, Jean-Claude Juncker oder Angela Merkel brauchen Interpreten für die Auslegung ihrer politischen „Zungenreden“ (Mundarten; 1 Kor 12,10 cf. die Items d–e). Damit hätten wir dieses nebulöse Wort für unsere Zwecke zureichend geklärt.
– Das Item c bleibt jedoch auch (bei der vorausgesetzten Irrtumsfreiheit aller katholischen Übertragungen) weiterhin schwer erklärungsbedürftig und erfordert eine intensivere Nachforschung. Unsere Frage lautet: Dürfen die bibelkundigen Theologen und Übersetzer für einen und denselben Topos so auseinanderstrebende Worte verwenden wie Diskretion, Unterscheiden, Distinktion?
Die Sprache ist das Erinnerungsvermögen der Völker
Ich bin kein Philologe, habe mir aber das Spanische im Erwachsenenalter analytisch-grammatisch, also mehr lesend-schreibend-denkend mit großer Hingabe, Begeisterung, und weniger im platten Plauderton angeeignet. Das kleine Latein aus dem Realgymnasium war dabei natürlich mein ständiger Begleiter. Daher fühle ich mich auf meine alten Tage autorisiert, folgendermaßen zu argumentieren und zu hoffen, daß meine Deutung sowohl für die Fachleute aus Theologie wie aus Philologie, und mehr noch für einfache Laien – wie ich selber einer bin – stichhaltig genug sei. Glücklicherweise stimmt das betreffende spanische Vokabular etymologisch mit seiner griechisch-lateinischen Herkunft klar und deutlich überein. Somit möchte ich versuchen, meine schlichte Erfahrung aus dem Spanischen ins Griechisch-Lateinische rückversetzt so vorzutragen, daß sie einer deutschsprachigen Leserschaft, wenn sie die zureichenden Klassiker auf Maturaniveau noch nicht vergessen hat, verständlich wird. Die Stammworte für unsere Untersuchung lauten: (4)
I.) κρίσις‚ (krisis)
- Scheidung, Zwiespalt, Streit;
- (Aus)wahl;
- (gerichtliche) Entscheidung, Untersuchung, Urteil, Verurteilung.
κρίμα (krima)
- richterliche Entscheidung, Urteil;
- Rechtshandel, Verurteilung.
κρίμνον (krimnon) / grob geschrotenes, gesiebtes Mehl.
κρίνω (krino)
I. act. 1. scheiden, sondern, sichten, unterscheiden;
2. (ab‑, aus-)sondern, auswählen;
3. entscheiden, beschließen, richten, (ver)urteilen.
II. med. für sich auswählen, auslegen, deuten.
III. pass. 1. ausgewählt, beurteilt, entschieden werden;
2. vor Gericht gestellt, zur Verantwortung gezogen werden;
3. sich sondern, sich messen im Kampf oder vor Gericht.
II.) διά-κρισις (dia-krisis)
- Trennung, Sonderung, Zwischenraum;
- Unterscheidung, Entscheidung, Beurteilung.
διακριτικός (diakritikos) / der Kunst der Unterscheidung dienlich.
διακριτός (diakritos) / unterschieden, ausgezeichnet.
διακρίνω (diakrino)
- scheiden, sondern, trennen;
- unterscheiden, vorziehen;
- (be)urteilen, entscheiden
- pass. geschieden werden… etc.
Der griechischen Wortsippe Krisis entsprechen die lateinischen Verben cernere und de-cernere nach den bekannten Grundformen Präsens, Infinitiv, Perfekt und Partizip: (5)
I) cerno, cernere, crevi, cretus:
1. scheiden, sondern, sichten;
2. (deutlich) sehen, wahrnehmen, (geistig) erkennen; (Passiv erkannt werden, sich zeigen);
3. entscheiden, beschließen, kämpfen (pro patria, vitam / um das Leben);
II) decerno, decernere, decrevi, decretus
4. verordnen, anordnen, beschließen, entscheiden, (im Kampf, Streit) die Entscheidung herbeiführen;
Im Spanischen behielt das Verb cerner (oder cernir) die einzige Bedeutung „trennen durch ein Sieb, sieben“. Die ursprüngliche Infinitivform decerner (3. Konjugation) ist dagegen verschollen, aber ihr dissoziiertes lat. Partizip decretus verformte sich in eine neue vereinfachte Infintivform decretar (1. Konjugation) samt zugehörigem Substantiv decreto (Dekret, Erlaß).
III) discerno, discernere, discrevi, discretus entspricht wiederum der griechischen Diakrisis, und im allgemeinen paßt gut zu physikalischen, intellektuellen, aber auch zu spirituellen Trennungen.
In allen romanischen Sprachen erlitt das lat. discernere eine tiefgreifende Dissoziation, indem das Originalsubstantiv discretio (1. Unterscheidung, Trennung; 2. Ermessen, Belieben, Gutdünken) bzw. das Originalpartizip discretus (unterschieden, getrennt, etc) sich bereits im Spätlatein mit einer neuen Bedeutung verselbständigten: nämlich als „verschwiegen, takt- und rücksichtsvoll“ (bescheiden, höflich, diplomatisch, zurückhaltend, etc). Die entstehenden Neologismen „Diskretion, diskret“ setzten sich mit der Zeit in allen europäischen Hauptsprachen durch.
Als Ersatz für die dissoziierten, semantisch verwandelten Partikel regenerierte das Spanische zum alten, klassischen Infinitv (discernir) reguläre Vereinfachungen:
- Die alte discretio (= Unterscheidung) wandelte sich ins spanische discerni-miento, und das französische discerne-ment (= Unterscheidung) nebst der neuen Diskretion (Verschwiegenheit). Die Neubildung klingt etwa so, um es einmal mangels eines eigenen deutschen Wortes so auszudrücken, wie wenn man anstelle der klassischen discretio etwas gekünstelt „Diszerniert-heit oder Diszernierung“ sagen würde.
- Discretus wandelte sich dementsprechend in discernido, das so ähnlich klingt wie „diszerniert“.
Manchmal tauchen jedoch die überlebten, früheren Formen und Bedeutungen anachronistisch wieder auf, wie in den spanischen Redewendungen:
- a discreción de… zur freien Wahl von…;
- capitular a discreción del triunfador / d. h. kapitulieren auf Diskretion [= auf Gnade und Ungnade, auf Ermessen, auf Belieben und Gutdünken] des Triumphators.
- discrecional / beliebig, diskretionär;
Im Französischen überlebten alle drei Verben cernere, decendere und discernere:
I) als cerner (einkreisen, umzingeln, umstellen)
samt cernement (militärische Einschließung) und
II) als decerner (beschließen, erlassen, verfügen)
samt décernement (gerichtliche Entscheidung).
III) als discerner (unterscheiden, erkennen, einsehen)
samt discernement (Unterscheidungsvermögen, Überlegung).
Der langen Rede kurzer Sinn?
Alle drei Verben zeichnen sich klar und deutlich durch einen voluntaristischen Grundton aus. Der Prozeß der „Diszernierung“ (Unterscheidung, Trennung) ist also vornehmlich ein diakritischer Willensakt, ein Akt höheren (oder für „höher“ gehaltenen) Ermessens, dessen pathologische Kehrseite allzu oft in Subjektivität, Belieben und Gutdünken versinken kann.
Wir haben aus dem Ersten Korintherbrief mit Hilfe von griechischen, lateinischen, französischen und englischen Wörterbüchern unparteiische Bedeutungsfelder (Referenzen) angeführt, die zweifelsohne als objektive Quellen für die Gewinnung semantischer Maßstäbe anerkannt werden müssen:
- cernere: heißt zuerst erkennen, im Passiv erkannt werden – erst dann folgt entscheiden, beschließen, kämpfen!
- decernere: heißt Beschluß, Erlaß, Dekret – etwas militärisch formuliert Marschbefehl!
- discernere: heißt Trennung des Kornes vom Spelz, wie durch einen Siebsatz!
Diese Sequenz paßt perfekt zum gebieterischen Charakterbild von Soldaten wie eben die hll. Paulus und Ignatius lebten und werkten, insbesondere nach ihrer Bekehrung. Freilich, wenn Heilige und Helden am Werk sind, kann der Prozeß nur mit Klugheit und Gerechtigkeit, Maß und Mut an der Wirklichkeit ausgerichtet werden. So wurde beispielsweise die deutschsprachige Jesuiten-Zeitschrift Der Große Entschluß (1946–1999) mehr als ein halbes Jahrhundert lang erfolgreich vertrieben unter einem Titel, der für die diakritischen Charakterzüge des Ordens typisch ist. Im Zuge einer wechselvollen Geschichte führte diese Charakterstärke in mehreren Ländern zu zahlreichen Konflikten und zur Vertreibung des Ordens. Vielleicht waren aber die Jesuiten – nicht nur ihr Ordensgründer aus dem Baskenland – manchmal ein wenig kraß und schroff? Oder allzu „cuco“ (schlau) wie Bergoglio es einmal von sich selber gesagt hat.
Im Verlaufe der Ordensgeschichte zeichneten sich die Jesuiten jedenfalls eines außerordentlich starken Willens und scharfen Verstandes aus. Sie setzten ihre Regungen aus dem Inneren zweifelsohne mit äußerster Konsequenz in die Wirklichkeit um. Wollen, ERKENNEN, Handeln haben sie nicht dissoziiert, sondern im Kampfgeist verbunden.
Sein Charakterbild zeichnet Luther ebenfalls als Willensmenschen aus. Aber durchaus mit pathologischen Zügen. Denn er hat sich seine Wirklichkeit selbst gemacht. Das heißt mit symbolischen Worten: die Maschen seines Siebsystems wurden von ihm selbst entworfen. Sie wurden in der Verfallenheit der menschlichen Schwäche weitestgehend subjektiven Leitgedanken und allein dem eigenen Urteilsvermögen anheimgestellt.
Wenn A nicht B ist, wenn die gute, heilige Eingebung in letzter Instanz von keinem bösen, sondern von einem guten Geist eingeflößt worden ist, dann gibt es auch keine graduellen Abstufungen zwischen der Wahrheit und der Unwahrheit. Die Unterscheidung wird zu keiner halben Tat reduziert, sondern als Entweder-Oder einer Trennung ohne Unschärfe andressiert. Jedermann braucht Übung in seinen Vorsätzen, die ihn zum Meister macht!
Dennoch spielt das Subjektive immer mit. Sogar in den Unterscheidungen, Gruppen und Untergruppen einer naturwissenschaftlichen Systematisierung kommen unweigerlich viele subjektive Züge zum Durchbruch. Um ein neutrales Beispiel zu nehmen, die Linné’sche Systematisierung der Flora und Fauna hat sicherlich objektiv geordnete Unterlagen und spiegelt die „wirkliche“ Wirklichkeit wider. Sie ist kein willkürlich errichtetes Luftschloß, aber bei aller Bewunderung muß zugegeben werden, daß die binäre Nomenklatur der taxonomischen Unterscheidungen (= Trennungen und Gruppierungen) hätte auch hundertfach anders gemacht werden können.
Wenn es in einer epochalen Krise (cf. oben: 1. Scheidung, Zwiespalt, Streit) oder in einem Religionskrieg (der bis zu 30 Jahren dauerte!) ums Überleben geht, wie zur Zeit der Reformation, dann nahm die Diakrisis (1. Trennung, Spaltung) der vormals Einen Allgemeinen Kirche absonderliche Formen an. Nach den scharfen Ansichten (lat. cernere) der Reformatoren war das entschlossene Handeln (Dezernieren & Diszernieren) des Tridentinischen Konzils unvermeidbar geworden.
Wohltuend wirkt daher die väterliche Warnung des alternden Paulus, daß die ausufernden Unterscheidungen (Item c) und Sondersprachen (Item d) vor allem auf die mächtige Gabe der Interpretationskunst (Item e) angewiesen sind. Es fällt uns nicht schwer anzuerkennen, daß Orthodoxie, Reformation, aber auch die Gegenreformation aus den Sondersprachen (Item d) entstanden sind. Dem Katholischen Lehramt entspricht daher die eminente Pflicht, aber auch das Recht der richterlichen, unparteiischen Interpretationskunst. Christus hat mit eindeutigen Worten nur eine Kirche gegründet. Und wieviele kirchliche Gemeinschaften sind entstanden? Allein ihre große Zahl ist ein niederschmetterndes Argument.
Übergang von der trennenden Unterscheidung (discretio, discernimiento)
zur begrenzenden Unterscheidung (distinctio)
Im Ersten Korintherbrief spricht der hl. Paulus nicht von einer volutaristisch beliebigen, mehr oder minder vom Kürwillen angehauchten Diszernierung der Geister, sondern von einer aufsteigenden Diakrisis im Sinne von Aussortieren des Guten vom Plunder, welche am Ende in einer strengen Definition münden muß.
Roma locuta – causa finita war früher einmal vom Hochmittelalter über das Tridentinum inklusive bis zum Ersten Vaticanum die Regel. Heute dagegen zeichnet sich das dekadente Rom durch beharrliches Schweigen, Nachlassen und Feilschen aus, wenn seitens der traditionsbewußten Gläubigen berechtigte Dubia auftauchen!
In der spanischen Bibelübersetzung haben wir oben an der beanstandeten Stelle (1 Kor 12,10 Item c) die wohltuende Erläuterung gelesen. Nicht umsonst sagt der geschickte Übersetzer im Spanischen mit einer kleinen Zufügung: „El saber distinguer [!] entre los espìritus falsos y el Espìritu verdadero“ – also nicht nur auf das trennende Unterscheiden der Geister, sondern auf das Distinguieren können zwischen den falschen Geistern und dem wahren Geist kommt es an.
„Diszernieren und Distinguieren“ – darin liegt des Pudels Kern. „Wenn nämlich der Leib nur einer ist, jedoch viele Glieder hat“ (1 Kor 12,12), dann gehören sie modo intrinseco zusammen. In einer eindeutigen Sprache bleibt kein Raum mehr für Ambiguitäten. Auch der hl. Thomas von Aquin verwendet für denselben Sachverhalt im besten scholastischen Stil den übergeordneten, reiferen Ausdruck: Distinctio spirituum [nicht discretio spirituum].
Die Niveau-Unterschiede der klassischen Ausdrücke
- DIFFERENZIERUNG (gr. diakrisis, sp. discernimiento, Unterscheidung mit einem eher neutralen Unterton),
- DISKRIMINATION (Unterscheidung mit einem eher abschätzigen Unterton), und
- DISTINKTION (Unterscheidung mit einem aufwertenden, feierlichen Unterton und hoher Präzision)
kann man auf Deutsch nicht einmal mit einem Wort übersetzen, da alle drei Hauptwörter Unterscheidung heißen: wenn auch zunächst einmal im Streit (Krisis), dann im Zuge einer vorsortierenden Trennung (Diakrisis) und abschließend als einer mit lehrsatzmäßig übergeordneten Definition. Das Distinkte (was verschieden…) und das Distinguierte (was vornehm ist), gehen nämlich auf den griechischen διορισμός‚ (diorismos, synonym auch diorisis) (6) zurück und stammen wiederum von διοριζω (di-orizo, abgrenzen, ins Klare bringen, definieren) ab. Alle romanischen Sprachen bewahrten die kleinen Differenzen der Worte. Dagegen wehrten sich Luther und seine Landsleute jenseits der Sprachgrenze vehement gegen jede feste, dogmatische Definition. Genau so wie heute die Jesuiten und die Deutsche Bischofskonferenz.
Eine Blockierung des Denkens durch die „Zunge“ (d. h. Sprache) spielt oft auch zum Geist des Widerspruchs bei, wenn sie für einen evidenten Sachverhalt keine passenden Worte finden kann. Nachdem die Begriffe der fundamentalen Unterscheidungsmodi bis auf eine unkenntliche Synonymie auch im Lateinischen abgeschliffen worden waren, übergingen sie – völlig unreflektiert – sogar ins Englische: (7)
- to discern: see clearly with the senses or with the mind;
- to discriminate: see, make, a difference between; make distinctions;
- to distinguish: see, hear, recognize, understand well the difference of one thing from other.
Kleider machen Leute – Worte machen Dinge und Haltungen: Wo das Wort gebricht, dort wird auch die Sache beschädigt. Das wirklich Entscheidende am desaströsen Wirken der Reformation war nicht nur das Erfinden eines völlig neuen Systems, das für die kleinen Leute, Soldaten, aber auch für die Oberen Zehntausend vermutlich mangels höherer Bildung größtenteils unverstanden geblieben war. Wirkungsvoller als das, dürfte der individuelle Wille Folgen nach sich gezogen haben, der an die Stelle der Vernunft, an die Stelle des Definierbaren und Lehrmäßigen trat. Im Morgengrauen der Neuzeit wurden alle Theorien für „grau“ erklärt und das Allgemeine vom Besonderen und Nominellen verdrängt. Mit Kants bodenlosem Kritizismus erreichte später der Skeptizismus den ersten Höhepunkt der sogenannten Aufklärung.
Aber der hl. Paulus selbst wertet in seinem Brief alles Reden „mit sonderbaren Zungen“ ab und verlangt von der Gläubigenschar die Einhaltung einer Rangordnung der Charismen aus dem Nutzen für die Gesamtkirche:
„Seid keine Kinder an Urteilskraft (φρεςιν / phresin), sondern an Bosheit sollt ihr Unmündige sein, an Urteilskraft (φρεςιν / phresin) aber seid reife Menschen“ (1 Kor 14,20). φρεν (phren) bedeutet erstens Verstand, Bewußtsein, Geist; und zugleich Gesinnung, Wille, Gemüt.
In der Vulgata steht sensus (Sinn) dafür:
- Sinnes‑, Empfindungsvermögen, Wahrnehmung, Besinnung, Bewußtsein
- Verstand, Denkkraft, Urteil, gesunder Menschenverstand,
- Ansicht, Meinung, Gedanke,
- Bedeutung, Begriff eines Wortes, Inhalt einer Rede.
Hiermit wurde erfolgreich der Beweis erbracht, daß die DIAKRISIS (discretio im klassischen Sinn) als trennende Unterscheidung eines geistigen Siebsystems ein Willensakt ist. DIORISMOS (distinctio) ist dagegen als eine abgrenzende Unterscheidung des Verstandes, welche sich nicht an dem wertenden Willen, sondern frei von allen voluntaristischen Erkenntnisinteressen allein an der zu erkennenden Sache orientiert. Die Distinktion ist eine Definition des Dings (oder Sache) A selbst, das nicht B ist. Daher ist die Distinctio spirituum eine ontologische Differenz. Wo das nicht mehr wahrgenommen wird, herrscht Chaos, und wo es noch nicht wahrgenommen wird, dominiert eine verstockte (oder unreife) Beliebigkeit, welche der Erfüllung der gehobenen Pflichtaufgaben harrt.
Mit diesen Vorwegnahmen möchten wir im folgenden kurz und bündig, aber auch mit großem Respekt über das Anliegen des hl. Ignatius berichten.
Die Unterscheidung der Geister nach Ignatius von Loyola

Die Ignatianischen Exerzitien sind bleibende Juwelen der Tradition der Kirche. Eine verhaltene Kritik müßte jedoch – um es wieder einmal so zu sagen – am „Diszernieren der Geister“ in der Mundart der Jesuiten an der semantischen Verengung des Spätlateins, des Spanischen und des Baskischen ansetzen. Der Reichtum des klassischen Lateins ist in seinen Spätformen – bis zu Lebzeiten des Ordensgründers – merklich ärmer, und im Schoße des avantgardistisch geformten Ordens entlang der Jahrhunderte bis zur Jetztzeit noch enger geworden.
Der Übende soll folglich unterscheiden können, was ihn Ad maiorem Dei gloriam / zur größeren Ehre Gottes geleitet oder auch nicht. Die Gabe der Unterscheidung der geistigen Einflüsse ist gleichwohl für den Einzelnen, für Familien, Schule und Erziehung, Gemeinschaften und Freundschaften aller Art als auch fürs öffentliche Leben von entscheidender Bedeutung. Das Lemma stammt von Papst Gregor dem Großen (540–604). Der 1534 gegründete Jesuitenorden erhob es zu seinem Wahlspruch. Später wurde es öfters in den Beschlüssen des Tridentinischen Konzils (1545–1563) feierlich gebraucht.
Die Maschen eines (allerdings nicht selbstgemachten) Siebes sind also die symbolträchtigen Werkzeuge des hl. Ignatius für das Sortieren, Annehmen oder Ablehnen geistiger Alternativen in einer existentiell delikaten, entscheidenden Situation seines Lebens, als er todkrank, mit dem von einer Kanonenkugel zerfetzten rechten Bein ans Krankenlager gefesselt war. Im Zuge der Genesung nach einer so schweren Verletzung, die sich Ignatius anläßlich der Verteidigung von Pamplona gegen die Franzosen (1521) zuzog, erlebte er Schritt für Schritt eine aufsteigende, innere Dynamik. Er entdeckte die erhebende Erfahrung, daß Gott derjenige ist, der in der Tat zu seiner Seele spricht.

Die fruchtbaren Keimlinge, aber auch die fruchtlosen Spelzen des Seelenlebens werden durch das Discernimiento espiritual (das Auseinandersieben, Trennen) der guten und bösen Geiser entlarvt, die ihre Strategien und Taktiken nach und nach zu verstehen geben. Aus den innersten Regungen der Seele entströmt eine Gewißheit: die wahre Definition und das Surplus der geistlichen Eingebungen, die erahnen lassen, was Gott wirklich von uns will. Die Inspiration regt uns an, etwas konkretes zu tun oder zu lassen. Jede einzelne Regung bezieht sich auf einen bestimmten Seelenzustand und impliziert ein Urteil. Die Kennzeichen des einen Zustandes sind: Wohlbefinden, innere Ruhe, Freude, Friede, vor allem Trost und Harmonie. Die gebrannte Erde am anderen Schlachtfeld fühlt sich unwohl an, mit Unruhe, Trauer, Betrübtheit, Disharmonie.
Wenn also jemand vor einer Weggabelung steht, kann er Freude, Frieden, Vertrauen verspüren, als ob eine innere Stimme spräche: Das ist recht so, so tue das! Andererseits können ihn Zweifel überkommen, Fadheit und Unbehagen, wie wenn die innere Stimme diese erhebende Freude verhindern wollte. Falls die Unterscheidung stolpert, dann wird sie größtenteils daran scheitern, daß die Regungen – die Weg- und Windrichtungen – an Mehrdeutigkeit leiden und sich nicht erklären lassen. Denn sowohl die guten wie die bösen Geister verhalten sich ambig zur geforderten Entscheidung, mit einer verwirrenden Täuschung. Von allem Anfang an ist jedoch zu beurteilen, in welcher Großwetterlage wir uns überhaupt befinden: Verfolge ich einen positiven Kurs in meinem Leben? Geistig zunehmend und aufsteigend in großen Zügen? Oder in einem Prozeß der Schrumpfung und Dekadenz? Was passiert? Woher bläst der Wind? Wohin möchte ich schließlich und endlich gelangen? Die beste Erfahrung macht man im Bett, allerdings nicht träumend. Sondern im Krankenbett wie weiland Ignatius, unter dem Druck äußerster Nüchternheit.
Die Strategien der Geister bestreiten eine konsequente Logik
Wer existentiell gut orientiert ist, dem spendet der gute Geist noch mehr „Begeisterung“, mehr Energie, Trost, Eingebung, Gelassenheit, Befriedigung und Ruhe. Er wird im Glauben gestärkt, daß die Hindernisse auf dem Weg überwindbar sind. Die gute Lebensführung paart sich mit Freude: „Amoris laetitia“?! Trauer und Trübsal sind Sache des Feindes! Anfänglich dringt somit die Trübe in die Sphäre des Heiligen nur mit einem milden, reinigenden Schwamm ein, um den verborgenen Glanz zum Scheinen zu bringen. Umgekehrt, flößt der böse Geist auf dem Pilgerweg Entmutigung und Trübsal ein. Die Hindernisse werden als unüberwindbare Barrieren überzeichnet, die Ideale zu unrealisierbaren Phantomen mit einem schrillenden Gelächter verzogen.
Die Strategien des guten Geistes in aufsteigenden Spiralen promovieren uns mit Leib und Seele. Dagegen bremst uns der schmutzige Geist ein, er hält uns zurück, stellt uns ein Bein. In dekadenten Lebenslagen wird die Strategie nicht unähnliche Ziele verfolgen, jedoch mit umgekehrtem Vorzeichen. Der schmutzige Begleiter präsentiert dann laute Zerstreuung, ein irreführendes Schulterklopfen und unechte Freuden: „Amoris laetitia“?! – währenddessen der gute Begleiter mit einem furchtbaren Gewissensbiß die Offensive eröffnen und zu Umkehr anstacheln wird.
Mystik und / oder Dichtung?
Das ist alles gut und schön gesagt. Man wäre aber vielleicht dennoch versucht einzuwenden, das gute Endergebnis sei zwar manchmal oder meinetwegen sogar oftmals als absolut garantiert anzunehmen, aber der Prozeß der „Unterscheidung“ selber wäre doch nicht für infallibel zu halten, den man nach einem fixen Rezept routiniert durchführen und risikolos exerzieren könne. So ließe sich für ein monumentales Crescendo noch einmal der Ballwerfer von RAINER MARIA RILKE in den Zeugenstand rufen, um der Sache der ehrwürdigen Ignatianischen Exerzitien jenen Ernst zusprechen zu können, den ihr ausgerechnet der liberale Relativismus der führenden Jesuiten Bergoglio, Nicolás und Sosa streitig und lächerlich gemacht hat:
Solang du Selbstgeworfnes fängst, ist alles
Geschicklichkeit und läßlicher Gewinn –;
erst wenn du plötzlich Fänger wirst des Balles,
den eine ewige Mit-Spielerin
dir zuwarf, deiner Mitte, in genau
gekonntem Schwung, in einem jener Bögen
aus Gottes großem Brücken-Bau:
erst dann ist Fangen-Können ein Vermögen, –
nicht deines, einer Welt. Und wenn du gar
zurückzuwerfen Kraft und Mut besäßest,
nein, wunderbarer: Mut und Kraft vergäßest
und schon geworfen hättest.…. (wie das Jahr
die Vögel wirft, die Wandervogelschwärme,
die eine ältre einer jungen Wärme
hinüberschleudert über Meere –) erst
in diesem Wagnis spielst du gültig mit.
Erleichterst dir den Wurf nicht mehr; erschwerst
dir ihn nicht mehr. Aus deinen Händen tritt
das Meteor und rast in seine Räume…
(1922)
Zusammenfassung
Ignatius und Rilke bestätigen einander gegenseitig auf dem halben Weg. Die letzte Zeile mag vielleicht nach einer dichterischen Übertreibung klingen, aber das Ballspiel, Gottes Brückenbau, die Wandervogelschwärme sind imposante Metaphern, die das Wesen der Exerzitien erläutern. Diese sind nichts anderes als eine gewaltige Gewissensforschung und -bildung jener Christen, die einen starken Willen und einen klaren Verstand haben. Mit einem kleinen philologisch-etymologisch-grammatisch anklingenden Exkurs haben wir überdies den wunden Punkt: eine gewisse elitäre, besserwisserische Überheblichkeit des Jesuitenordens von heute entdeckt, der leider Gottes durchwegs liberal und relativistisch denkt, im dialogischen Plauderton bereits häretisch differenziert, und vor allem modernistisch hyperaktiv ist.
Dazu mußten wir allerdings etwas weiter ausholen und die Kategorien der „Ignatianischen Unterscheidung“ in der spanischen Muttersprache des Ordens bis auf die griechisch-römischen Wurzeln zurückverfolgend unter die Lupe nehmen. Für eine schlüssige Beweisführung ist die deutsche (aber auch die englische) Sprache allein nicht ausreichend, da das genuin germanische Vokabular in Bezug auf Differentiationen aller Art sehr beschränkt und stets auf lateinische Lehnwörter angewiesen ist.
Als Fazit können wir festhalten, daß im globalen Brei einer zunehmend undurchsichtigen Welt der Unterscheidung: Trennung und Definition der Geister eine zunehmende Bedeutung zukommt. Dieser zwiefachen Gabe kommt in der laufenden Krise eine lebenswichtige Rolle zu, welche nur außerhalb des Synkretismus sich entfalten kann.
Und nun? Was ist die Moral aus der Geschicht’? Von Ignatius führt kein Weg zum aktuellen Pontifikat der Zweideutigkeiten. Die Exerzitien orientieren sich ja gerade an der Objektivität des Katholischen sowohl im Innenleben als auch im Theologischen: Sie vermitteln Regeln zum Fühlen mit der Kirche, die heute eher steuerlos in der Bergoglianischen Subjektivität und Willkür zu versinken droht. Zur „Mutter Kirche“ finden wir den Rückweg erst, wenn wir uns mit ihrer reichen „Muttersprache“ wieder vertraut machen und mit dem hl. Paulus freimütig bekennen werden: „Civis romanus sum! Ein römischer Bürger bin ich!“ Ohne Maturazeugnis in Latein können wir nur die Hälfte ihrer Botschaft wirklich verstehen.
Die universale Verbreitung der Zivilisation, die früher einmal eurozentrisch war, ist zwar ein irreversibler, weltweiter Prozeß, bedauerlicherweise avanciert sie zur Zeit nur auf technischem, wirtschaftlichem, keinesfalls jedoch auf geistigem Niveau. Alle Nationen und Völker aus den entferntesten Winkeln der Erde: wie Anglo- oder Hispano-Amerikaner (wie auch Papst Bergoglio und sein General Arturo Sosa aus Venezuela selber), Europäer oder Afrikaner, Asiaten aus dem Nahen oder Fernen Osten (wie der Ex-General Adolfo Nicolás aus Japan), müssen sich in die griechisch-römische Kultur, Geschichte und Tradition involvieren, um mit festem Willen und Verstand Christen zu sein bzw. werden zu können. Die verkehrte Inkulturation losgelöster, christlicher Elemente und Bräuche in die Stammesreligionen – wie Buddhismus, Schintoismus, Islam und dergleichen – fördert dagegen lediglich den Aberglauben.
*Endre A. Bárdossy war o. Universitätsprofessor in San Salvador de Jujuy, Argentinien, für Landwirtschaftliche Betriebswirtschaftslehre und Leiter eines Seminario de Aplicación Interdisciplinaria im Departamento de Ciencias Socio-Económicas an der Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Bei Katholisches.info veröffentlichte er u.a. den Aufsatz Kapitalismus ja? Liberalismus nein? – Erweiterte Fassung.
_________________________________
(1) Herrn MMag. Wolfram Schrems ist der Verfasser für zahlreiche Anregungen zu großem Dank verbunden.
(2) Zitiert nach der vollständigen deutschen Ausgabe „Die Hl. Schrift des Neuen Bundes“. Imprimatur Freiburg im Breisgau, den 24. August 1965. Generalvikar Dr. Föhr. Verlag Herder 19664, S. 182.
(3) La Santa Biblia. Übersetzung Evaristo Martàn Nieto. Mit Approbation der Spanischen Bischofskonferenz vom 11. Februar 1988. Ediciones Paulinas, Madrid 19898, S. 1629.
(4) Gemoll: Griechisch-Deutsches Schul- und Handwörterbuch, 1954, Krisis S. 453; Diakrisis S. 200.
(5) Menge-Müller: Langenscheidts Taschenwörterbuch der lateinischen und deutschen Sprache, 1937–195922.
(6) Ritter: Historisches Wörterbuch de Philosophie. Band XI., S. 308.
(7) Hornby-Parnwell: The Oxford English-Reader’s Dictionary. 1952–1989.