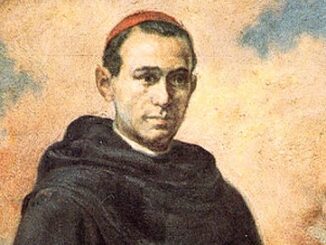Ein argentinischer Priester bietet Einblick in Hintergründe und Milieus der Kirche in Argentinien, aus denen Jorge Mario Bergoglio, dann Papst Franziskus, hervorgegangen ist. Milieus, die auch weiterhin dominant auf die Kirche in dem lateinamerikanischen Land einwirken. Die Erstveröffentlichung erfolgte durch Caminante Wanderer.
Die episkopale Oligarchie der Porteños
Von Facundito*
In der Geschichte Argentiniens – wie in der gesamten Geschichte Hispanoamerikas – läßt sich eine tiefgreifende Konfrontation im 19. Jahrhundert nicht übersehen: ein harter, unversöhnlicher Kampf zwischen zwei Weltanschauungen. Auf der einen Seite stand die traditionelle, katholische Sichtweise, geerbt vom Spanien der Habsburger, und durch sie verbunden mit der abendländischen Christenheit. Auf der anderen Seite trat der liberal-revolutionäre Geist in Erscheinung, ein Kind der Französischen Revolution, die ihren Glauben nicht Gott, sondern dem „Fortschritt“ und der menschlichen Autonomie schenkte.
In Argentinien konzentrierte sich diese liberale Ideologie vor allem in einer kleinen, selbsternannten intellektuellen Elite der Stadt mit dem ursprünglichen Namen Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires (Stadt der Allerheiligsten Dreifaltigkeit und Hafen der heiligen Maria von den guten Winden) – ein Name voller religiöser Bedeutung, den man jedoch kurzerhand säkularisierte zu dem, was heute schlicht als „Buenos Aires“ bekannt ist. Es war diese Gruppe, die mehrheitlich die Revolutionsjuntas bildete, die sich unter dem Vorwand der napoleonischen Invasion gegen ihren rechtmäßigen König erhoben – ein Aufbegehren, das nie wieder rückgängig gemacht wurde.
So kam es, daß das aus diesem Aufstand hervorgegangene Argentinien über Jahrzehnte hinweg in blutige Bruderkriege stürzte – zwischen jenen, die einen zentralistischen, liberalen Einheitsstaat mit Zentrum Buenos Aires errichten wollten, und jenen föderalistischen Kräften, angeführt von regional verwurzelten Caudillos, die die Eigenständigkeit der Provinzen sowie das Recht auf Leben, Religion und kulturelle Identität verteidigten. Sie waren die geistigen Erben des spanischen Rechts und der lokalen Freiheiten. Für die liberalen Unitarios aus Buenos Aires hingegen war das restliche Land – katholisch, föderal und hispanisch – nichts weiter als eine rückständige, barbarische Masse, die noch nicht von den „lichtbringenden“ Ideen der Französischen Revolution berührt worden war.
Dieser Graben wirkt bis heute fort. Der oft unverhohlene Hochmut der Porteños – wie die Bewohner von Buenos Aires und des angrenzenden Ballungsraums sich nennen, von manchen spöttisch „Congourbano“1 genannt – gegenüber den Menschen des Landesinneren ist nach wie vor spürbar. Ebenso wie der Groll der „Barbaren“ aus dem Inland gegenüber dem Dünkel der Hauptstadt. Noch immer ist ein alter Spruch des 19. Jahrhunderts lebendig, der heute vielerorts wiederholt wird: „Ich bin katholisch. Gott bewahre mich davor, ein Porteño zu sein.“
Freilich muß man unterscheiden. Es gibt auch im Landesinneren antikatholische Liberale – Domingo Faustino Sarmiento,2 etwa, war ein gebürtiger Sanjuanino und Criollo, der sich für seine Herkunft schämte. Ebenso gibt es in Buenos Aires Männer, die zu den besten gehören, die der argentinische Boden jemals gesehen hat.
Doch der oben geschilderte kulturelle und historische Hintergrund bleibt auch für das kirchliche Leben nicht ohne Folgen. Als Jorge Mario Bergoglio, ein waschechter Porteño, Erzbischof von Buenos Aires und Kardinalprimas war – und noch verstärkt, nachdem er zum Papst gewählt worden war – setzte er innerkirchlich genau das fort, was die Unitarios im 19. Jahrhundert in der staatlichen Ordnung unternommen hatten: den Versuch, ein zentralistisches, liberales Kirchenmodell durchzusetzen. Wie seine säkularen Vorgänger besetzte er zahlreiche Bischofssitze mit Männern aus seiner Denkrichtung, oft aus seiner unmittelbaren Umgebung, und ging rigoros gegen jene vor, die im Landesinneren versuchten, die „rückständige Barbarei“ der katholischen Lehre, der kirchlichen Moral, der Liturgie und Frömmigkeit zu bewahren. Dabei bediente er sich päpstlicher Erlasse, brüderlicher Visitationen, Apostolischer Kommissare, Suspendierungen und kirchlicher Disziplinarstrafen.
In dieser Linie stand er Sarmiento nahe, der behauptete, das Zentrum der Barbarei im Land sei das Colegio de Monserrat3 in Córdoba – weil dort noch thomistische Scholastik gelehrt wurde.
In diesem Kontext werden auch die jüngsten Äußerungen von Msgr. Raúl Martín, Erzbischof von Paraná, verständlich. Ohne jegliches Schamgefühl bekannte er, die Diözese Santa Rosa an „das anzupassen, was wir in Buenos Aires machen“ – und dasselbe plane er nun für Paraná. Als guter Porteño bemerkte er nicht, wie gravierend eine solche Aussage für einen Entrerriano, einen Bewohner der Provinz Entre Ríos, ist – stammt dieser doch aus einer Provinz, die einst selbst eine Republik war: Am 29. September 1820, dem Fest des heiligen Erzengels Michael, Schutzpatron der Provinz Entre Ríos, rief der Caudillo Francisco Ramírez in der Kapelle Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz in Rosario del Tala die Republik Entre Ríos aus.
In ähnlichem Licht steht das schamlose Spektakel der argentinischen Bischöfe in der Kathedrale von San Luis, das live auf Großbildschirme übertragen wurde: Dort feierten sie lautstark die Absetzung von Bischof Pedro Martínez, einem Mendocino (Bewohner der Provinz Mendoza), und die Einsetzung von Bischof Gabriel Barba, einem Porteño. „Endlich gehört die Kirche von San Luis zur Kirche Argentiniens“, erklärten sie – und das direkt vor dem Volk von San Luis und dem abgesetzten Bischof selbst. Msgr. Barba ließ nicht nach, das Volk und den Klerus von San Luis zu schikanieren, indem er ihnen ständig predigte, sie hätten einen Rückstand von 50 Jahren, müßten alles Alte vergessen und sich dem Neuen öffnen. In einer Pflichtveranstaltung zur „theologischen Fortbildung“ für alle Priester ließ er zwei Priester aus Buenos Aires auftreten, die verkündeten, Jesus habe seine eigene Sendung nicht gekannt, seine Auferstehung sei kein historisches Ereignis, sondern bloß eine von der Gemeinde verbreitete Botschaft, die später in die Evangelien Eingang fand. Die Wunder seien nichts als symbolische Lesarten der gläubigen Gemeinschaft.
Die Geschichte wiederholt sich: Die liberale Überheblichkeit der Hauptstadt setzt sich mit Gewalt durch – und brandmarkt das Landesinnere als „dumm“ und „zurückgeblieben“.
Denn auch der Erzbischof von Paraná ist kein Entrerriano – er ist Porteño.
Der Bischof von San Luis ist kein Puntano – er ist Porteño.
Ebenso:
- Der Erzbischof von San Juan: kein Sanjuanino, sondern Porteño.
- Der Erzbischof von Mendoza: kein Mendocino, sondern Porteño.
- Der Apostolische Administrator von San Rafael: kein Mendocino, sondern Porteño.
- Sein emeritierter Vorgänger, auf Druck des Volkes zurückgetreten: Porteño.
- Auch dessen Vorgänger, kürzlich wegen Mißbrauchs zurückgetreten: Porteño.
- Der Kardinalerzbischof von Santiago del Estero: Porteño.
- Der Erzbischof von Corrientes: kein Litoraleño – in Buenos Aires ausgebildet.
- Der Erzbischof von Bahía Blanca: Porteño.
- Der Erzbischof von Mercedes–Luján: Porteño.
- Der Erzbischof von La Plata: Porteño.
- Der Bischof von Chascomús: Porteño.
- Der Bischof von Gregorio de Laferrere: Porteño.
- Der Bischof von Morón: Porteño.
- Der Militärbischof: selbstverständlich Porteño.
- Der Bischof von Jujuy (im äußersten Norden): Porteño.
- Der Bischof von Posadas (im äußersten Nordosten): Porteño.
- Der Bischof von Venado Tuerto: kein Santafesino – Koreaner, aber in Buenos Aires ausgebildet und geweiht.
- Der Bischof von Catamarca: Porteño.
- Der Prälat von Dean Funes (Córdoba): Porteño.
- Der Bischof von Neuquén: Porteño.
- Der Bischof von Puerto Iguazú: Porteño.
- Der Bischof von Bariloche: Porteño.
- Der Bischof von San Roque (Chaco): Porteño.
Auch von den 28 Weihbischöfen Argentiniens stammen 15 entweder direkt aus Buenos Aires oder wurden dort ausgebildet und inkardiniert.
Natürlich sind das nicht alle Bischöfe des Landes – aber es ist die überwältigende Mehrheit. Einige stammen aus Córdoba oder Rosario, den beiden anderen großen Städten des Landes. Doch fast alle stehen fest auf der Linie der progressiven Ideologie der Bischofskonferenz – wie etwa der berühmte „Manco“ Paz4, gebürtiger Cordobese, aber liberaler Unitarier.
Es geht hier nicht bloß um natürliche Spannungen zwischen Hauptstadt und Provinzen, wie man sie in jedem Land findet. Es ist auch nicht verwunderlich, daß Bischöfe oft aus anderen Regionen stammen als ihrer Diözese. Das Problem liegt in der gewaltsamen Durchsetzung einer bestimmten Ideologie – in einer Weise, die das katholische Landesinnere Argentiniens beleidigt, übergeht und mißachtet.
Geradezu empörend ist es, daß von den vier Priesterseminaren im Landesinneren, die sich um eine fundierte Ausbildung im Sinne der kirchlichen Dokumente bemühten, und deren Absolventen teils in Rom graduierte Theologen mit reicher pastoraler Erfahrung sind, nur ein einziger zum Bischof ernannt wurde – und dieser wurde kurz darauf in einer der üblichen „brüderlichen Visitationen“ des bergoglianischen Pontifikats abgesetzt. Heute ist er emeritierter Bischof von San Luis.
Das katholische Volk im Inneren des Landes ist es leid. Es hat genug davon, daß man seinen Glauben bekämpft, um ihm fremde Ideologien aufzuzwingen. Daß man ihm seine Liturgie, seine Gebete raubt. Daß man seine Priesterseminare und Ordensgemeinschaften zerstört. Daß man seine Diözesen in den Ruin treibt und mit Skandalen überzieht – und dies alles mit der alten Arroganz jener, die aus Buenos Aires kommen, um den angeblich „dummen Criollos“ zu zeigen, wie man es richtig macht.
*Facundito, argentinischer Priester, Urenkel des Tigre de los Llanos (des Tigers der Ebenen, Beiname von Juan Facundo Quiroga, Gouverneur von La Rioja, Tucumán und San Juan, einem berühmten argentinischen Caudillo des 19. Jahrhunderts, der für einen föderalistischen Staat kämpfte, der 1853 in der Verfassung festgeschrieben wurde).
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Caminante Wanderer
- Conurbano bedeutet im Spanischen „Ballungsraum“; Congourbano ist ein spöttisches Kofferwort aus Kongo und Ballungsraum. ↩︎
- Domingo Faustino Sarmiento (1811–1888) war eine der prägendsten Figuren der argentinischen Geschichte des 19. Jahrhunderts – ein Schriftsteller, Pädagoge, Politiker der liberalen Zentralisten und von 1868 bis 1874 Präsident Argentiniens. ↩︎
- Das Colegio de Montserrat in der argentinischen Stadt Córdoba wurde 1687 von dem Priester Ignacio Duarte y Quirós unter dem Namen „Real Colegio Convictorio de Nuestra Señora de Monserrat“ gegründet und ist heute Gymnasium und Universität. Es gehört zu einem Gebäudekomplex, der Manzana Jesuítica genannt wird. Das Colegio ist die älteste Schule Argentiniens, die seit ihrer Gründung ununterbrochen betrieben wird. Am Colegio befand sich auch die erste Druckerei Argentiniens. Duarte vermachte die Gründung und seinen ganzen Besitz dem Jesuitenorden. ↩︎
- José María Paz (1791–1854), liberaler General, Gouverneur von Cordoba, später kurzzeitig auch von Entre Rios; als Unitarier (Zentralist) bekämpfte er die Föderalisten, die sich als Union der freien Völker konstituiert hatten. ↩︎