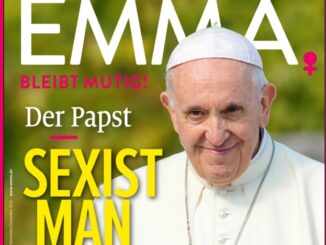Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat ein weiteres destruktives Kapitel in der fortschreitenden Auseinandersetzung zwischen der EU und den Mitgliedstaaten aufgeschlagen, konkret jenen Mitgliedsstaaten, die am traditionellen Verständnis der Ehe festhalten.
Mit seinem Urteil vom 25. November verpflichtet der EuGH die Mitgliedstaaten zwar nicht, die „Homo-Ehe“ in ihr eigenes Recht zu übernehmen. Er zwingt sie jedoch dazu, im Ausland geschlossene gleichgeschlechtliche Verbindungen – unabhängig von ihrer Bezeichnung, ob „eingetragene Partnerschaft“ oder „Ehe“ – anzuerkennen, selbst wenn die nationale Rechtsordnung die Ehe eindeutig als Verbindung von Mann und Frau definiert, wie es etwa in Polen der Fall ist.
Die Ehe ist keine beliebige soziale Konstruktion und auch nicht – wie heute oft behauptet, vor allem in homosexuellen Milieus – ein romantischer Vertrag zweier Menschen, die ihre Zuneigung „besiegeln“ möchten. Ihr Sinn ergibt sich aus ihrer geschichtlichen Entwicklung und vor allem aus ihrer natürlichen Grundlage: Die Ehe ist ausschließlich auf die Weitergabe des Lebens ausgerichtet. Sie schafft den stabilen und geschützten Rahmen für Zeugung, Geburt und Erziehung von Kindern.
Genau deshalb wurde die Ehe über Jahrtausende hinweg besonders geschützt – nicht, weil zwei Erwachsene sich emotional verbunden fühlen. Persönliche Gefühle sind keine Angelegenheit des Staates. Was den Staat betrifft – und was ihn zu schützen verpflichtet –, ist die Institution, die die Zeugung, die Geburt und das Gedeihen der nächsten Generation sichert.
Anerkennen – aber nicht legalisieren? Ein Urteil mit doppelter Botschaft
Ausgangspunkt für das nun ergangene EuGH-Urteil ist die Beschwerde zweier homosexueller polnischer Staatsbürger, die in der Bundesrepublik Deutschland eine „Homo-Ehe“ eingegangen waren und deren Eintragung in das polnische Personenstandsregister verweigert wurde. Die Luxemburger Richter erklärten diese Ablehnung nun für EU-widrig, da sie die Ausübung von Freizügigkeitsrechten behindere und in das Privat- und Familienleben eingreife.
Zwar betont der EuGH, daß die Mitgliedstaaten nicht verpflichtet seien, die „Ehe für alle“ in ihr nationales Recht zu übernehmen. Dennoch müßten sie die rechtlichen Wirkungen einer im EU-Ausland geschlossenen Homo-Verbindung sicherstellen, sofern dies für EU-rechtliche Ansprüche erforderlich ist – etwa im Bereich von Aufenthalt, Verwaltungseintragungen oder Sozialrechten.
Formal soll das traditionelle Familienmodell der Mitgliedstaaten unberührt bleiben. Faktisch jedoch setzt der EuGH die Souveränität der Staaten unter Druck, die bewußt und mit gutem Grund an einem anthropologisch und biologisch begründeten Eheverständnis festhalten. Was der EuGH als „technische Anerkennung“ darstellt, wird in Warschau und anderen Hauptstädten als schleichende Aushöhlung verfassungsrechtlicher Grundlagen wahrgenommen.
Das neue Urteil bestätigt den Gesamttrend, daß die EU-Organe, ob Kommission, Parlament oder Gerichte, die Souveränität der Nationalstaaten unterminieren.
Polens im Spannungsfeld europäischer Vorgaben
Polen bleibt damit Brennpunkt eines grundsätzlichen Konflikts. Artikel 18 der polnischen Verfassung legt die Ehe eindeutig als Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau fest. Diese Norm ist seit Jahren Gegenstand juristischer und vor allem politischer Auseinandersetzungen und wurde von polnischen Gerichten wiederholt bekräftigt. Das Land kennt weder die „Homo-Ehe“ noch eine staatliche Form eingetragener Partnerschaften.
Das EuGH-Urteil zwingt Polen nun, verwaltungsrechtliche Wege zu finden, die EU-Vorgaben umzusetzen, ohne den verfassungsmäßigen Ehebegriff anzutasten. Die Spannung zwischen nationalem Recht und supranationalen Forderungen tritt damit schärfer zutage. Um Klartext zu sprechen: Die EU-Institutionen ergreifen einseitig Partei für eine gesellschaftspolitische Richtung und unterstützen diese. Von Neutralität kann keine Rede sein. Der EuGH erweist sich als gesellschaftspolitisches Kampfinstrument gegen die nationale Souveränität und gegen die traditionellen Werte von Ehe und Familie. Die EU-Institutionen sind woke Machtzentren.
Politische Reaktionen: Zwischen Entgegenkommen und Widerstand
Die progressive polnische Regierung signalisiert, wie zu erwarten war, vorsichtige Überlegungen zur Einführung von staatlich anerkannten Homo-Partenerschaften. Gleichzeitig kündigte der konservative Staatspräsident Karol Nawrocki an, jede Änderung zu blockieren, die den Verfassungsauftrag zur besonderen Schutzwürdigkeit der Ehe relativieren könnte.
Bereits im Frühjahr hatte der Generalanwalt des EuGH ein entsprechendes Urteil vorausgesagt. Alles also vorhersehbar, was weniger über die Qualität der Judikatur, aber umso mehr über die ideologische Justierung der EU-Gerichtshöfe aussagt. Aus der Empfehlung des Generalanwaltes ist nun eine verbindliche Entscheidung geworden – mit weitreichenden Folgen für alle Mitgliedsstaaten, vor allem jenen, die sich der linken Familienzersetzung nicht gebeugt haben.
Ein Präzedenzfall
Das Urteil zeigt beispielhaft, wie stark die europäische Rechtsprechung inzwischen in den Kernbereich nationaler Identität eingreift – insbesondere dort, wo Verfassungen das Naturrecht und das christliche Menschenbild in ihrer Familienordnung widerspiegeln. Polen steht daher nicht allein; auch andere Staaten werden sich fragen müssen, wie sich der Schutz der eigenen Rechts- und Werteordnung mit wachsenden Vorgaben aus Brüssel vereinbaren lässt.
Die eigentliche Herausforderung liegt nun darin, den verfassungsrechtlichen Rahmen zu bewahren und gleichzeitig die unionsrechtlichen Verpflichtungen erfüllen zu sollen – ein Balanceakt, der über das polnische Beispiel hinaus Bedeutung für die gesamte EU-Debatte um Ehe, Familie und kulturelle Identität hat.
Text: Giuseppe Nardi
Bild: Google maps (Screenshot)