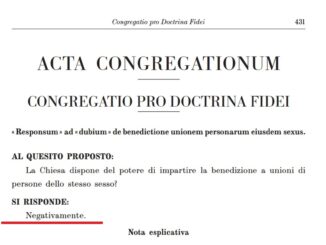Ein 700 Seiten umfassendes Dokument legt, so der Anspruch, „Jahre römischer Willkür“ frei und wird zur Anklage gegen das bergoglianische Rom mit der Mahnung, daß ohne Recht keine Kirche besteht. Die Dokumentation bezieht sich auf die Gemeinschaft der Herolde des Evangeliums, die aufgrund ihrer an Kreuzritter erinnernden Gewandung, ihrer heraldischen Symbole, ihrer Verhaltensregeln und insgesamt ihres Auftretens auch unter katholischen Gläubigen nicht überall auf Gegenliebe stoßen. Es geht aber nicht um Fragen des Geschmacks, sondern der Gerechtigkeit. Die Dokumentation zeigt auf, was den Herolden des Evangeliums widerfahren ist und wie sie darauf reagierten. Beides drängt dazu, ihnen Respekt zu zollen.
Synodalität als Schlagwort – und die unausgesprochene Regel des Schweigens
Nicht erst seit dem Pontifikat von Franziskus, aber mit besonderer Intensität in den bergoglianischen Jahren wird die Kirche mit Begriffen wie „Dialog“, „Synodalität“ und „Prozessen“ geflutet. In der Realität aber gilt ernüchternder die Grundregel, die die Autoren der Dokumentation benennen: „Der Macht stellt man sich nicht entgegen.“
Die Autoren sind der Kirchenrechtler Prof. José Manuel Jiménez Aleixandre und die promovierte Philosophin Sr. Juliane Vasconcelos Almeida Campos.
Durch zwölf Jahre einer kirchlichen Regierungsweise, die sie als „bergoglianische Diktatur“ bezeichnen, habe sich in Rom ein System entwickelt, das Loyalität belohnt und Widerspruch sanktioniert. Zu den Architekten dieses Mechanismus habe, so die Autoren, auch der damalige Präfekt der Bischofskongregation Kardinal Robert Prevost gehört – der heutige Papst Leo XIV.
Während viele katholische Institutionen, Orden, Gemeinschaften, versuchten, sich in ihr schützendes Gehäuse zurückzuziehen in der Hoffnung, nicht vom Sturm der römischen Ungnade getroffen zu werden oder ihn möglichst unbeschadet zu überstehen, gingen die Herolde des Evangeliums den entgegengesetzten Weg. Sie widersprachen – offen, dokumentiert, unbeirrt.
Die kommissarische Verwaltung
Die Herolde des Evangeliums wurden von Papst Franziskus einer kommissarischen Verwaltung unterstellt. Es sei offensichtlich gewesen, so die Autoren, daß ein Exempel statuiert werden sollte. Damit sollten andere Gemeinschaften diszipliniert werden. Das habe sich in der Bergoglio-Ära mehrfach genau so zugetragen, nicht nur gegen die Herolde des Evangeliums. Das Außergewöhnliche in diesem Fall lag vielmehr in der Antwort der Herolde. „Sie haben beschlossen, alles zu geben“, so die Autoren. Sie hielten sich nicht in das übliche Ritual, das nach einer römischen Disziplinierung die Unterwerfung und Selbstaufgabe vorsieht. Sie haben stattdessen ihren Fall genau dokumentiert und in Form einer monumentalen Studie nun vorgelegt: „Die kommissarische Verwaltung der Herolde des Evangeliums. Bestraft ohne Beweise, ohne Möglichkeit zur Verteidigung und ohne Dialog.“
Vorgelegt wurden nun über 700 Seiten Notariatsakten, Gutachten, Schreiben und Protokolle – eine lückenlose Darstellung der Jahre 2017 bis 2025. Der Befund ist eindeutig: Es gab keinen ordentlichen Prozeß, keine fundierten Gründe, keine Möglichkeit, angehört zu werden. Statt dessen gab es vage Vorwürfe, schlecht formulierte Dekrete, die nachträglich geändert wurden, Visitationen auf der Suche nach dem Haar in der Suppe und Entlastungen durch staatliche Gerichte, die in Rom aber ignoriert wurden.
Mit der Zeit, wie die Dokumentation aufzeigt, geriet sogar der von Rom eingesetzte Kommissar selbst in den römischen Fokus und wurde selbst – so die Formulierung – moralisch „unter kommissarische Aufsicht“ gestellt.
Fünfzehn schwere Jahre ohne Rechtssicherheit und Rechtsschutz
Die Herolde des Evangeliums hätten „fünfzehn schreckliche Jahre“ erlebt. Fünfzehn Jahre, in denen das Kirchenrecht nicht als Schutz, sondern als Hindernis betrachtet wurde. Die Herolde dokumentieren alles mit größter Präzision. Und sie zeigen damit auf, daß eine Kirche, die ihr Recht vernachlässigt, ihre Glaubwürdigkeit verspielt. Autorität sei nicht Selbstermächtigung und Gehorsam nicht Unterwerfung.
Der Finger wird noch in eine andere Wunde gelegt: das Schweigen der übrigen kirchlichen Landschaft, der anderen Ordensgemeinschaften, der Universitäten, der kirchlichen Bewegungen. Viele wußten, was geschah, so die Autoren, entschieden sich aber zu schweigen und wegzuschauen. Die Maxime scheint zu lauten: Keinen Konflikt mit Rom, und so lange man nicht selbst betroffen sei, habe man alles andere zu ignorieren. Die Gründe für dieses Verhalten können vielfältig sein, das Ergebnis sei aber das gleiche.
Was die Kirche den Herolden schuldet
Man muß ihren Stil nicht lieben. Man muß ihr Charisma nicht teilen. Aber man kommt nicht daran vorbei, anzuerkennen, daß die Herolde des Evangeliums für die Kirche viel geleistet haben. Sie haben ein erfolreiches Gegenmodell zur marxistischen Befreiungstheologie entwickelt und sind damit dem Erosionsprozeß der katholischen Kirche in Brasilien und nicht nur dort entgegegengetreten.
Nun haben sie nüchtern und mit hoher juristischer Professionalität dokumentiert, wie vom bergoglianischen Rom das Verfahren gegen sie betrieben wurde: „ohne Beweise, ohne Möglichkeit zur Verteidigung, ohne Dialog“. Indem sie öffentlich gemacht haben, was ihnen widerfahren ist, haben sie eine Grundlage geschaffen, von der alle kirchlichen Gemeinschaften profitieren können, weil sie nun vorbereitet sind, falls sie sich morgen ähnlicher Willkür gegenübersehen sollten.
In einer Epoche, in der das Wort „Synodalität“ zum neuen Zauberwort zu werden scheint, mit dem man vielleicht nicht alles, aber viel zu rechtfertigen zu glauben meint, erinnern die Herolde an eine grundlegende Wahrheit: ohne Recht keine Gerechtigkeit, ohne Gerechtigkeit keine Wahrheit, ohne Wahrheit keine echte kirchliche Gemeinschaft.
Die Herolde versuchen der Kirche etwas Wesentliches zurückgegeben: das Bewußtsein dafür, daß die Gehorsam einfordernde Autorität nicht über dem Recht steht.
Text: Antonio Salo Sobe/Giuseppe Nardi
Bild: MiL