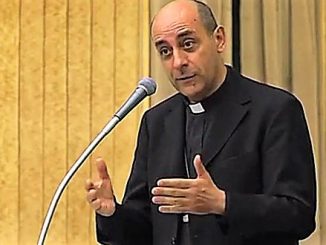Von Cristiana de Magistris
Im philosophischen und theologischen Denken des heiligen Thomas von Aquin nimmt ein Thema von außerordentlicher Bedeutung eine zentrale Stellung ein: die Mitwirkung des Geschöpfes an der göttlichen Regierung. So sehr, daß Thomas in der Summa contra gentiles erklärt, „etwas von der Ursächlichkeit der Geschöpfe wegzunehmen bedeutet, etwas von der Herrlichkeit Gottes wegzunehmen“.
Gott hat wirkliche Wesen geschaffen, die fähig sind zu handeln, da die Handlung die Manifestation des Seins ist. Auf diese Weise verleiht Gott den Geschöpfen die Fähigkeit, ihrerseits Ursache des Guten in der Welt zu sein. Damit betont Thomas die Bedeutung von Vermittlungen sowohl in der natürlichen als auch in der übernatürlichen Ordnung.
In der Summa contra gentiles widerlegt Thomas den Okkasionalismus, der besonders in der islamischen Welt verbreitet war und der – um die Transzendenz Gottes zu wahren – jegliche Art von Geschöpfursächlichkeit verwarf. Thomas hingegen erklärt, Gott finde sein Wohlgefallen nicht darin, das Geschöpf zu verdunkeln, sondern ihm die Würde der Ursächlichkeit mitzuteilen. „Wenn Gott den Geschöpfen seine Ähnlichkeit im Sein mitgeteilt hat, indem er ihnen erlaubte, ihrerseits zu sein, dann hat er ihnen auch seine Ähnlichkeit im Handeln mitgeteilt, so daß die Geschöpfe ebenfalls eine ihnen eigene Tätigkeit besitzen“ (SCG, III, 69). Denn ein Wesen zu erschaffen, das fähig ist, weiterzugeben, was es empfangen hat, ist herrlicher, als einfach nur zu geben. Der Lehrer, der die Schüler so unterrichtet, daß auch sie Lehrer werden, ist gewiß besser als jener, der sie lediglich auf der Ebene von Schülern beläßt.
Gott ist jedoch der Handlung des Geschöpfes nicht fremd. Im Gegenteil: Das Geschöpf handelt überhaupt nur, und handelt um so besser, als es von Gottes Wirken getragen wird, der es im Sein erhält und zum Handeln bewegt (physische Präbewegung). Gott, so sagt der Aquinate, hätte alles aus sich selbst heraus tun können. Doch aus Überfülle seiner Güte wollte er den Geschöpfen eine solche Ähnlichkeit mit sich selbst mitteilen, daß sie nicht nur existieren, sondern auch Ursache für andere sein können. Natürlich stehen das Wirken Gottes und das des Geschöpfes nicht auf derselben Ebene, denn Gott ist Erstursache und das Geschöpf Zweitursache. „Es ist klar, daß eine und dieselbe Wirkung nicht ihrer natürlichen Ursache und Gott so zugeschrieben wird, als ob ein Teil von Gott und ein anderer vom natürlichen Handelnden wäre; sie ist ganz dem einen und ganz dem anderen zuzuschreiben (totus ab utroque), jedoch auf unterschiedliche Weise. Ähnlich wie eine Wirkung ganz dem Werkzeug und ganz der Hauptursache zukommt“ (SCG, III, 70).
Gott durchdringt die Handlung des Geschöpfes vollständig, indem er ihm das Sein und die Bewegung verleiht. Deshalb ist diese Handlung ganz Gottes und ganz des Geschöpfes, jedoch auf verschiedenen Ebenen: totus ab utroque. Gott als Erstursache, die Geschöpfe als Zweitursachen. Das Gemälde ist ganz das Werk des Künstlers und ganz das des Pinsels, doch nicht auf derselben Ebene. Dennoch wirkt Gott im Handeln der Geschöpfe, ohne ihnen die Würde der Ursächlichkeit zu nehmen, ja vielmehr indem er sie ihnen verleiht, so wie der Künstler den Pinsel benutzt, um sein Meisterwerk zu schaffen.
Im Licht dieses Prinzips versteht man, warum Gott für die Menschwerdung ein Geschöpf erwählt hat, das seine Mutter sein sollte. Er hätte es nicht tun müssen. Er hätte wie Adam in die Welt kommen können, ohne Vater und Mutter. Doch er wollte es nicht, weil es für ihn herrlicher ist, einem Geschöpf die Würde zu verleihen, seine Mutter zu sein. Dasselbe Prinzip gilt für die marianische Miterlösung und Mittlerschaft. Christus hätte die Welt ohne Mitwirkung irgend jemandes erlösen können; doch wäre es für ihn weniger herrlich gewesen, so wie er die Gnaden auch allein austeilen könnte, was aber wiederum weniger herrlich gewesen wäre. Denn etwas von der Ursächlichkeit der Geschöpfe wegzunehmen, bedeutet, etwas von der Herrlichkeit Gottes wegzunehmen.
Miterlösung und Mittlerschaft Mariens vollziehen sich selbstverständlich auf einer anderen Ebene: Christus als Hauptursache und Maria als Zweitursache, aber totus ab utroque. Wie Papst Pius X. in seiner Enzyklika Ad diem illum gut erklärt hat: „Weil Maria an Heiligkeit und an der Vereinigung mit Jesus Christus alle anderen übertrifft und weil sie von Jesus Christus dem Erlösungswerk zugeordnet wurde, verdient sie uns de congruo – aus Angemessenheit –, wie die Theologen sagen, was Jesus Christus uns de condigno – in strenger Gerechtigkeit – verdient hat, und sie ist die höchste Verwalterin der Spendung der Gnaden.“ Das Verdienst Christi ist strenge Gerechtigkeit (de condigno), da es aus der hypostatischen Union hervorgeht; das Verdienst Mariens ist Angemessenheit (de congruo), da es aus ihrer göttlichen Mutterschaft stammt. Aber totus ab utroque.
Im Lichte dieser knappen Überlegungen, die aufgrund der Komplexität des Themas einer weitaus ausführlicheren Vertiefung würdig wären, ergibt sich, daß der Leitgedanke, der die bekannte lehrmäßige Note Mater Populi fidelis durchzieht, nämlich die angebliche „Verdunkelung“ der Erlösung durch die doktrinäre Auffassung der Miterlösung, irrig und trügerisch erscheint. Denn wie der Aquinate sagt: „etwas von der Ursächlichkeit der Geschöpfe wegzunehmen, bedeutet, etwas von der Herrlichkeit Gottes wegzunehmen“. Daraus folgt, daß die Titel Miterlöserin und Mittlerin, weit davon entfernt, die Einzigkeit des Erlösers zu verdunkeln, ihn vielmehr verherrlichen. Der Erlöser wäre weniger glorreich ohne die Miterlöserin und Mittlerin, und seine einzigartige Erlösung erstrahlt im geschaffenen Universum um so heller, da an seiner Seite seine Mutter steht, Miterlöserin und Mittlerin des Menschengeschlechtes.
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Corrispondenza Romana