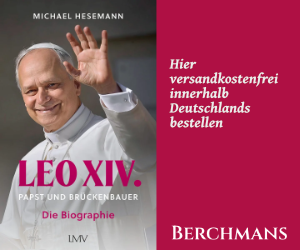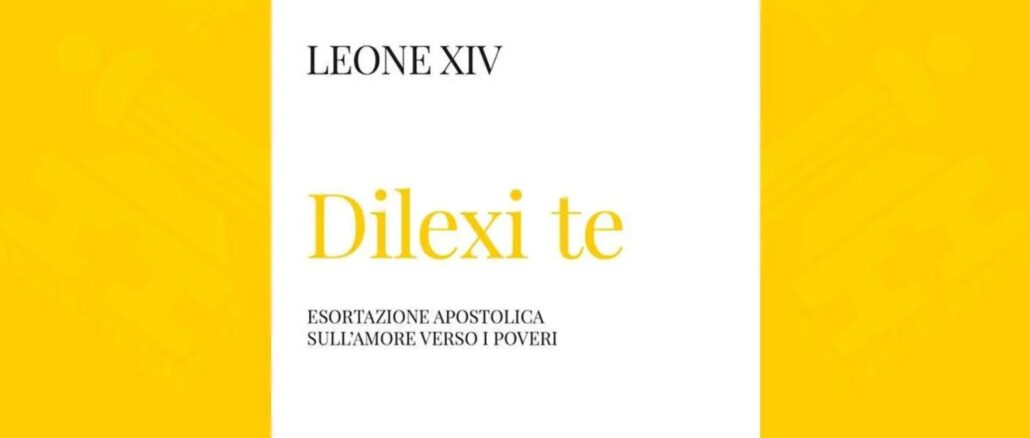
Von Roberto de Mattei*
Die erste apostolische Ermahnung von Papst Leo XIV. mit dem Titel Dilexi te („Ich habe dich geliebt“), die am 4. Oktober 2025 unterzeichnet und am 9. Oktober veröffentlicht wurde, verdient unsere Aufmerksamkeit weit mehr als so manches Interview des Papstes, dem mitunter übermäßige mediale Bedeutung beigemessen wird. Es handelt sich hier nicht um ein paar beiläufige Worte, sondern um ein umfangreiches Dokument mit 121 Abschnitten, gegliedert in fünf Kapitel und eine Einleitung. Wie bereits angemerkt wurde, ist dies keine Sozialenzyklika, sondern eine apostolische Ermahnung. Während eine Enzyklika lehramtlichen Charakter hat, handelt es sich bei einer Ermahnung um ein pastorales Dokument, das keine Prinzipien definiert, sondern zu einem bestimmten Verhalten aufruft.
Papst Leo stellt klar, daß Dilexi te aus einem von Papst Franziskus begonnenen Projekt hervorgeht, das er übernommen und mit eigenen Überlegungen erweitert hat. Zwar ist das Thema der Armut deutlich „bergoglianisch“, doch der Ansatz ist ein anderer. Papst Franziskus drängte eher zu politischem und sozialem Engagement, während Leo XIV. den Schwerpunkt auf moralisches und karitatives Handeln legt. Franziskus maß sozialen Bewegungen eine zentrale Rolle bei der Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit bei; Leo hingegen erwähnt sie nur beiläufig und in untergeordneter Weise. Zwischen den beiden Polen der Gerechtigkeit und der Nächstenliebe, um die sich die Debatten zur sozialen Frage im letzten Jahrhundert drehten, gibt Leo der Nächstenliebe den Vorrang.
Ein klarer Hinweis auf diese theologisch-geistliche Fundierung der Nächstenliebe findet sich in Abschnitt 47, wo Papst Leo auf den heiligen Augustinus verweist: „In einer Kirche, die in den Armen das Antlitz Christi erkennt und im Besitz das Werkzeug der Nächstenliebe sieht, bleibt das Denken des Augustinus ein sicheres Licht.“
Der Ausdruck „bevorzugte Option Gottes für die Armen“ bedeute, so der Papst weiter, „nie einen Ausschluß oder eine Diskriminierung gegenüber anderen Gruppen – das wäre bei Gott unmöglich“ (Abschnitt 16). Armut ist für ihn keine soziale, erst recht keine revolutionäre Kategorie, sondern die menschliche Lebenslage dessen, der schwach, verletzlich, ausgegrenzt oder verfolgt ist.
„Im verletzten Gesicht der Armen erkennen wir das Leid der Unschuldigen – und damit auch das Leiden Christi selbst. Gleichzeitig sollten wir vielleicht richtiger von den vielen Gesichtern der Armen und der Armut sprechen, denn es handelt sich um ein vielgestaltiges Phänomen: Es gibt die Armut derer, die keine materiellen Mittel zum Leben haben; die Armut der sozial Ausgegrenzten, die keine Möglichkeit haben, ihre Würde und Fähigkeiten zum Ausdruck zu bringen; die moralische und spirituelle Armut; die kulturelle Armut; die Armut derer, die sich in einem Zustand persönlicher oder sozialer Schwäche befinden; die Armut der Rechtlosen, derer ohne Raum und Freiheit“ (Abschnitt 9).
Die zahlreichen Beispiele, die der Papst anführt, zeigen die Weite der Kategorie „Arme“, auf die er sich bezieht: Sie umfaßt nicht nur Kranke, Leidende und Verfolgte, sondern auch all jene, die Worte der Wahrheit und Bildung benötigen.
„Zwischen dem Ende des 12. und dem Beginn des 13. Jahrhunderts, als viele Christen im Mittelmeerraum gefangengenommen oder im Krieg versklavt wurden, entstanden zwei Ordensgemeinschaften: Der Orden der allerheiligsten Dreifaltigkeit und des Loskaufs der Gefangenen (Trinitarier), gegründet von Johannes von Matha und Felix von Valois, sowie der Orden Unserer Lieben Frau von der Barmherzigkeit zum Loskauf der Gefangenen (Mercedarier), gegründet von Petrus Nolasco mit Unterstützung des heiligen Raimund von Peñafort, eines Dominikaners. Diese Gemeinschaften von Gottgeweihten entstanden mit dem besonderen Charisma, Christen aus der Sklaverei zu befreien – oft unter Einsatz ihrer eigenen Güter oder sogar ihres Lebens.“ (Abschnitt 60)
„Im 16. Jahrhundert gründete der heilige Johannes von Gott den nach ihm benannten Hospitalorden und schuf damit beispielhafte Krankenhäuser, die alle Menschen aufnahmen – ungeachtet ihrer sozialen oder wirtschaftlichen Lage. Sein berühmter Ausspruch ‚Tut Gutes, meine Brüder!‘ wurde zum Motto tätiger Nächstenliebe gegenüber den Kranken. Zeitgleich gründete der heilige Kamillus von Lellis den Orden der Kamillianer (‚Diener der Kranken‘) und machte es sich zur Lebensaufgabe, den Kranken mit vollkommener Hingabe zu dienen.“ (Abschnitt 50)
Der Papst erinnert auch an die Töchter der Nächstenliebe des heiligen Vinzenz von Paul, die Barmherzigen Schwestern, die Kleinen Schwestern der Göttlichen Vorsehung und viele andere weibliche Ordensgemeinschaften, die „zu einer stillen, mütterlichen Präsenz in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Altenheimen geworden sind“ (Abschnitt 51).
Im 19. Jahrhundert gründete der heilige Marcellin Champagnat das Institut der Maristenbrüder, das sich „den geistlichen und erzieherischen Bedürfnissen der Zeit widmete – insbesondere der religiösen Unwissenheit und dem Verlassenheitsgefühl vieler Jugendlicher“. „Im selben Geist begann der heilige Johannes Bosco in Italien das große Werk der Salesianer, das auf den drei Grundsätzen der ‚vorbeugenden Methode‘ basierte: Vernunft, Religion und Liebe“ (Abschnitt 70). „Im 19. Jahrhundert, als Millionen Europäer auswanderten, um bessere Lebensbedingungen zu finden, zeichneten sich zwei große Heilige durch ihre seelsorgliche Sorge um Migranten aus: der heilige Johannes Baptist Scalabrini und die heilige Franziska Cabrini“ (Abschnitt 74).
Papst Leo empfiehlt schließlich die Werke der Barmherzigkeit (Abschnitt 27) – und ganz besonders einen heute weitgehend vergessenen christlichen Brauch: das Almosengeben. Er schreibt:
„Liebe und innere Überzeugungen müssen genährt werden – und das geschieht durch Taten.“
„In jedem Fall stiftet das Almosen, auch wenn es klein ist, pietas in einer Gesellschaft, in der sich viele nur um das eigene Wohl kümmern. Im Buch der Sprichwörter heißt es: ‚Wer freigebig ist, wird gesegnet werden, denn er gibt dem Armen von seinem Brot‘ (Spr 22,9)“ (Abschnitt 116).
Die Ermahnung Dilexi te von Papst Leo XIV. bekräftigt somit die Lehre der Kirche über die Nächstenliebe gegenüber dem Nächsten. „Die Sorge um die Armen“, so der Papst, „ist Teil der großen Tradition der Kirche – wie ein Leuchtturm, der seit dem Evangelium die Herzen und Wege der Christen aller Zeiten erhellt“ (Abschnitt 103).
„Jene christliche Nächstenliebe“, so können wir abschließend mit den Worten seines großen Vorgängers Leo XIII. sagen, „die das ganze Evangelium in sich zusammenfaßt und stets bereit ist, sich für den Nächsten zu opfern, ist das sicherste Gegenmittel gegen den Stolz und den Egoismus unserer Zeit.“ (Rerum Novarum, Nr. 45)
*Roberto de Mattei, Historiker, Vater von fünf Kindern, Professor für Neuere Geschichte und Geschichte des Christentums an der Europäischen Universität Rom, Vorsitzender der Stiftung Lepanto, Autor zahlreicher Bücher, zuletzt in deutscher Übersetzung: Verteidigung der Tradition: Die unüberwindbare Wahrheit Christi, mit einem Vorwort von Martin Mosebach, Altötting 2017, und Das Zweite Vatikanische Konzil. Eine bislang ungeschriebene Geschichte, 2. erw. Ausgabe, Bobingen 2011.
Bücher von Prof. Roberto de Mattei in deutscher Übersetzung und die Bücher von Martin Mosebach können Sie bei unserer Partnerbuchhandlung beziehen.
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Corrispondenza Romana