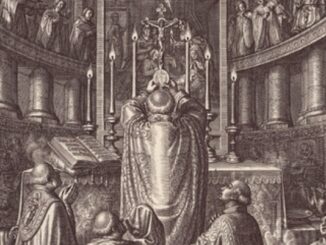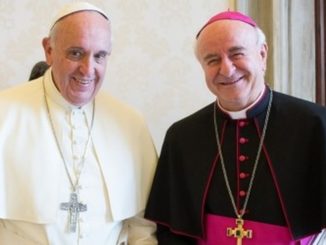Von Cristina Siccardi*
Bekanntlich gilt der „Sonnengesang“, auch „Lobgesang der Geschöpfe“, ursprünglich unter dem Titel „Lobgesang der Schwester Sonne“ bekannt, während der Originaltitel Laudes Creaturarum lautet, als das erste poetische Werk, das in der italienischen Sprache verfaßt wurde. Es handelt sich um eine erhabene Dichtung des heiligen Franziskus, deren Entstehung sich in diesem Jahr zum 800. Mal jährt. Sie entstand im Jahr 1225 im Kloster der Armen Frauen (der Klarissen) von San Damiano. Der „Lobgesang“ steht in der philosophisch-theologischen Tradition augustinischer Prägung und weist Verbindungen zum Psalm 148 auf, in dem alle Geschöpfe – belebte wie unbelebte – aufgerufen werden, Gott zu loben. Ebenso erinnert er an das alttestamentliche Buch Daniel (3,56–88), wo ebenfalls alle Elemente des Kosmos dazu aufgefordert werden, den Herrn zu preisen.
Das Geheimnis dieses zeitlosen literarischen und religiösen Meisterwerks liegt in seiner Reinheit und kindlichen Schlichtheit. Die darin enthaltenen Wahrheiten vermitteln die Freude darüber, in jedem Geschöpf die Hand des Schöpfers zu erkennen. In dieser Freude gründet das Lob der Schöpfung – ein Lob der Liebe – an den Herrn des Lebens und des Todes.
Das Herz des mystisch veranlagten heiligen Franziskus, der bereits die Wundmale Christi trug, quoll über vor Liebe und Dank gegenüber dem Vater – obwohl er unter einer schmerzhaften Augenkrankheit litt, die ihm die Sehkraft raubte und ihn in Dunkelheit leben ließ. Es waren jene Tage, die er in San Damiano verbrachte, in einer Zelle, die aus Matten geflochten war. Währenddessen wurde er ständig von Mäusen belästigt – ein Umstand, den seine Brüder als dämonische Versuchung deuteten. Eines Nachts, von körperlichen Schmerzen gequält, flehte er den Herrn an, ihm beizustehen, damit er alles geduldig ertragen könne. Der Vater ließ ihn nicht warten: Er sprach zu ihm, er solle diese Prüfungen als irdisch ansehen, denn unermeßliche Freuden erwarteten ihn in der ewigen Erlösung.
Seit seiner Bekehrung standen Gnade und Natur in ständigem Zwiegespräch in ihm. So wollte er, von Gott getröstet und in seiner Seele von Jubel erfüllt, an jenem Frühlingsmorgen – wie Franziskus selbst sagte – ein „neues Lob des Herrn in bezug auf seine Geschöpfe“ dichten, zur eigenen Erbauung und zum Nutzen der Mitmenschen. Denn täglich, so sagte er, „gebrauchen wir Geschöpfe, ohne die wir nicht leben können, und durch sie beleidigt das Menschengeschlecht den Schöpfer in hohem Maße. Und täglich zeigen wir uns undankbar für dieses große Geschenk und loben unseren Schöpfer und Spender alles Guten nicht, wie wir es sollten“. (Compilazione di Assisi, in: Fonti Francescane, Editrici Francescane, 3. Aufl., Padua 2011, § 1614, S. 947 und § 1615, S. 947).
Nachdem der „Lobgesang“ in Versform gebracht war, wurde auch eine Begleitmelodie komponiert. Der heilige Franziskus liebte das Singen. Daher ließ er Bruder Pacifico rufen, um einige Brüder auszuwählen, die in die Welt hinausziehen und Gott mit dem „Lobgesang der Schwester Sonne“ preisen sollten. Am Ende sollten sie dem Volk sagen:
„Wir sind die Spielleute des Herrn, und der Lohn, den wir von euch erbitten, ist dieser: daß ihr in wahrer Buße lebt“ (ebd., § 1615, S. 948).
Doch es gibt noch mehr – jenes „Mehr“, das heute kaum noch erwähnt wird:
Der heilige Franziskus preist in diesem Lobgesang auch diejenigen, die zu vergeben wissen und Krankheiten sowie Leiden um der Liebe Gottes willen geduldig ertragen:
„Gelobt seist Du, mein Herr, / durch die, die um Deiner Liebe willen vergeben / und Krankheit und Trübsal ertragen.“
Und weiter:
„Selig, die dies in Frieden ertragen, / denn von Dir, Höchster, werden sie gekrönt werden.“
Am Ende schließt er den Gesang mit der Aussage über den wahren Sinn des Lebens, der sich vollständig erst im Moment des Todes erschließt, wenn der Mensch zum ewigen Leben eingeht – entweder als Verdammter oder als Geretteter:
„Gelobt seist Du, mein Herr, / durch unseren leiblichen Bruder, den Tod, / dem kein lebender Mensch entrinnen kann. / Wehe denen, die in tödlicher Sünde sterben! / Selig, die sich finden in Deinem heiligsten Willen; / ihnen wird der zweite Tod nichts anhaben. / Lobt und preist meinen Herrn, / dankt und dient Ihm mit großer Demut.“
Zur Verherrlichung Gottes beschreitet Franziskus, wie stets, den Weg der Kontemplation und Ekstase, nicht jenen der spekulativ-philosophischen Auslegung. Durch seine vom Geist durchdrungenen Sinne dringt er zum Guten und zur Schönheit des Herrn vor und dankt Ihm für alles, was aus Seiner Hand hervorgegangen ist.
Die Verse über Vergebung und Leidensfähigkeit wurden von Franziskus eingefügt, als er durch das Singen des „Sonnengesangs“ seiner „Spielleute des Herrn“ die Versöhnung zwischen Bischof Guido II. von Assisi und dem Bürgermeister Oportulo herbeiführte. Die letzte Strophe hingegen diktierte er kurz vor seinem Tod im Oktober 1226. Insgesamt umfaßt das Gedicht 33 Verse – eine Zahl, die ein Vielfaches von drei ist, was sowohl auf die Heiligste Dreifaltigkeit verweist als auch auf das irdische Lebensalter Christi bei seinem Tod.
Franziskus’ brüderliches Empfinden gegenüber den Geschöpfen des Himmels, des Meeres und der Erde bedeutet nicht, daß er diese Wesen idealisierte oder ihnen eine menschliche Gleichwertigkeit zuschrieb. Vielmehr sah er in ihnen Stimmen, die sich mit seiner vereinten, ebenso wie mit den Stimmen aller demütigen Gläubigen, um Gott zu verherrlichen – in einem symphonischen Chor, der sich in seiner Vielfalt zur Einheit im dreieinen Gott formt.
Manche haben versucht – und versuchen es noch immer –, dieses Meisterwerk zu säkularisieren, indem sie den Blick ausschließlich auf die Elemente der Natur lenken und dabei bewußt den Schöpfer ausklammern, der sie gewollt und erschaffen hat. Damit möchten sie eine umweltpolitische Ideologie stützen, die Erde und Universum entchristlicht.
Der heilige Bonaventura von Bagnoregio, der Biograf des heiligen Franziskus, erkannte und beschrieb sowohl theologisch als auch mystisch die Freude, die der demütige Mann aus Assisi an allen Werken des Herrn empfand. Er verstand den wahren Sinn seiner Kontemplation, wie sie sich in „Laudato si’, mi’ Signore“ ausdrückt, mit den Worten:
„In den schönen Dingen betrachtete er den Allerschönsten,
und den Spuren, die in den Geschöpfen eingeprägt waren, folgend,
verfolgte er überall den Geliebten.
Aus allen Dingen machte er sich eine Leiter,
um emporzusteigen und jenen zu erreichen,
der ganz und gar begehrenswert ist.“
*Cristina Siccardi, Historikerin und Publizistin, zu ihren jüngsten Buchpublikationen gehören „L’inverno della Chiesa dopo il Concilio Vaticano II“ (Der Winter der Kirche nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Veränderungen und Ursachen, 2013); „San Pio X“ („Der heilige Pius X. Das Leben des Papstes, der die Kirche geordnet und erneuert hat“, 2014), „San Francesco“ („Heiliger Franziskus. Eine der am meisten verzerrten Gestalten der Geschichte“, 2019), „Quella messa così martoriata e perseguitata, eppur così viva!“ „Diese so geschlagene und verfolgte und dennoch so lebendige Messe“ zusammen mit P. Davide Pagliarani, 2021), „Santa Chiara senza filtri“ („Die heilige Klara ungefiltert. Ihre Worte, ihre Handlungen, ihr Blick“, 2024),
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Avvenire (Screenshot)