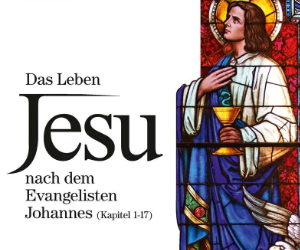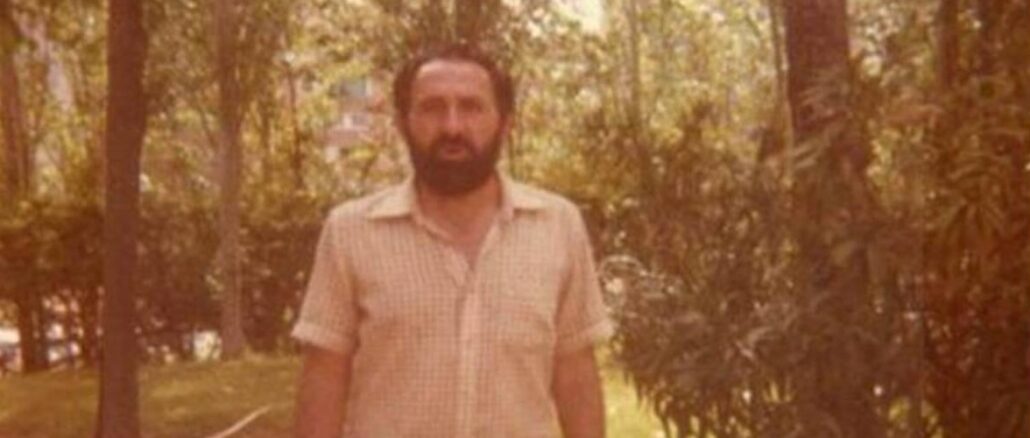
(La Paz) Ein spanischer Jesuit mißbrauchte mindestens 85 Kinder in Bolivien. Nach seinem Tod wurde ein geheimes Tagebuch gefunden, in dem er seine Taten dokumentierte. In der nun erfolgten Enthüllung wird verschwiegen, daß er ein homosexueller Päderast und ein Vertreter der marxistischen Befreiungstheologie war.
Der spanische Jesuit Alfonso Pedrajas mißbrauchte Dutzende von Jungen in Bolivien. Nun wurde ein ungewöhnliches Zeugnis seiner Untaten bekannt, das erschaudern läßt. Boliviens Generalstaatsanwalt Wilfredo Chávez sprach gestern von „einem Horror“ und kündigte Ermittlungen an. In seinem geheimen Tagebuch bekannte sich der Jesuit dazu, mindestens 85 Kinder homosexuell mißbraucht zu haben.
Der Journalist Julio Núñez von der spanischen Zeitung El País rekonstruierte die Geschichte des homosexuellen Mißbrauchstäters mit Hilfe von Opfern und ihrer Angehörigen. Sein Artikel mit dem Titel „Tagebuch eines pädophilen Priesters: ‚Ich habe zu vielen wehgetan‘“ wurde von der linken spanischen Tageszeitung am 30. April auf der Titelseite ihrer Sonntagsausgabe veröffentlicht. Das Besondere daran ist, daß der Mißbrauch aufgrund der Aufzeichnungen aus der Perspektive des Päderasten nachgezeichnet werden kann.
Pater Alfonso Pedrajas starb bereits 2009 im Alter von 66 Jahren an Krebs. Er hinterließ bisher geheime Aufzeichnungen seines sexuellen Mißbrauchs von Dutzenden von bolivianischen Jungen. Das Tagebuch beginnt 1960, als der damals 17jährige Spanier in das Noviziat des Jesuitenordens eintrat, und endet 2008 kurz vor seinem Tod, als er aufgrund einer Krankheit die Aufzeichnungen beendete.

„Ich habe viele Menschen zu sehr verletzt“, schreibt er in seinem Tagebuch, das von einem Neffen nach dem Tod des Jesuiten gefunden und der spanischen Staatsanwaltschaft übergeben wurde. Der Neffe brachte den Fall auch beim Jesuitenorden zur Anzeige und wandte sich an die Tageszeitung El País.
In den Aufzeichnungen sind keine Details des Mißbrauchs verzeichnet. Diese versuchte der genannte Journalist durch Recherchen in Bolivien zu rekonstruieren, indem er die Opfer und deren Angehörigen zu Wort kommen läßt.
Im geheimen Tagebuch heißt es:
„Was diese Zeit ausgefüllt hat, war das Thema Pädophile im Fernsehen und in der Presse. Einige Momente verbrachte ich in enormer Angst. Es hat alles beeinflußt: Schlaf, Arbeit, Beziehungen, Sucht, alles. Ich habe Angst.“
Pater Alfonso Pedrajas, genannt „Pica“, war in Bolivien sehr bekannt. Bei seinem Tod widmete ihm die bolivianische Tageszeitung La Razón einen ausführlichen Nachruf. Dort kann der Artikel nicht mehr aufgerufen werden, aber ein anderes Medium hat ihn gesichert. In diesem Nachruf wurde er als „religiöser Mensch mit einem sozialen Gewissen“ beschrieben:
„Zehn Jahre lang hat sich Pica als Koordinator der Berufungspastoral um die Berufungen junger Männer in die Gesellschaft Jesu gekümmert. Und auch wenn er seine Aufgabe inzwischen hinreichend erfüllt hat, fährt Pica in der großen Hingabe seines Lebens mit den drei Bedingungen fort, die ihn qualifizieren: ein intensiver, kreativer und kühner Erzieher zu sein.“
Alfonso Pedrajas war ein Mann von beachtlicher Bildung. Er arbeitete in zahlreichen bolivianischen Städten, in Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, El Alto und den Bergbauzentren von Potosí und Oruro. Seine Biographie gilt es jedoch, genauer anzuschauen.
Die revolutionären Jesuiten
Alfonso Pedrajas gelangte 1961, 18 Jahre alt, als einer von drei Novizen nach Bolivien, die sich freiwillig dafür meldeten. Er stammte zu einem Elternteil aus Andalusien, zum anderen aus Valencia. Weil sich der Kommunismus in dem südamerikanischen Land ausbreitete, hatte Papst Pius XII. den Jesuitenorden gebeten, seine Aktivitäten im Land zu verstärken. Als Antwort auf den Wunsch des Papstes wurde u. a. Alfonso Pedrajas nach Bolivien geschickt.
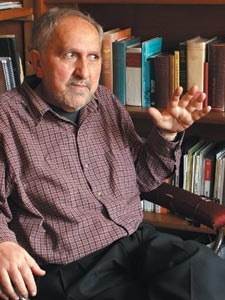
Allerdings regierte in Rom zu dieser Zeit schon seit drei Jahren nicht mehr Pius XII., sondern Johannes XXIII., und viele Dinge änderten sich grundlegend. Die Jesuiten beriefen sich zwar noch auf Pius XII., doch 1962 kam es in Metz zu einem Stillhalteabkommen zwischen dem Vatikan und der Sowjetunion. Etliche Jesuiten wechselten mit wehenden Fahnen in das „Lager des Sozialismus“.
Pedrajas absolvierte in den folgenden sechs Jahren seine Ausbildung in Peru und Ecuador, um 1967 nach Bolivien zurückzukehren und seine Arbeit im Bildungs- und Erziehungswesen aufzunehmen.
El País erwähnte in seiner Enthüllung weder, daß es sich bei Pedrajas um einen homosexuellen Päderasten handelte, noch, daß er zu jenen Jesuiten gehörte, die sich der marxistischen Befreiungstheologie anschlossen.
Einer seiner ersten Einsatzorte war an einer Schule in La Paz, wo Pedrajas zusammen mit seinem Mitbruder Pedro Basiana lebte, der später zu einem Kopf der marxistischen Befreiungstheologie wurde. In diesem Haus nahm der Seminarist Néstor Paz Zamora an einer eigens für ihn im engsten Kreis gefeierten Messe teil, bevor er sich dem von Che Guevara angeführten und von Kubas Kommunisten unterstützten Guerilla-Aufstand von Teoponte anschloß bzw. der kommunistischen Nationalen Befreiungsarmee (ELN). Pedrajas unterstützte die revolutionären Neuerungen, tat sich aber nicht so hervor wie andere Jesuiten. Der Grund dafür ist inzwischen bekannt: Er hatte andere „Interessen“, die ihn gefangennahmen.
1971 beendete er sein letztes Studienjahr der Theologie in Cochabamba. Über seinen Mitbruder Basiana gelangte Pedrajas an das von Basiana umgestaltete Colegio Juan XXIII (benannt nach dem von den Modernisten und Revolutionären verehrten Papst Johannes XXIII.), dessen erster Direktor Basiana inzwischen geworden war. Mit der Schule war auch ein Internat verbunden. Von dieser Einrichtung aus gab es einen direkten Draht zur Terrororganisation ELN und zur geheimen Bewegung der Revolutionären Linken (MIR).
Als Basiana 1976 stirbt, wird Pedrajas Direktor des „Juan XXIII“. In der Einrichtung versteckte er linke Revolutionäre und verhinderte deren Verhaftung. Von ihm selbst sind Bilder erhalten, die ihn in einem T‑Shirt der nicaraguanischen Sandinisten zeigt, jener kommunistischen Guerilleros mit befreiungstheologischer Unterstützung, die 1979 gewaltsam die Macht in Nicaragua an sich gerissen hatten. Er selbst sah sich weniger als Revolutionär mit der Waffe, sondern als „Revolutionär der Erziehung“. In einem Interview sagte er Jahre später von sich selbst:
„Ich las viele Lehrbücher, vor allem aus der damaligen Sowjetunion. Ich mochte die sozialistische Erziehung.“
Seine „revolutionäre Erziehung“ bestand auch darin, sich nachts im Schlafsaal der Jungen herumzutreiben und sich diese auf sein Zimmer zu holen oder schicken zu lassen.

„Gottloser Kleriker mit erfülltem schwulem Leben“
Aus seinen Aufzeichnungen geht hervor, daß sich Alfonso Pedrajas an verschiedene Priester wandte und ihnen alles erzählte. Dazu gehört der Salesianer Ángel Tomás García. Dieser habe ihn 1998 auf die Konsequenzen seines Handelns aufmerksam gemacht. Mehr wird nicht gesagt, auch nicht, ob der Salesianer den Fall zur Anzeige brachte.
Ausführlicher schrieb Pedrajas zum bolivianischen Dominikaner Óscar Uzín Fernández (1931–2018), einem namhaften Befreiungstheologen und Schriftsteller, dem er sich anvertraute. Bei diesem habe er sich „wohlgefühlt“. Uzín beschreibt er als einen Kleriker „mit einem erfüllten schwulen Leben“, der „aufgehört hat, an Gott zu glauben“. Uzín habe ihn „gut behandelt und nicht verurteilt“.
Erste Stellungnahme des Jesuitenordens
Der Jesuitenorden reagierte auf die Veröffentlichung von El País mit einer Stellungnahme des Ordens in Bolivien. Darin wird bestätigt, daß der verstorbene Jesuit „wegen Päderastentums angezeigt wurde“.
Der Orden habe nach Erhalt der Anzeige den Fall sofort der dafür zuständigen Stelle gemeldet, die Anfang August 2022 ihre Ermittlungen aufgenommen habe. Die Untersuchungszeit unter Hinzuziehung von Experten endete am 4. April 2023 und bestätigte die wahrscheinliche Echtheit der angezeigten Taten.
Am 5. April habe eine zweite, nun vertiefte Untersuchung des Falles begonnen, die derzeit im Gange ist. Zudem heißt es in der Stellungnahme:
„Wir bedauern zutiefst den Schaden, der den Opfern zugefügt wurde, wir schämen uns für diese Situation und bekräftigen im Einklang mit unserer Politik in diesen Fällen unsere Verpflichtung, den Opfern zuzuhören, nach Möglichkeit Gerechtigkeit zu üben und uns weiterhin für die Beendigung dieses Verbrechens einzusetzen.“
Ehemalige Absolventen des Colegio Juan XXIII sprechen von Vertuschung durch den Jesuitenorden. Die damals 12‑, 13‑, 14jährigen Opfer sagen, daß Pedrajas Vorgesetzte „alles wußten“, aber nichts unternommen hätten.
Text: Giuseppe Nardi
Bild: MiL/eju/Bolivia/Twitter (Sceenshots)