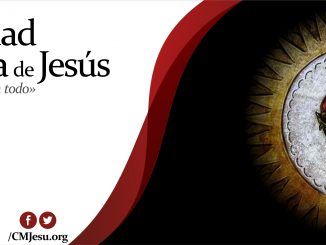Von den Cooperatores Veritatis
Seit einiger Zeit hören wir nichts anderes mehr als das Gerede von „Synodalität“, selbst die Fastenbotschaft 2023 von Papst Franziskus hatte nicht die Bekehrung zu Christus oder die Reue über die eigenen Sünden zum Kern, sondern die Synodalität… die „Bekehrung zur Synodalität“!
Es dreht sich in dieser Fastenzeit alles um die Synode im kommenden Oktober, so sehr, daß sogar viele Fastenexerzitien die Synodalität zum Thema haben…
Die Bewahrung und Stärkung des unverkürzten Glaubens
Die Synode ist ein legitimes Instrument in der Kirche, das in den vergangenen zweitausend Jahren immer den Zweck hatte, die Bischöfe zusammenzubringen, die verschiedenen kirchlichen Probleme anzuhören und sie lehrmäßig zu lösen. Eine andere Sache ist hingegen das Konzept, das seit Jahren wie ein Mantra mit dem Begriff „Synodalität“ ausgedrückt und aufgezwungen wird.
Wenn es die Synode in der Kirche schon immer gegeben hat, lohnt es sich, danach zu fragen und zu verstehen, warum Paul VI. das Bedürfnis hatte, eine neue „Institution“ namens Synode zu „gründen“?
In der Tat war es Papst Paul VI., der am 15. September 1965 die Bischofssynode als Antwort auf den Wunsch der Konzilsväter des Zweiten Vatikanischen Konzils, die Erfahrung des Konzils „lebendig“ zu halten, ins Leben rief. Das Dokument, mit dem diese „neue“ Synode eingesetzt wurde, war das Motu proprio Apostolica sollicitudo.
In diesem Dokument unterstreicht der Papst: „Die Bischofssynode, durch die aus den verschiedenen Gebieten des Erdkreises ausgewählte Bischöfe dem obersten Hirten der Kirche stärkere Hilfe und Mitarbeit leisten, wird so errichtet, daß sie sei: a) eine zentrale kirchliche Einrichtung; b) eine Vertretung des ganzen katholischen Episkopates; c) ihrem Wesen nach ständig; d) der Struktur nach zeitlich befristet in der Erfüllung der jeweils gestellten Aufgaben.“
Die erste Bischofssynode fand 1967 statt und befaßte sich mit dem Thema:
„Die Bewahrung und Stärkung des katholischen Glaubens: seine Integrität, seine Kraft, seine Entwicklung, seine doktrinäre und geschichtliche Kohärenz“.
Die Gefahr eines Trojanischen Pferdes
Wenn das Konzil eine Art Trojanisches Pferd war, durch das die modernistischen Theologen ihre Ideologien durchsetzten, so gilt das gleiche für das Instrument der neuen Synode.
Tatsächlich war von Anfang an klar, daß sie – entgegen der von Paul VI. selbst geäußerten Warnnung – die verschiedenen Synoden nutzen wollten, um die Lehre der Kirche zu ändern. Am 24. August 1968 prangerte er gegenüber den Bischöfen Lateinamerikas diese ernste interne Situation mit den folgenden Worten an:
„… Wir sind durch den Historismus, den Relativismus, den Subjektivismus und den Neopositivismus, die auf dem Gebiet des Glaubens einen Geist der subversiven Kritik und die falsche Überzeugung hervorrufen, versucht, daß wir, um auf die Menschen unserer Zeit zuzugehen und sie zu evangelisieren, auf das lehrmäßige Erbe, das seit Jahrhunderten vom Lehramt der Kirche gesammelt wurde, verzichten müssen und daß wir, nicht so sehr durch eine Tugend einer größeren Klarheit des Ausdrucks, sondern durch eine Änderung des dogmatischen Inhalts, ein neues Christentum nach menschlichen Maßstäben und nicht nach den Maßstäben des authentischen Wortes Gottes gestalten können.“
Und ist es nicht so, daß unter dem Vorwand neuer pastoraler Ansätze auch neue IDEEN gesucht werden, weil sich die Herausforderungen geändert hätten und die Lehre deshalb nicht mehr gebraucht würde?

Das einzige, was sich in Wirklichkeit nicht verändert hat, ist die Versuchung, von der Paul VI. in prophetischer Voraussicht sprach, nämlich der Anspruch „nach menschlichen Maßstäben und nicht nach den Maßstäben des authentischen Wortes Gottes gestalten [zu] können“, anstatt „die Bewahrung und Stärkung des katholischen Glaubens: seine Integrität, seine Kraft, seine Entwicklung, seine doktrinäre und geschichtliche Kohärenz“ zu fördern, wie das Thema der ersten Bischofssynode lautete.
Bei genauerem Hinsehen handelt es sich also um die Versuchung, die allen ekklesiologischen Auseinandersetzungen der 70er und 80er Jahre zugrundelag (und auch hier hat sich die Musik nicht geändert, vielmehr verschlimmert), wo die neue Losung ebenfalls wie ein Mantra auferlegt wurde: Inkulturation, Dialog um jeden Preis, Offenheit und Begleitung. Begleiten ist schön und gut, aber wohin?
Die Päpste sahen die Gefahr der Synoden-Instrumentalisierung…
Schließlich muß betont werden, daß die Synode – die auch den Laien aufgrund ihrer Kompetenzen im kirchlichen Bereich offensteht – kein entscheidendes oder ausführendes, sondern ein beratendes Organ ist, das mit einer Liste von Vorschlägen und Überlegungen endet, die von den Synodenvätern dem Papst übergeben werden, der für das eigentliche Schlußdokument verantwortlich ist, das dann Teil des „ordentlichen Lehramtes“ ist. Alle Texte, die aus den Beratungen hervorgehen, sei es auf der Ebene der Diözesen oder auf der Ebene der Dekanate oder Pfarrgemeinden, alle Texte, die daraus hervorgehen, sind nichts mehr als eine Diskussionsgrundlage: Niemand kann durch diese Texte irgendwelche Änderungen, schon gar nicht auf der Ebene der Lehre aufzwingen… das letzte Wort hat der Papst durch das Schlußdokument.
Es muß betont werden, daß sowohl Paul VI. als auch Johannes Paul II. und Benedikt XVI. die Gefahr der Synoden-Instrumentalisierung verstanden hatten und – das muß man der Ehrlichkeit halber sagen – sich gegen bestimmte Abweichungen wehrten, indem sie mit ihren Schlußdokumenten immer einen lehrmäßigen Schlüssel gaben, der jedem ungesunden Versuch, die Lehre zu korrumpieren, ein Ende setzte. Nicht umsonst hat Johannes Paul II. mit dem damaligen Kardinal Ratzinger die Dringlichkeit des Katechismus verstanden: nicht um ihn an die Zeit anzupassen, sondern um ihn für die Bedürfnisse dieser Zeit zur Verteidigung der Lehre zu strukturieren.
Die Idee, Synoden wieder wie in der Urkirche einzuführen, war bereits in der Vorbereitungsphase des Zweiten Vatikanischen Konzils aufgekommen. Kardinal Silvio Oddi, damals Apostolischer Nuntius in der Vereinigten Arabischen Republik (Ägypten, Syrien, Nordjemen), unterbreitete am 15. November 1959 den Vorschlag, ein zentrales Leitungsgremium der Kirche zu schaffen, oder, um es mit seinen Worten zu sagen, ein beratendes Gremium. Er sagte: „Aus vielen Teilen der Welt kommen Klagen darüber, daß die Kirche außer den römischen Kongregationen kein ständiges Beratungsorgan hat. Daher sollte eine Art ‚Miniaturkonzil‘ eingerichtet werden, dem Menschen aus der Kirche in der ganzen Welt angehören, die regelmäßig, auch einmal im Jahr, zusammenkommen, um die wichtigsten Fragen zu erörtern und mögliche neue Wege in der Arbeit der Kirche vorzuschlagen. Kurz gesagt, ein Gremium, das sich auf die gesamte Kirche ausdehnen würde, so wie die Bischofskonferenzen die gesamte oder einen Teil der Hierarchie eines Landes zusammenbringen, so wie andere Gremien, z. B. der Lateinamerikanische Bischofsrat CELAM, ihre Tätigkeit zum Nutzen eines ganzen Kontinents ausdehnen.“
In Wirklichkeit handelte es sich um unangebrachte „Beschwerden“, die Teil einer Reihe modernistischer Initiativen waren, die unter dem Deckmantel des „Dienstes an der Kirche“ gestartet wurden.
In den 26 Jahren seines Pontifikats leitete Johannes Paul II. 13 Bischofssynoden. Die zweite der drei außerordentlichen Synoden fand 1985 zum 20. Jahrestag des Abschlusses des Zweiten Vatikanischen Konzils statt. Unter seinem Pontifikat begannen Sondersynoden, die sich mit bestimmten geografischen Gebieten befaßten. Synoden, denen jeweils ein nachsynodales Apostolisches Schreiben folgte.
Papst Benedikt XVI. leitete in seinen acht Jahren fünf Synoden, darunter zwei Sonderversammlungen. Auch er trug zum reichen lehrmäßigen Erbe der Kirche bei, indem er nach jeder Synode ein Apostolisches Schreiben veröffentlichte.
… bis Franziskus kam
Vor zehn Jahren haben sich die Dinge aber verändert – zum Schlechteren –, seit der ersten Synode des derzeitigen Pontifikats, die sich mit der Familie befaßte und aus der das verworrene und zweideutige Dokument von Papst Franziskus mit dem Namen Amoris laetitia hervorging. Aufgrund der vielen darin enthaltenen Unklarheiten sahen sich vier Kardinäle dazu veranlaßt, mit den berühmten Dubia (Zweifel) zu intervenieren, auf die Papst Franziskus bis heute nicht geantwortet hat.
Das ursprüngliche Ziel der Synode war also klar: dem katholischen Episkopat ein Instrument anzubieten, um dem Papst „eine wirksamere Zusammenarbeit“ in der Leitung der Weltkirche zu ermöglichen, eine stabile und kontinuierliche Zusammenarbeit. Heute – und das war die eigentliche grundlegende Neuerung, die Papst Paul VI. mit der Einsetzung der Synode 1965 anstrebte – ist die Hilfe, die der Episkopat dem Papst leistet, nicht mehr nur eine gelegentliche Tatsache, sondern ein festes Gremium.
Aber, bereits gesagt: Eine Sache ist die Synode, durch die die BISCHÖFE zusammenkommen, um mit dem Papst zusammenzuarbeiten, der übrigens am Ende der Arbeit immer das letzte Wort hat; eine andere Sache ist die SYNODALITÄT, die weder von Paul VI. noch von Johannes Paul II. noch von Benedikt XVI. vorgesehen war.

Wenn der Begriff „Synode“ etymologisch „Zusammenkunft, Versammlung“ bedeutet und es in unserem Fall die Bischöfe sind, die zusammenkommen, um die verschiedenen Probleme zu klären, die mit dem Papst und mit seiner Hilfe zu lösen sind, so bedeutet der Begriff „Synodalität“ hingegen „gemeinsam gehen“ und weist auf den Weg des Gottesvolkes hin, zu dem noch hinzukommt, daß „es sich als Versammlung im gegenseitigen Hören und des Heiligen Geistes oder um die Eucharistie versammelt“ .… Das aber hat nichts mit „Synode“ zu tun, weder mit der, die aus der zweitausendjährigen Geschichte bekannt ist, noch mit jener „neuen“, die 1965 von Paul VI. eingesetzt wurde.
Manchen mag das wie eine Bedeutungslosigkeit erscheinen, doch es ist sehr wichtig, zu verstehen, was hier vor sich geht.
Für Papst Franziskus sind Synode und Synodalität zu Synonymen geworden. Es geht nicht mehr um Ereignisse in der Kirche, sondern um Veränderungsprozesse in der Kirche. Bischöfe, Klerus, Ordensleute und Laien, alle müssen „ZUSAMMEN GEHEN“, zusammen auch mit Nicht-Katholiken wohlgemerkt, es ist ein Weg der geistlichen Unterscheidung, der kirchlichen Unterscheidung, die in der Anbetung (wann?), im Gebet (wann und welches?), im Kontakt mit dem Wort Gottes (von welcher Auslegung sprechen wir, wenn der Katechismus aus den Pfarreien und kirchlichen Gemeinschaften verbannt wurde?)… ein Weg, der uns für die Unterscheidung öffnen und erleuchten soll. Aber wohin führt er uns?
„Eine Kirche, die sich wenig um die Lehre kümmert, ist nicht pastoraler, sie ist nur noch unwissend“
Trotz aller guten Absichten von Papst Franziskus, die man einfach annehmen will, geht die Rechnung nicht auf. Der große Kardinal Caffarra (1938–2017) hat zu Recht gesagt:
„Eine Kirche, die sich wenig um die Lehre kümmert, ist nicht pastoraler, sie ist nur noch unwissend.“
So ist es auch bei all dem Nachdruck, der auf die Synodalität gelegt wird, die, ohne den geringsten Hinweis auf die zu lehrende Doktrin, Gemeinschaften schaffen wird, die wirklich unwissend sein werden!
Der große Caffarra sagte nach den Unklarheiten, die sich aus der Familiensynode und dem Dokument Amoris laetitia ergaben, ohne Umschweife auch:
„Und wenn ihr eine Rede hört, auch wenn sie von Priestern, Bischöfen oder Kardinälen gehalten wird, und ihr stellt fest, daß sie nicht mit dem Katechismus übereinstimmt, dann hört nicht auf sie. Sie sind Blinde, die andere Blinde führen.“
Caffarra erinnerte an den heiligen Kardinal John Newman:
„Newman sagt: ‚Wenn der Papst gegen das Gewissen im wahren Sinne des Wortes sprechen würde, das heißt, gegen das rechte Gewissen, würde er einen wirklichen Selbstmord begehen, er würde das Grab unter seinen Füßen schaufeln‘. Das sind Dinge von schockierender Schwere. Man würde das private Urteil zum letzten Kriterium der moralischen Wahrheit erheben (die göttliche Wahrheit und nicht menschliche Meinung ist). Sage niemals zu einem Menschen: ‚Folge immer deinem Gewissen‘, ohne immer und sofort hinzuzufügen: ‚Liebe und suche die Wahrheit über das wahre und einzig Gute‘. Du würdest ihm sonst die zerstörerischste Waffe seines Menschseins in die Hand geben.“
Wir geben die Synode also nicht auf und wir fordern niemanden auf, sich GEGEN jemanden zu stellen… wir wollen aber, daß eines klar ist: Entweder ist die Synode ein Instrument der WAHRHEIT oder sie ist nichts Gutes, tertium non datur. In dieser Frage gibt es keinen anderen Weg, keinen Mittelweg, keinen Kompromiß.
„Es ist nicht die Wahrheit, die synodal sein muß. Es ist die Synodalität, die wahr sein muß.“
Und während es stimmt, daß ein synodaler Weg sicherlich ein wirksames Mittel sein könnte, um viele Probleme anzugehen, die uns heute erdrücken und überwältigen, muß man ohne Umschweife sagen, daß dieser „synodale Weg“, wie er umgesetzt wird, nichts mit der wahren Synode zu tun hat, vielmehr nicht einmal ein ehrlicher Weg ist. Es genügt, an den „synodalen Weg“ zu denken, der in der Kirche in Deutschland und in verschiedenen Diözesen auf der ganzen Welt entstanden ist. Es scheint ein Weg von Menschen zu sein, die eine verspätete Kopie der 68er Revolution umsetzen wollen; die alle möglichen und unmöglichen angeblichen, aber nicht existierenden Rechte einfordern, während die Rechte Gottes, des Einzigen, der tatsächlich Rechte einfordern kann, verschwinden, unbeachtet bleiben, ignoriert, wenn nicht sogar geleugnet werden. Frauen, die in der Kirche hochmütig Rollen einfordern WOLLEN, die ihnen nicht zustehen; Laien, die sich als Teil der Hierarchie aufspielen; Priester, die nicht mehr wissen, wer sie sind und was ihre priesterliche Identität ist; Bischöfe, die ohnmächtig, wehrlos und unfähig sind zu reagieren – oder schlimmer.

Es fehlt offensichtlich an der Unterscheidung der Geister. Dabei gibt es ein einfaches, aber effizientes Instrument: Es ist nicht die Wahrheit, die synodal sein muß. Es ist die Synodalität, die wahr sein muß.
Jesus sagte im Evangelium zu Thomas: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich“ (Joh 14,6). Zu Petrus sagte Jesus, als dieser ihn aufmerksam machte, daß viele Jünger wegen seiner Worte über die Eucharistie weggingen: „Willst du auch weggehen?“ (Joh 6,15). Der Herr spricht also zu keiner Zeit davon, die Wahrheit von Zeit zu Zeit zu prüfen, damit es für seine Anhänger bequemer wird, ihm zu folgen, sich an den Tisch zu setzen und einen Kompromiß zu suchen, der allen paßt. Die Aufgabe, die Wahrheit zu erkennen und in ihr zu leben, ist eine gewaltige Aufgabe für alle Christen, aber das ist der Auftrag der Kirche, die Wahrheit zu bewahren und zu lehren und die Menschen anzuleiten, sie zu erkennen. Es ist daher eine Aufforderung, uns selbst zu verleugnen, unser Kreuz zu tragen und Ihm nachzufolgen, das heißt, in Seiner Kirche mit Seiner Lehre nachzufolgen.
„Tut Buße, das Himmelreich ist nahe“ (Mt 3,1–12); „Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe; tut Buße und glaubt an das Evangelium“ (Mk 1,15). „Als Johannes sah, daß viele Pharisäer und Sadduzäer zur Taufe kamen, sagte er zu ihnen: ‚Ihr Natterngezücht! Niemand kann euch einen Schleichweg sagen, auf dem ihr Gottes Zorngericht entkommen könnt“ (Mt 3,7–9). Gott zu kennen ist also keine abstrakte, spirituelle, persönliche, sentimentale Sache: Wenn ich Ihn kenne, MÜSSEN meine Werke Ihn offenbaren, und nur dann bringe ich Licht, bereite den Weg des Herrn und gehe ihn nach Seinem Plan, ohne Angst, und nicht nach meinen eigenen Eitelkeiten, wie Johannes nicht nur lehrte, sondern mit seinem eigenen Leben bezeugte. Dazu sind die Synoden da, dazu muß die Synodalität führen, damit diese Früchte Christi würdig sind und zur Bekehrung zu Ihm führen… Viele Synodenväter und eifrige Verfechter der Synodenbewegung haben leider vergessen, daß die Wahrheit eine einzige und unverrückbare ist und in der Heiligen Schrift und der Tradition überliefert ist.
Täglich Erklärungen von Kirchenführern, die mit der katholischen Lehre kollidieren
Leider findet man fast täglich Erklärungen und Vorschläge von hohen Kirchenführern, die mit der Tradition, der Moral oder der katholischen Lehre kollidieren. Kurz gesagt, sie stehen im Widerspruch zu der im Evangelium enthaltenen Wahrheit, wie Pater Serafino Maria Lanzetta in einer großen Lectio aufzeigte.
Der synodale Weg wird, nicht nur in Deutschland, genutzt, um bestimmte Aspekte der Katholizität umzuschreiben. Jeder kennt die in bestimmten kirchlichen Kreisen seit den 60er Jahren vorherrschende Besessenheit, die Sexualmoral der Kirche, die Haltung zur Homosexualität, den priesterlichen Zölibat oder auch die Öffnung des Diakonats und des Priesteramts für Frauen zu ändern.
Es hat keinen Sinn, es zu leugnen: „Es gibt ein ehrgeiziges Projekt zur Reform der Weltkirche, das die Gefahr birgt, sie aus den Angeln zu heben oder sie auf einer anderen Grundlage neu zu erfinden als der, die unser Herr gewollt hat“ (Diego Benedetto Panetta: Der deutsche synodale Weg und das Projekt einer neuen Kirche, veröffentlicht von Tradizione Famiglia Proprietà).
Die Befürworter dieser radikalen Veränderungen innerhalb der Kirche behandeln die Braut Christi wie eine politische Partei, die einen (liberal-demokratischen) „Kongreß“ organisiert, um einige ihrer Postulate durchzusetzen, um ihre Wählerbasis zu verbreitern, und alles um den Preis, selbst mit den Gründungsprinzipien der Kirche zu brechen. Wie man umgangssprachlich sagt, ist in der Politik alles erlaubt, oder „der Zweck heiligt die Mittel“, aber hier geht es nicht um Politik. Es geht darum, den Glauben und die Wahrheit zu bewahren, die uns in einer 2000 Jahre alten Tradition überliefert worden sind, um sie unversehrt weiterzugeben, damit wir das ewige Seelenheil erlangen und auch jene, die nach uns kommen.
Der ehrwürdige Pius XII. erinnerte in seiner Enzyklika Doctor Mellifluus zum 800jährigen Todestag des heiligen Bernhard von Clairvaux (24.5.1953):
„Der heilige Bernhard, wenn er die Irrtümer Abaelards bekämpft, ‚der, wenn er von der Dreifaltigkeit spricht, Arius anklingen läßt; wenn er von der Gnade spricht, Pelagius; wenn er von der Person Christi spricht, Nestorius‘, diskutiert nicht die subtilen, verschlungenen und trügerischen Irrtümer und Spitzfindigkeiten, sondern löst sie auf und widerlegt sie, aber er schreibt auch an Unseren Vorgänger unsterblichen Andenkens Innozenz II. aus ähnlichem Grund diese schwerwiegenden Worte: ‚Es ist notwendig, Eure apostolische Autorität auf jede Gefahr hinzuweisen … vor allem auf jene, die den Glauben betreffen. Ich halte es für richtig, daß vor allem dort die Schäden am Glauben behoben werden sollen, wo es ohne den Glauben nicht geht. Und das ist das Vorrecht dieses Stuhles… Es ist an der Zeit, geliebter Vater, daß Ihr Eure Vollmacht erkennt… Darin tut Ihr wahrhaftig die Dinge des Petrus, dessen Stuhl Ihr einnehmt, wenn Ihr mit Euren Warnungen die unsicheren Seelen im Glauben bestärkt, wenn Ihr mit Eurer Autorität die Verderber des Glaubens ausrottet.“
Die Welt für die Wahrheit gewinnen
Und ja, es muß alles bewahrt bleiben, denn die Wahrheit ändert sich nicht je nach den sozialen Bedürfnissen und paßt sich auch nicht der Welt an. Die Hauptaufgabe der Kirche und damit des Papstes und der Bischöfe (und damit der Synoden) besteht darin, die Welt für die Wahrheit zu gewinnen – „verwurzelt im Glauben“ (vgl. Kol 2,7), nicht in der Synodalität – und diese auf keinen Fall zu verdunkeln, zu verschleiern oder zu verändern, auch nicht unter dem falschen Vorwand, sie „freundlicher“ zu machen, oder sie den Moden anzupassen, um sie attraktiver zu machen.
Der heilige Bischof Irenäus hat es schon vor über 1800 Jahren in seiner Abhandlung „Gegen die Häresien“ (Lib. 1, 10, 1–3; PG 7, 550–554) ausgedrückt:
„Die Kirche, die eine solche Botschaft und einen solchen Glauben empfangen hat, hütet sie mit äußerster Sorgfalt, alle vereint, als lebten sie in einem Haus, obwohl sie überall verstreut sind. Sie hält einmütig daran fest, als ob sie nur eine Seele und ein Herz hätte. Sie verkündet sie, lehrt sie und überliefert sie einmütig, als besäße sie einen einzigen Mund. Denn obwohl es verschiedene Sprachen in der Welt gibt, ist die Kraft der Tradition ein und dieselbe. Daher glauben und überliefern die in Germanien gegründeten Kirchen nicht eine andere Lehre als die in Spanien oder in den Ländern der Kelten oder im Osten oder in Ägypten oder in Libyen oder in der Mitte der Welt. Wie die Sonne, Gottes Geschöpf, im ganzen Universum einzigartig ist, so scheint die Verkündigung der Wahrheit überall und erleuchtet alle Menschen, die zur Erkenntnis der Wahrheit kommen wollen. Und so verkündet auch unter den Kirchenvorstehern niemand eine andere Lehre als diese; denn niemand steht über seinem Herrn. Ob ein großer Redner oder ein schlechter Redner, alle lehren dieselbe Wahrheit. Keiner setzt den Inhalt der Tradition herab. Ein und dasselbe ist der Glaube. Deshalb kann ihn weder der Erhabene bereichern noch der Stotterer verarmen…“
Wie sollte man nicht die Worte des heiligen Paulus in den Mittelpunkt der Pflicht einer Synode oder auch der Synodalität stellen wollen? Er erinnert uns:
„Ich beschwöre dich vor Gott und Christus Jesus, der kommen wird, um die Lebenden und die Toten zu richten, bei seinem Erscheinen und bei seinem Reich: Verkünde das Wort, beharre bei jeder Gelegenheit, sei sie gelegen oder ungelegen, ermahne, weise zurecht, tadle in unermüdlicher und geduldiger Belehrung. Denn es wird der Tag kommen, an dem die gesunde Lehre nicht mehr ertragen wird, sondern die Menschen sich aus einem Verlangen heraus, etwas zu hören, mit Lehrern umgeben werden, die ihren eigenen Begierden entsprechen, und sich weigern, auf die Wahrheit zu hören, und sich Fabeleien zuwenden. Du aber sei wachsam, ertrage Mühsal, tue deine Werk als Verkünder des Evangeliums, erfülle treu deinen Dienst“ (2 Tim 4,1–6).
Und wie könnten wir die Warnung des Propheten Ezechiel vergessen?
„Wenn der Schuldige sich von allen Sünden, die er getan hat, abwendet, auf alle meine Gesetze achtet und nach Recht und Gerechtigkeit handelt, dann wird er bestimmt am Leben bleiben und nicht sterben. Keines der Vergehen, deren er sich schuldig gemacht hat, wird ihm angerechnet. Wegen seiner Gerechtigkeit wird er am Leben bleiben. Habe ich etwa Gefallen am Tod des Schuldigen – Spruch Gottes, des Herrn – und nicht vielmehr daran, daß er seine bösen Wege verläßt und so am Leben bleibt? Wenn jedoch ein Gerechter sein rechtschaffenes Leben aufgibt, wenn er Unrecht tut und all die Greueltaten begeht, die auch der Böse verübt, sollte er dann etwa am Leben bleiben? Keine seiner gerechten Taten wird ihm angerechnet. Wegen seiner Treulosigkeit und wegen der Sünde, die er begangen hat, ihretwegen muß er sterben. Ihr aber sagt: Das Verhalten des Herrn ist nicht richtig. Hört doch, ihr vom Haus Israel: Mein Verhalten soll nicht richtig sein? Nein, euer Verhalten ist nicht richtig. Wenn der Gerechte sein rechtschaffenes Leben aufgibt und Unrecht tut, muß er dafür sterben. Wegen des Unrechts, das er getan hat, wird er sterben. Wenn sich der Schuldige von dem Unrecht abwendet, das er begangen hat, und nach Recht und Gerechtigkeit handelt, wird er sein Leben bewahren. Wenn er alle Vergehen, deren er sich schuldig gemacht hat, einsieht und umkehrt, wird er bestimmt am Leben bleiben. Er wird nicht sterben.“ (Ez 18,21–28).
Non possumus!
Ist es nicht seit Jahren so in der Kirche, daß das Thema, früher des Konzils, heute der Synodalität ausgenutzt und instrumentalisiert wird? Wir beobachten, wie die Einladung des Synodalismus darin besteht, die geoffenbarte Wahrheit an den schläfrigen Menschen unserer Zeit anzupassen, der träge und langsam ist, wenn es darum geht, Tugend zu erwerben und sich zu bekehren, indem er seine Sünde erkennt und zurückweist. Es geht nicht darum, die Kirchen mit Menschen zu füllen, um irgendwie das Gewissen zu beruhigen und den Anschein zu erwecken, daß eine Aufgabe der Evangelisierung der Gesellschaft erfüllt wird, indem man unverhältnismäßig viel von „Früchten“ spricht…, die sich nicht zeigen.
Die Heilige Mutter Kirche hat keine größere Motivation als die, Seelen zum Heil zu führen. Deshalb ist es notwendig, jene anzuprangern und beim Namen zu nennen, die sich stattdessen der Verwirrung der Seelen auf der Grundlage der Prostitution widmen, d. h. des Verrats und der Kommerzialisierung des Leibes der Kirche, indem sie so weit gehen, die Wahrheit den individuellen Wünschen anzupassen. Den Protestantismus gibt es bereits…, den brauchen wir heute nicht mehr zu erfinden.
Da wir mit Paul VI. begonnen haben, sollten wir uns an ihn erinnern: Bei der Generalaudienz am 19. Januar 1972 kehrte er noch einmal zum genannten Konzept zurück, um zu wiederholen, daß das Depositum fidei fest und unantastbar ist. Zugleich beklagte er die ernsten Abweichungen von der Lehre innerhalb der Kirche, indem er die Enzyklika Pascendi Dominici gregis des heiligen Papstes Pius X. zitierend sagte:
„So ist es, geliebte Kinder, und indem wir dies bekräftigen, distanziert sich unsere Lehre von den Irrtümern, die in der Kultur unserer Zeit zirkulierten und immer noch zirkulieren und die unsere christliche Lebens- und Geschichtsauffassung völlig zerstören könnten. Der Modernismus war der charakteristische Ausdruck dieser Irrtümer, und unter anderen Namen ist er immer noch aktuell.“
In bewundernswerter Weise prangerte er das modernistische Denken mit diesen erhabenen Worten an und bekräftigte:
„Wir können daher verstehen, warum die katholische Kirche gestern und heute so viel Wert auf die strenge Bewahrung der authentischen Offenbarung legt und sie als einen unantastbaren Schatz betrachtet und ein so strenges Bewußtsein von ihrer grundlegenden Pflicht hat, die Glaubenslehre zu verteidigen und unzweideutig weiterzugeben; die Rechtgläubigkeit ist ihr erstes Anliegen; das Hirtenamt ist ihre erste und der Vorsehung gemäße Funktion; die apostolische Lehre bestimmt in der Tat den Kanon ihrer Predigt; und die Überlieferung des Apostels Paulus: Depositum custodi (1 Tim 6,20; 2 Tim 1,14) stellt eine solche Verpflichtung für sie dar, daß es Verrat wäre, sie zu verletzen. Die Kirche als Lehrerin erfindet ihre Lehre nicht; sie ist Zeugin, sie ist Verwahrerin, sie ist Auslegerin, sie ist Vermittlerin; und was die der christlichen Botschaft eigenen Wahrheiten betrifft, kann man sagen, daß sie konservativ und unnachgiebig ist; und denen, die sie drängen, ihren Glauben leichter zu machen, dem Geschmack der sich wandelnden Mentalität der Zeit anzupassen, antwortet sie mit den Aposteln: Non possumus, wir können nicht (Apg 4,20).“
Wenn sie uns also auf der Synode und im Namen der Synodalität neue Lehren aufzwingen wollen, die den Moden der Welt folgen, sind wir befugt, mit den Worten Pauls VI. und der ganzen Kirche, weil es die Worte der Apostel sind, barmherzig, aber unnachgiebig zu antworten: Non possumus, wir können nicht!
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Wikicommons/MiL/Vatican.va (Screenshots)