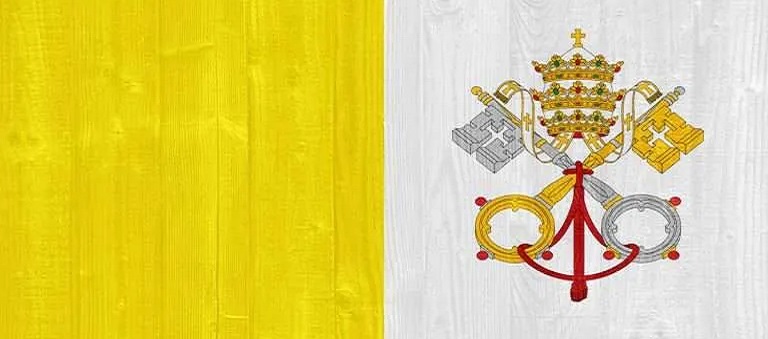
Von Niccolò Tedeschi*
Wenn das Rescriptum ex Audientia Ss.mi vom 21. Februar 2023 – das ein Verwaltungsakt ist, mit dem ein Abteilungsleiter am Ende einer Audienz (ex Audientia) den Papst (Sanctissimi) um etwas bittet und es auch erhält (Rescriptum bedeutet „zweimal geschrieben“) – formal darauf abzielt, das Motu Proprio Traditionis custodes vom 16. Juli 2021 „umzusetzen“, ändert es in praktischer Hinsicht in Wirklichkeit dessen substantielle Struktur.
Das Reskript untergräbt nämlich die Grundlage von Traditionis custodes, dessen erste Worte, ein Echo von Lumen gentium Nr. 23 (der dogmatischen Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Kirche), an die Bischöfe gerichtet sind. Die Präambel des Motu proprio von Papst Franziskus, das das Motu proprio Summorum Pontificum von Benedikt XVI. abändert, beginnt wie folgt:
„Als Wächter der Tradition stellen die Bischöfe in Gemeinschaft mit dem Bischof von Rom das sichtbare Prinzip und Fundament der Einheit in ihren Teilkirchen dar.“
Wenn Traditionis custodes auf die Diözesanbischöfe abzielte, um den Gebrauch der liturgischen Formen zu regeln, die vor den nachkonziliaren Reformen in Geltung waren, so hebt das Reskript vom 21. Februar diesen Grundsatz auf, indem es dem Heiligen Stuhl (und damit dem Dikasterium für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung) die Regelung einer ganzen Angelegenheit vorbehält, die durch dieselbe Bestimmung, die das Reskript nach eigenen Angaben „umsetzen“ will, dem Ermessen der einzelnen Ortsordinarien überlassen wurde. Wir stehen also vor einem kafkaesken Paradox – einem logischen, aber auch rechtlichen –, bei dem dieselbe Autorität, die mit einem normativen Akt eine Sache anordnet, mit einem nachfolgenden Akt de facto den vorherigen Grundsatz aufhebt, ohne jedoch diese „Umkehrung“ zu formalisieren, und somit einen unlösbaren Widerspruch hinterläßt.
Wenn in der Tat Traditionis custodes in Art. 2 in Anlehnung an das erwähnte Konzilslehramt unzweifelhaft bekräftigt:
„Dem Diözesanbischof als Leiter, Förderer und Wächter des gesamten liturgischen Lebens in der ihm anvertrauten Teilkirche obliegt die Regelung der liturgischen Feiern in der eigenen Diözese. Daher ist es seine ausschließliche Zuständigkeit, den Gebrauch des Missale Romanum von 1962 in seiner Diözese zu gestatten und dabei den Weisungen des Apostolischen Stuhles zu folgen“,
schränkt das Reskript vom 21. Februar diese Zuständigkeit ein, obwohl sie als „ausschließlich“ definiert ist, und bekräftigt, daß es einen neuen Zuständigkeitsvorbehalt des Apostolischen Stuhls gemäß dem letzten Teil von can. 87, §1 des Codex des kanonischen Rechts gibt. Dieser Canon legt nämlich folgendes fest:
„Der Diözesanbischof kann die Gläubigen, sooft dies nach seinem Urteil zu deren geistlichem Wohl beiträgt, von Disziplinargesetzen dispensieren, sowohl von allgemeinen als auch von partikularen, die von der höchsten Autorität der Kirche für sein Gebiet oder für seine Untergebenen erlassen worden sind, nicht aber von das Prozeß- oder Strafrecht betreffenden Gesetzen noch von solchen, deren Dispens dem Apostolischen Stuhl oder einer anderen Autorität besonders vorbehalten ist.“
Auf den ersten Blick scheint die Frage unklar: Warum in aller Welt wird in einem Reskript über den Gebrauch der Liturgie vor der Liturgiereform von 1969/70 der Canon über die Dispensen erwähnt, d. h. die Befreiung von einem rein kirchlichen Gesetz, die der Bischof in einem Einzelfall gewähren kann (vgl. can. 85)? Die Antwort liegt in der Praxis, die sich in einigen Diözesen nach dem Inkrafttreten des Motu Proprio Traditionis custodes herausgebildet hat, durch die einige Ordinarien es für angebracht hielten – in Ausübung des Ermessens, das ihnen das Motu Proprio selbst zuerkannt hat –, sich von der Einhaltung der päpstlichen normativen Anordnung zu dispensieren, indem sie ihren Diözesanpriestern die Erlaubnis erteilten, die heilige Messe nach den Rubriken des Missale von 1962 zu zelebrieren, diese Zelebrationen in Pfarrkirchen zu feiern oder Personalpfarreien und ‑kaplaneien des überlieferten Ritus zu errichten. Dies veranlaßte den eifrigen Präfekten des Dikasteriums für den Gottesdienst, den inzwischen zum Kardinal erhobenen Arthur Roche, trotz der Tatsache, daß es sehr genaue Normen zu diesem Thema gab, die nicht weniger als vom Papst selbst diktiert wurden (vgl. Traditionis custodes, Art. 3 und 4) und mit denen sich der Heilige Stuhl in detaillierter Weise das Recht vorbehielt, nur „Orientierungen“ zu geben, wahrscheinlich angestachelt durch eine unvorsichtige Öffentlichkeitsarbeit „traditionalistischer“ Blogs, bei mehreren Gelegenheiten verschiedene Bischöfe zu maßregeln, die es „gewagt“ hatten, sich nicht sklavisch an das Motu Proprio von Papst Franziskus zu halten, und dabei genau die Möglichkeit von Canon 87, §1 CIC genutzt hatten.
Das ist also die faktische Prämisse, von der das Reskript vom 21. Februar zweifellos ausgeht, dem bereits akribische Responsa ad dubia mit den geradezu fanatischen Erläuterungen vom 4. Dezember 2021 vorausgingen, deren Inhalt in jedem Fall weit über den oben genannten Begriff der „Orientierungen“ [in der deutschen Übersetzung auf der Internetseite des Heiligen Stuhls mit „Weisungen“ wiedergegeben, Anm. GN] in Artikel 2 von Traditionis custodes hinausging.
Darüber hinaus scheint das Reskript diesen Responsa ein weiteres Siegel der „authentischen Legitimität“ aufdrücken zu wollen, indem es hervorhebt, daß sie bei der jüngsten Audienz nach der seinerzeit erteilten Zustimmung zur Veröffentlichung noch einmal „bestätigt“ wurden. Dies bedeutet jedoch nicht, daß der betreffende Akt per se als „päpstlich“ betrachtet werden kann und aus diesem Grund als „unanfechtbar“ zu betrachten ist, sondern nur, daß er aufgrund der für die Veröffentlichung erhaltenen übergeordneten Zustimmung eine gewisse Stabilität genießt (wie es kürzlich mit dem Responsum ad dubium zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare am 21. Februar 2021 geschehen ist).
Man denke nur an all die Dekrete der Dikasterien, die „in besonderer Form approbiert“ wurden und persönliche Bestimmungen wie die Entlassung aus dem Kleriker- oder Ordensstand als Ergebnis dubioser Verwaltungsverfahren enthalten: Bei solchen Akten übernimmt der Papst ipso facto durch seine Unterschrift die Urheberschaft und damit implizit die Verantwortung, ohne daß er wahrscheinlich tatsächlich und vollständig über den Inhalt oder die Geschehnisse in diesem Einzelfall Bescheid weiß. Es handelt sich also um eine ungesunde und sehr gefährliche Praxis, denn sie macht den Papst durch einen zersetzenden Verwaltungsmechanismus, der jeder Rechtsgarantie entbehrt, weil er in absolut willkürlichem Ermessen kreist, zum Komplizen der Verwaltung selbst und damit faktisch zur Geisel der Entscheidungen anderer. Angesichts dessen – und ohne in einen komplexen und schlüpfrigen Sumpf eindringen zu wollen – verliert nicht nur die Bestätigung der Zustimmung, sondern auch das Reskript selbst in gewisser Weise seinen Wert, sowohl rechtlich als auch moralisch, denn wenn bis vor einiger Zeit diese besonderen Verfahren (wie sie von der geltenden Ordnung der Römischen Kurie anerkannt wurden, vgl. Art. 126) den Sinn hatten, in besonderer Weise das Eingreifen des Papstes in Glaubens- und Sittenfragen zu unterstreichen, so scheinen sie heute eher die Zurschaustellung einer gezwungenen Absicherung zu sein, hinter der sich eine tiefe und peinliche Unsicherheit verbirgt: Galt nämlich früher der beruhigende Spruch Roma locuta, quaestio soluta, so scheint es heute eher so zu sein, daß die Position, die Rom einnimmt, der Ursprung von Chaos, Rechtsunsicherheit und somit institutioneller Instabilität ist, was sehr oft zu peinlichen Widersprüchen führt.
Kehren wir jedoch zum Thema des Reskriptes zurück, so scheint es offensichtlich, daß der Vorbehalt des verkündeten Gesetzes bezüglich der Erteilung von Lizenzen und der Angabe der Modalitäten für die Zelebration der Messe nach dem überlieferten Ritus in offenem Widerspruch sowohl zu dem steht, was bereits durch das Motu Proprio selbst festgelegt wurde, das man paradoxerweise vorgibt, damit „umzusetzen“, als auch und vor allem – wie vor kurzem auch Kardinal Müller in einem Interview bemerkte – zu den Normen des göttlichen Rechts, die die Vollmacht der Diözesanbischöfe regeln.
Wenn heute ein Bischof nicht in der Lage ist – denn darum geht es – zu erkennen, ob auf dem Gebiet seiner eigenen Diözese die Bedingungen für eine Ausweitung des Gebrauchs des alten Meßbuches ohne die vorherige Zustimmung des Dikasteriums gegeben sind, und es sogar seine eigene Macht im Gebrauch der liturgischen Bücher einschränkt, indem ihm der Gebrauch des Pontificale in den Pfarreien untersagt wird, dann kann man sagen, daß die gesamte Theologie über die hierarchische Verfassung der Kirche, die zuletzt im Konzilslehramt über die Bischöfe formalisiert wurde, faktisch für null und nichtig erklärt wurde und einer noch nie dagewesenen und ebenso gefährlichen Form der monokratischen und selbstbezogenen Regierung Platz gemacht hat.
Wenn man nämlich liest, was im Reskript steht: „Sollte ein Diözesanbischof in den beiden oben genannten Fällen Dispensen erteilt haben, ist er verpflichtet, das Dikasterium für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung zu informieren, das die einzelnen Fälle beurteilen wird“, ist man bestürzt über den offensichtlichen kurialen Kontrollwillen, der nicht nur gegen ein Prinzip des Rechtswesens verstößt, daß Gesetze für die Zukunft gelten und eine rückwirkende Norm etwas Außergewöhnliches ist (vgl. can. 9), sondern auch, weil er die bereits von den einzelnen Bischöfen getroffenen Entscheidungen in Zweifel zieht (indem er versucht, sie zu Unrecht als Maßnahmen zu betrachten, die ihren Wert fast verloren hätten), und die nun auf beschämende Weise „verpflichtet“ sind, dem Apostolischen Stuhl mitzuteilen, was sie in voller Ausübung ihrer legitimen Funktionen durch die Anwendung einer Norm des allgemeinen Rechts entschieden haben. Andererseits ist es offensichtlich, daß das, was bereits entschieden wurde, objektiv und rechtlich nicht angreifbar ist, also durch die neue Bestimmung nicht berührt wird.
- Eine so manische Hyperkontrolle durch das Dikasterium für den Gottesdienst, zusammen mit dieser obsessiven Form der Standardisierung im heutigen zutiefst anti-legalistischen Zeitalter, das gegenüber „Regeln“ offenkundig feindlich ist und vielmehr offen ist für fließende Modelle, mag erstaunen.
- Es mag auch überraschen, daß man in einer Zeit, in der täglich Sakrilegien und Profanierungen vorkommen, sehr oft unter dem Schweigen und der mitschuldigen Blindheit der Institutionen, die Grenzen dessen, was einem Bischof in seiner eigenen Diözese erlaubt ist, so minutiös definiert und sogar verhindert, daß ein Priester die Zelebration im überlieferten Ritus halten kann, während sich niemand um die vier Messen kümmert, die ein guter Pfarrer im Durchschnitt jeden Sonntag in einem immer größeren Territorium feiert, in dem es immer weniger Priester gibt.
- Es erscheint absurd, sich vorzustellen, daß der Heilige Stuhl im Zeitalter der „kreativen Liturgien“, in denen heidnische Symbole auf geweihten Altären gezeigt werden, in denen Gesten von offensichtlich verstörendem sakrilegischem Stil gemacht werden, in denen Priester sich maskieren, in denen Messen auf Luftmatratzen mitten im Meer gefeiert werden, so sehr das Bedürfnis verspürt, chirurgisch zu bekräftigen, daß zwar der Gebrauch des Missale geduldet wird, das Pontificale in den Pfarreien aber nicht mehr gestattet ist, und daß es erlaubt ist, den Gläubigen, die diese rituelle Form bevorzugen, die Möglichkeit zu nehmen, z. B. die Firmung im überlieferten Ritus zu empfangen.
- Man könnte sich über die Besessenheit wundern, mit der seit Jahren das einzige Problem der kirchlichen Disziplin die Unterdrückung „traditionalistischer Tendenzen“ zu sein scheint, während sich andererseits die Kirchen, Seminare, Klöster und Konvente leeren, die Morallehre Psychologismen von zweifelhafter Beschaffenheit weicht und faktisch ein Klima der Gedankenpolizei herrscht, laut dem jeder tun kann, was er will, während verboten ist, das zu tun, was immer getan wurde.
In Wirklichkeit liegt auf der Hand, daß dies ein Hinweis auf den Grad einer tiefen Angst und Unsicherheit ist, den die Neuerer bei der Durchführung von Revolutionen haben: Während die Tradition die Festigkeit und Robustheit ihrer Grundsätze besitzt und daher die Konfrontation mit der Vielfalt nicht fürchtet, mit der sie sich verflicht und weiterentwickelt, indem sie sich noch mehr konsolidiert und in die Zukunft projiziert, ist dies bei der Revolution nicht der Fall, die nichts anderes tun kann, als ihre „Vision“ mit Hilfe jener Gewalt durchzusetzen, die sie in Frage gestellt hat und von der sie glaubt, sie verworfen zu haben: die Auctoritas. In den Systemen des Rechtswesens gilt jedoch „veritas non auctoritas facit legem“: Nicht die Willkür und auch nicht die bloße Machtausübung bilden die Grundlage der als verbindlich zu betrachtenden Norm – wie Hobbes im Gegenteil argumentierte –, sondern die nicht verhandelbaren Grundsätze des göttlichen Rechts und des Naturrechts. Die gewaltsame Durchsetzung eines Gesetzes hat noch nie etwas Gutes bewirkt, und andererseits haben revolutionäre Aktionen selbst bekanntlich früher oder später immer in grausamen Saturnalien geendet.
Was sich abzeichnet – und schon seit einiger Zeit im Gange ist –, ist ein beispielloser Kampf in der Geschichte der Kirche, mit zwei gleich entschlossenen, aber ungleichen Fronten, die eine in bezug auf die Zahl, die andere in bezug auf die „institutionelle Stärke“. Allerdings ist der heutige Kampf nicht derselbe wie der unmittelbar nach dem Konzil, denn seitdem sind die Reihen derer, die sich von der Schönheit der Tradition bewegen lassen, viel dichter als damals: Damals gab es eine andere Gesellschaft, einen anderen Gehorsam…, dennoch besaß nicht einmal Paul VI., der das neue Missale promulgierte, die Kühnheit, das vorherige für ungültig zu erklären, wohl wissend um das Anathema der Bulle Quo primum tempore von Pius V.
Andererseits hat die traditionelle Liturgie – bei allem Respekt vor den Weisen des Dikasteriums für den Gottesdienst – eine so umfangreiche strukturelle Komplexität, daß es eine reine Torheit wäre, zu glauben, man könne alles „normieren“, weshalb es immer Wege und Winkelzüge geben wird, die das Überleben der alten Liturgie ermöglichen, wie es bereits der Fall war.
Und wenn sich auch die Gerüchte verdichten, daß dieses jüngste Dokument nur die Spitze des Eisbergs eines wieder aufflammenden Krieges ist, und wenn heute die Bischöfe gemaßregelt werden, wird man morgen auch jene maßregeln, die noch von der Einhaltung von Traditionis custodes befreit sind (d. h. die sogenannten Ecclesia-Dei-Gemeinschaften), muß in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen werden, daß ein restriktives und strafendes Vorgehen gegen sie unweigerlich zu einem immensen Bruch in der Einheit der Kirche führen würde, da es wahrlich übel wäre, sie ipso facto aus der Gemeinschaft auszuschließen, wenn sie sich nicht dem einzigen reformierten Ritus anpassen. Andererseits wäre unter den gegebenen Umständen und bei der Qualität, die der Gehorsam in einer Kirche hat, die sich in einer vollen Krise des Autoritätsprinzips befindet, eine massenhafte Unterdrückung nicht denkbar, da sie eher das Gegenteil bewirken würde.
*Niccolò Tedeschi ist ein Pseudonym in Anspielung an Niccolò de Tedeschi (Nicolaus de Tudeschis), einen namhaften Kirchenrechtler (1386–1445) deutscher Abstammung, der in Catania auf Sizilien geboren wurde. 1400 trat er in seiner Heimatstadt in den Benediktinerorden ein, lehrte Kirchenrecht an den Universitäten von Parma, Siena und Bologna, war Domherr in Catania, Auditor der Apostolischen Kammer in Rom, Abt von S. Maria di Maniace, Päpstlicher Delegat beim Konzil von Basel und schließlich Erzbischof von Palermo. 1442 sprach er auf dem Reichstag in Frankfurt am Main. Zahlreich sind seine Veröffentlichungen zur Rechtskunde.
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Corrispondenza Romana




