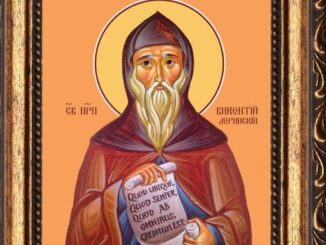(Rom) Papst Franziskus prägte den Indietrismus als Wortneuschöpfung, um sein Motu proprio Traditionis custodes zu verteidigen, mit dem er den überlieferten Ritus abwürgen will, vor allem außerhalb der ehemaligen sogenannten Ecclesia-Dei-Gemeinschaften. Allerdings sind auch diese durch übereifrige Diözesanbischöfe von den Restriktionen betroffen, teils schwer.
Indietrismus, wörtlich am ehesten mit Rückwärtsgewandtheit zu übersetzen, wird von Franziskus nicht nur im Italienischen gebraucht. Das Kirchenoberhaupt meint damit nicht so sehr das Verharren in der Vergangenheit, sondern den Wunsch, in diese zurückzukehren. Es geht nicht um ein passives, sondern ein aktives, dynamisches Element, das Franziskus tadelt. Das ist es auch, was Franziskus so sehr zu fürchten scheint, daß er eine spaltende Wirkung unterstellt, obwohl von traditioneller Seite weder die kirchliche Ordnung noch die Glaubenslehre angezweifelt werden, ganz im Gegenteil.
Es geht um ein Paradox, das sich nur dadurch erklärt, wenn jemand, in diesem Fall nicht die Kirche an sich, sondern die „nachkonziliare“ Kirche, sich um ihre Zukunft sorgt. Die Sache ist Santa Marta so in Mark und Bein gefahren, daß Franziskus ganz fixiert auf seine Kritik am „Indietrismus“ wirkt. Heute kam er (schon) wieder darauf zu sprechen. Anlaß war seine Ansprache an die Mitglieder der Internationalen Theologenkommission, die bei der Glaubenskongregation angesiedelt ist. Die Begegnung fand im Konsistoriumssaal des Apostolischen Palastes statt.
Vorsitzender der Theologenkommission ist von Amts wegen der Präfekt der Glaubenskongregation, derzeit Kardinal Luis Ladaria Ferrer SJ. Generalsekretär ist seit 2021 der Theologe Piero Coda. Einen beigeordneten Sekretär gibt es nicht mehr, seit sich der letzte Amtsinhaber, der polnische Priester Krzysztof Charamsa, 2015 mit seinem homosexuellen Liebhaber und großem Medienrummel aus dem Staub machte. Der aktuellen Kommission (2021–2026) gehört auch ein Deutscher an, der ursprünglich lutherische Theologe Reinhard Hütter, der 2004 zur katholischen Kirche konvertierte und Professor für Fundamentaltheologie und Dogmatik an der Katholischen Universität von Amerika in Washington D.C. ist.
Den Mitgliedern der Internationalen Theologenkommission sagte Franziskus heute:
„Die Tradition, der Ursprung des Glaubens, wächst oder stirbt entweder. Denn, wie jemand einmal sagte – ich glaube, es war ein Musiker –, die Tradition ist die Garantie für die Zukunft und kein Museumsstück. Sie ist das, was die Kirche von unten nach oben wachsen läßt, wie ein Baum: die Wurzeln. Ein anderer sagte, der Traditionalismus sei der ‚tote Glaube der Lebenden‘: wenn man sich verschließt. Die Tradition – das möchte ich betonen – bringt uns dazu, uns in diese Richtung zu bewegen: von unten nach oben, vertikal. Heute besteht die große Gefahr, das ist, in die andere Richtung zu gehen: der Indietrismus. Zurückzugehen. ‚Das wurde schon immer so gemacht‘: Es ist besser, rückwärts zu gehen, das ist sicherer, anstatt mit der Tradition vorwärtszugehen. Diese horizontale Dimension hat, wie wir gesehen haben, einige Bewegungen, kirchliche Bewegungen, dazu gebracht, in einer Zeit zu verharren, in einer rückwärtsgewandten Richtung. Sie sind die Indietristen. Ich denke – um einen historischen Bezug herzustellen – an einige Bewegungen, die am Ende des Ersten Vatikanischen Konzils entstanden sind und versuchten, der Tradition treu zu bleiben, und sich heute so entwickeln, daß sie die Frauen weihen, und andere außerhalb dieser vertikalen Richtung, in der das moralische Gewissen wächst, das Gewissen des Glaubens wächst, mit jener schönen Regel von Vinzenz von Lérins: ‚ut annis consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur aetate‘ (‚damit es sich mit den Jahren festige, sich mit der Zeit entwickle, sich mit dem Alter vertiefe‘). Dies ist die Regel des Wachstums. Stattdessen führt der Indietrismus dazu, daß man sagt: ‚Das war schon immer so, es ist besser, so weiterzumachen‘, und läßt einen nicht wachsen. Zu diesem Punkt denkt Ihr Theologen ein wenig darüber nach, wie Ihr helfen könnt.“
Text: Giuseppe Nardi
Bild: Vatican.va (Screenshot)