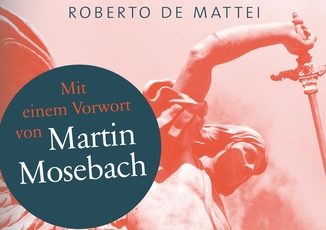Von Wolfram Schrems*
David Engels, deutsch-belgischer Historiker und den Lesern dieser Seite bereits bekannter erfolgreicher Autor („Was tun?“) mit Wohnsitz in Warschau, verfaßte auf Anregung des polnischen Soziologen und Europaparlamentariers Zdzisław Krasnodębski (Partei Recht und Gerechtigkeit, PiS) und der polnischen „Künstlervereinigung für die Republik“ (Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczypospolitej) eine Präambel (im Buch abgedruckt, hier einsehbar) zu einer zu schaffenden Europäischen Verfassung. Dieses Projekt wird von der Parlamentsgruppe der Europäischen Konservativen und Reformer unterstützt. Deren Vorsitzender ist Professor Ryszard Legutko, dessen Dämon der Demokratie hier bereits vorgestellt wurde.
Das Ziel von Professor Engels und seiner Verbündeten ist ein gesamteuropäischer Patriotismus bei bleibender Existenz der Nationalstaaten und einer verfassungsmäßig eingehegten europäischen Zentralgewalt, die nur für Außenpolitik und Verteidigung zuständig sein soll. Engels bezeichnet seine Leitidee als „Hesperialismus“, eine stolze und geschichtsbewußte abendländische, westliche Orientierung (von ἑσπέρα, Abend).
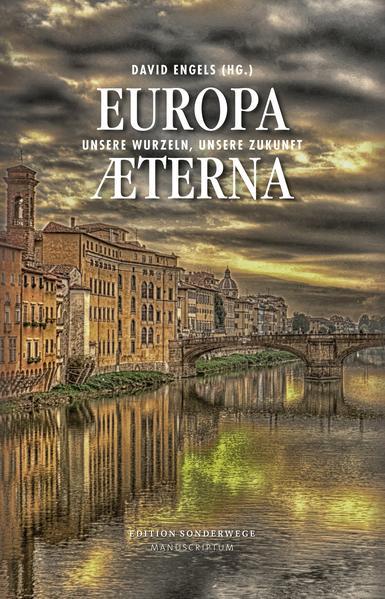
Gleichgültig, ob man eine solche Verfassung für nötig hält oder nicht: Die von Engels ausgearbeitete Präambel ist brillant. Sie thematisiert auch die alttestamentlichen und christlichen Wurzeln Europas. Daher ist der gegenständliche Sammelband für die Leser einer katholischen Netzseite von größtem Interesse. (Dieser ist nach Renovatio Europae – Für einen hesperialistischen Umbau Europas von 2019 bereits der zweite zum betreffenden Thema.)
Daher hier eine ausführliche Würdigung.
Philosophen, Ökonomen, Künstler und Juristen – Gelehrte, Politiker und Praktiker
Zu dieser Präambel verfaßten einundzwanzig Autoren, unter ihnen Professor Engels selbst, Kommentare, die jeweils verschiedene ihrer Inhalte näher beleuchten. Diese Kommentare sind knapp, prägnant und profund. Der Tenor ist äußerst kritisch gegenüber der existierenden EU.
Mit Hw. Markus Stephan Bugnyár, Rektor des österreichischen Hospizes in Jerusalem, ist auch der Klerus vertreten. Die meisten Autoren sind katholisch. Fünf sind Polen. Zu den international prominenten gehören die französische Philosophin und Romanautorin Chantal Delsol, der Historiker Egon Flaig und der Architekt und Städtebauer Léon Krier. Im deutschen Sprachraum bekannt sind auch der protestantische Philosoph Harald Seubert, der Politikwissenschaftler Felix Dirsch, der deutsch-chilenische Lebensrechtler Mathias von Gersdorff (TFP), Schulleiter und Tolkien-Experte Michael Hageböck, sowie der belgisch-österreichische Philosoph und Eric-Voegelin-Kenner Christian Machek.
Aufgrund der Fülle an guten bis sehr guten Beiträgen mit vielen wichtigen Gedanken können hier nur einige wenige herausgegriffen werden.
Grundsätze, Axiome und Gott
Philipp Bender argumentiert für die Notwendigkeit einer europäischen Verfassung. Er kritisiert das mangelnde Geschichtsbewußtsein, die massive Ablehnung jeden Gottesbezugs und die wenig oder nicht deklarierten weltanschaulichen Voraussetzungen der offiziellen EU-Europäer. Mit dem jüdisch-amerikanischen Europarechtsexperten Joseph Weiler bezichtigt er die EU der „Christophobie“ (37).
Eindrucksvoll ist die Darlegung der Geschichte der Beziehungen zwischen geistlicher und politischer Macht und des Einflusses der sogenannten „Aufklärung“ durch Felix Dirsch.
Großartig ist auch Andreas Kinneging über das „gute Leben“, die Anthropologie in „Aufklärung“ und Romantik und die Notwendigkeit der moralischen Läuterung des Individuums.
Geschichtliche und gegenwärtige Vorgänge
Grzegorz Lewicki bietet eine polnische Perspektive auf die Politik der Jagiellonen und kontrastiert sie mit Islam und „Multikulturalismus“.
Mathias von Gersdorff zeichnet die Entstehung des Feminismus und dessen Einfluß auf internationale Organisationen nach, insofern er für das Recht auf Tötung des ungeborenen Kindes eintritt. Besonders „ungeheuerlich“ (167) ist die Penetranz des Europaparlaments, immer wieder die Abtreibung als Recht zu propagieren.
Egon Flaig analysiert Wesen und Geschichte der Demokratie und deren „Legitimitätsfiktion“ (184).
Zdzisław Krasnodębski resümiert zu Nation, Nationalismus und EU:
„[Der] offizielle Euronationalismus ist zunehmend kriegerisch gegenüber denjenigen, die er als innere Feinde betrachtet. Ihre Feinde sind die katholischen Polen, […] die Visegrád-Gruppe, alle ›Nationalisten‹, die an ihren Heimatländern hängen: Frankreich, Deutschland, Polen, Ungarn, Spanien“ […] Der moralische Transnationalismus, der zu Beginn der europäischen Integration vom Christentum inspiriert war, ist in seiner neuen linksliberalen Form sogar zur verbindlichen Doktrin der Union geworden“ (219f).
Sehr schön sind die Gedanken von David Engels über das für den europäischen Geist maßgebliche „agonale Prinzip“, also der Kampf gegen die eigene Trägheit und der Aufruf, sich selbst zu übertreffen.
Léon Krier demaskiert die „modernistische Verschwörung“ (!) und den „planetarischen kulturellen Staatsstreich“ (335) gegen die Schönheit in der Kunst, besonders in der Architektur.
Christian Machek kommt in seinem Aufsatz, der die Katholische Soziallehre ins Spiel bringt, auf die „Werte“ und deren Mißbrauch („Tyrannei der Werte“ nach Carl Schmitt) zu sprechen und kritisiert Selbstabschottung von für die EU maßgeblichen Ideologien gegen Nachfragen:
„Diese Werte, seien sie religiös oder säkular, bedürfen jedoch stets einer Begründung. Doch dürfen die Werte moderner Staaten hinterfragt werden? Findet nicht eher eine Tabuisierung ihrer Kritik statt? Existiert nicht etwas wie ein ›Frageverbot‹, auf das etwa der Politikwissenschaftler Eric Voegelin hinwies? Dieses ›Frageverbot‹ konstatierte Voegelin als Bestandteil verschiedener Ideologien […]. In weiterer Folge kann festgehalten werden, daß sich das Muster von ›Frageverboten‹ oder ›Selbstimmunisierungen gegen Nachfragen‹ in vielen ›modernen‹ politischen Ideologien durchhält“ (350).
Respekt vor der Schöpfung sub specie aeternitatis – menschliche Sterblichkeit und der Wahn des „Übermenschen“
Michael Hageböck thematisiert echten Natur- und Umweltschutz im Zeichen des Respekts vor der Schöpfung und bedauert, daß „die Linke ökologische Themen instrumentalisierte, relevante Fragen ideologisch kaperte und polarisierend in Stellung brachte“ (380). Im Zusammenhang mit Gen 1,28 folgten „[z]ahlreiche Heilige der katholischen Kirche […] mit ihrer Liebe zur Natur Christus nach: Hildegard von Bingen schrieb über sie zahlreiche Bücher, von einem Leben im Einklang mit der Schöpfung lesen wir bei Sulpicius Severus, unzählige Christen hatten ein inniges Verhältnis zu Tieren […] Benediktiner verwandelten Wildnis in Kulturland“ (383).
Technik, Kulturlandschaft und Menschenwürde sind in ihrer Kombination Schöpfungen des Christentums.
Für unsere ideologieüberladene Zeit besonders relevant zeigt Hageböck auf, daß viele scheinbar pro-ökologische Prophezeiungen („Grenzen des Wachstums“, Ozonloch, versiegende Rohstoffquellen u. a.) „schlicht Panikmache“ gewesen seien (389). Die Horrorvorstellung vom „Homo Deus“ und des Transhumanismus des Yuval Harari beruht auf falschen, gnostischen Voraussetzungen.
Vorbilder der Präambel
Bemerkenswert ist die in der Präambel gebrauchte Formulierung „Konföderation europäischer Nationen“. Ob intendiert oder nicht, erinnert diese an die Confederacy, also die 1861 nach Unabhängigkeit strebenden US-Südstaaten, die bekanntlich von Papst Pius IX. wohlwollend betrachtet, aber vom mächtigeren Norden niedergemacht wurde. Auch die einleitende Formulierung „Wir, die Europäer, entscheiden im Vollbewußtsein unserer historischen Verantwortung, uns eine eigene Verfassung zu geben und somit den Einigungsprozeß des Kontinents zum Abschluß zu bringen“ erinnert an den Beginn der US-Verfassung: „We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, […] do ordain and establish this Constitution for the United States of America.“
Engels ließ sich auch von der ungarischen Verfassung inspirieren.
Resümee
Wie eingangs gesagt: Auch wer einer europäischen Einigung und Verfassung, wie auch immer sie aussehen möge, skeptisch gegenübersteht, oder auch wer sich einen stärker und ausdrücklicher traditionell katholischen Ansatz für eine solche Einigung wünschen würde, sollte sich mit den klugen Gedanken von David Engels und den anderen Autoren auseinandersetzen.
Der Rezensent stimmt nicht jeder einzelnen Aussage oder Implikation zu, etwa der demonstrativen Toleranz von gegenüber der Ehe und Familie „alternativen Formen des (…) Zusammenlebens“ (30) in der Präambel. Er moniert die unkritische Erwähnung der „Impfstoffentwicklung“ (88), die ja offiziell gegen die Coronainfektion gerichtet gewesen sei, sich aber als Desaster erwiesen hat. Daß Harald Seubert, dem man immer gerne zuhört und der hier auch einen sehr guten Text vorgelegt hat, ausgerechnet die Lessingsche Ringparabel mit dem „Primat einer allgemeinen Religion der Vernunft“ zusammenbringt (wenn auch offenbar nur das Selbstverständnis von deren Autor referierend) und gegenüber dieser sowie der „partikulare[n] jüdische[n] Religion“ (119) keine ideologiekritische Analyse einsetzt, ist dem Rezensenten unverständlich. Daß die europäischen Nationen das Papsttum „schufen“, wie Zdzisław Krasnodębski meint (209), verfehlt Ursprung und Wesen des Papsttums. Die „Theologie von Papst Franziskus“ (237) braucht nicht ins Spiel gebracht zu werden, da sie quälender und verwirrender Unsinn ist.
In der Fülle brillanter Analysen und Beurteilungen und angesichts reichhaltiger Quellenangaben sind das freilich nur sehr wenige Schwächen.
Der Rezensent anerkennt daher, daß hier ein vorzüglicher Band gelungen ist, den man immer wieder zur Hand nehmen wird. Er sei besonders politisch oder „metapolitisch“ tätigen Katholiken empfohlen. Er sollte auch von jungen Leuten, etwa ab dem späteren Oberstufenalter, konsultiert werden, da er eine Impfung gegen die allgegenwärtige globalistische Propaganda darstellen kann.
Der Manuscriptum-Verlag ist ein säkularer Verlag, der Autoren abseits des Hauptstroms ein Podium bietet und die Zeitschrift TUMULT – Vierteljahresschrift für Konsensstörung herausbringt. Die Konsultation seiner Produkte ist nicht heilsnotwendig, aber der politisch interessierte Katholik wird dort viele Informationen und Anregungen finden.
David Engels (Hg.), Europa aeterna – Unsere Wurzeln. Unsere Zukunft, Edition Sonderwege, Manuscriptum, Neuruppin 2022, 434 S.
(Mit Beiträgen von David Engels, Philipp Bender, Felix Dirsch, Heinz Theisen, Chantal Delsol, Harald Seubert, Andreas Kinneging, Grzegorz Lewicki, Mathias von Gersdorff, Egon Flaig, Zdzisław Krasnodębski, Justyna Schulz, Magdalena Bainczyk, Gerd Morgenthaler, Markus Stephan Bugnyár, Anne Trewby, Iseul Turan, Léon Krier, Christian Machek, Grzegorz Kucharczyk und Michael Hageböck.)
*Wolfram Schrems, Wien, Mag. theol., Mag. phil., kirchlich gesendeter Katechist, Pro Lifer, interessiert an Politik und Metapolitik, stimmte 1994 gegen den Beitritt Österreichs zur EU.
Bild: Giuseppe Nardi/Christusmonogramm nach dem hl. Bernhardin von Siena (1380–1444) an der Fassade des Rathauses von Siena.