
Findet in Diözesen des deutschen Sprachraumes ein Betrug mit Meßstipendien statt? Die Frage scheint ein Tabu zu sein, das nun durchbrochen wurde durch einen Priester der Priesterbruderschaft St. Petrus (Bistum Linz), der eine Klarstellung veröffentlichte und noch offene Fragen formulierte.
Klagen zeigen, daß in Pfarreien verschiedener Bistümer Meßstipendien zwar entgegengenommen, dann aber Wortgottesdienste gehalten werden. Es handelt sich nicht um einen Einzelfall. Bestätigung scheint ein Blick auf die Gottesdienstordnungen in Pfarrblättern und Schaukästen zu liefern. Neben dem Hinweis Wortgottesdienst oder Wort-Gottes-Feier werden die Namen von Verstorbenen angeführt, für die je nach Gegend ein Seelenamt, Requiem, Jahrtag oder eine Jahrzeit gehalten werden soll. Manche Gläubige erleben eine irritierende Überraschung. Handelt es sich um einen schleichenden Prozeß, der manchen Gläubigen gar nicht bewußt wird, oder ist die Entwöhnung von der heiligen Messe sogar interessengeleitet? Geht es dabei um direkte Auswirkungen des Priestermangels und neuer Berufsgruppen von Laienseelsorgern, die in den vergangenen Jahrzehnten geschaffen wurden?
In der aktuellen Ausgabe der „Regionalzeitung der Priesterbruderschaft St. Petrus für Oberösterreich und angrenzende Gebiete“ Die Minoritenkirche veröffentlichte Pater Walthard Zimmer, einer der Gründer der Petrusbruderschaft, eine Orientierungshilfe. Anlaß dafür war die Schilderung einer Frau, die sich in der Sache an ihn gewandt hatte.
Eine irritierende Überraschung
Sie hatte für ihren verstorbenen Vater eine Messe bezahlt, dann hielt aber „die Frau vom Diakon einen Wortgottesdienst“. Darüber verwundert, ersuchte sie in der Pfarrkanzlei um Aufklärung. Die Pfarrsekretärin erklärte ihr, daß kein Priester dagewesen sei. Wenn in einem solchen Fall ein Wortgottesdienst stattfinde, werde das Meßstipendium „als Spende verbucht“.
Die Frau war empört, da sie keine Spende für einen bestimmten Tag gegeben hatte, sondern eine Messe haben wollte. Eine Spende wäre auch nicht im Intentionenbuch verzeichnet worden, wie sie sich erinnerte. Die Pfarrsekretärin meinte darauf, wenn sie „unbedingt eine Messe“ haben wolle, müsse sie das vorher sagen, dann würde das Stipendium weitergeleitet. Dann aber werde der Jahrestag mit dem Namen des Vaters nicht in der Gottesdienstordnung veröffentlicht und die Leute im Ort würden davon nichts erfahren. Ein Wink mit dem Zaunpfahl, um sie zu zwingen, „für einen Wortgottesdienst ein Meßstipendium zu bezahlen“? Das würden „die anderen Pfarreien auch so machen“, habe ihr die Pfarrsekretärin gesagt.
„Darf denn das sein?“
Mit dieser Frage suchte die irritierte Gläubige Rat bei dem Priester der Petrusbruderschaft. Dessen Antwort fällt eindeutig aus:
„Messstipendien dürfen nie (!) für einen Wortgottesdienst verwendet oder zur Spende uminterpretiert werden.“
Das sei nicht nur „im Kirchenrecht klar so geregelt“, sondern könne auch „aus dem inneren Verständnis“ des Meßstipendiums nicht anders sein.
„Alles andere ist Betrug mit den Messstipendien und wiedergutmachungspflichtig!“
Klares Kirchenrecht
Im Canon 948 des Codex des Kirchenrechts, so Pater Zimmer, sei ausdrücklich festgehalten, daß „für jedes angenommene und akzeptierte Messstipendium je eine heilige Messe zu zelebrieren ist“. Das Kirchenrecht schreibe auch vor, daß ein Priester oder stellvertretend für ihn eine Pfarrkanzlei „nicht mehr Stipendien für heilige Messen annehmen darf, als der oder die zur Verfügung stehenden Priester innerhalb eines Jahres zelebrieren können“. Gebe es mehr Stipendien, müssen diese „an die dafür vorgesehenen diözesanen Stellen weitergegeben werden“.
Sollte der Geber es nicht anders verfügt haben, sei es aber möglich, daß Meßstipendien an einen anderen Priester übergeben werden können, der „über jeden Einwand erhaben“ ist (Canones 953–955).
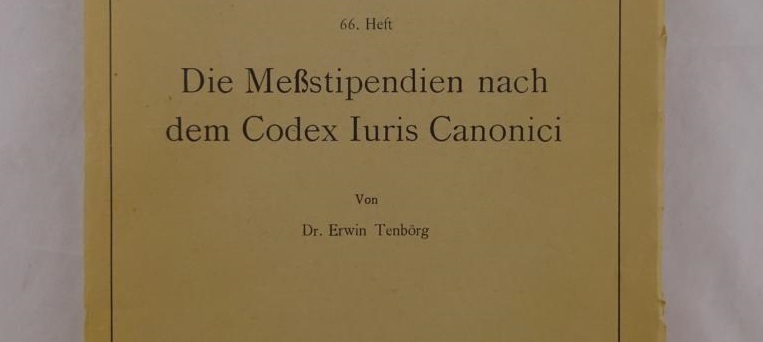
Das Meßstipendium
In diesem Zusammenhang erklärt Pater Zimmer auch, was wiederholt ein Stein des Anstoßes sein kann, nämlich die Frage, „wieso überhaupt für die heilige Messe Geld gegeben wird“.
Da im katholischen Verständnis alle Gläubigen an der heiligen Messe beteiligt sind und mitwirken, „hat sich im 2. bis 3. Jahrhundert der Brauch entwickelt, dass alle Mitfeiernden (auch Laien) materielle Gaben mitbringen.“ Diese Gaben, die von den Gläubigen am Beginn der Gabenbereitung (Offertorium) zum Priester gebracht wurden, was die persönliche Anwesenheit bei der Messe voraussetzte, „waren der Ausdruck der inneren Opfergesinnung und der Vollzug der tätigen Teilnahme am Opfer selbst“. Gaben von Ungläubigen und öffentlichen Sündern wurden nicht angenommen.
Aus diesem Brauch entwickelte sich im Frühmittelalter „eine aus Geld bestehende Gabe“, die dem Priester außerhalb der heiligen Messe „gereicht wird und diesen verpflichtet, ein Messopfer in der Meinung des Gebers darzubringen“. Sinnvollerweise möchte man hinzufügen, da in der Spätantike die Zahl der Christen immer größer wurde und die Gabenbringung leichter handhabbar wurde. Die innere Hinordnung der Gabe auf das Messopfer blieb jedoch unverändert bestehen.
„Das Messstipendium ist daher, seiner wesentlichen Zweckbestimmung nach, nicht Beitrag zum Lebensunterhalt des Priesters, sondern Gabe für ein Messopfer. Der Geber bemüht sich um einen Anteil am Opfer, den er nur als Glied der Opfergemeinschaft erlangen kann. Der Priester reiht den Geber, mag dieser anwesend sein oder nicht, als Gabenbringer in das bestimmte Opfer ein.“
Bis zu diesem Zeitpunkt sei das Geld dem Priester nur treuhänderisch anvertraut. „Nach der heiligen Messe geht die Gabe in den Besitz des Priester über und dient erst dann zu seinem Lebensunterhalt.“
Die Kirche, die diesen Brauch als rechtmäßig anerkannt hat, verpflichtet sich, „jedem Missbrauch zu wehren“ (Canones 945–947).
Pater Zimmer folgert aus dem Gesagten:
„Ich muss also meiner Besucherin recht geben. Messstipendien können und dürfen weder vom kirchenrechtlichen Standpunkt noch aus inneren Gründen für einen Wortgottesdienst verwendet werden.“
Das Intentionenbuch
Das Kirchenrecht (Canon 958) schreibt zudem vor, daß alle angenommenen und akzeptierten Meßstipendien „in ein Intentionenbuch einzutragen“ sind: „die genaue Zahl der heiligen Messen, die Intentionen und die Höhe der Stipendien“. Die Höhe des Stipendiums wird von der jeweiligen Bischofskonferenz festgelegt, entspricht aber weder einem „Preis“ noch „Kosten“. Deshalb kann der Priester weniger nehmen, aber nie mehr. Der Freiheit des Gebers steht die Verpflichtung des Priesters gegenüber. So darf der Priester eine Meßintention nicht ablehnen, weil dem Geber das nötige Geld fehlt. Gibt der Stifter freiwillig mehr, so ist auch das im Intentionenbuch zu verzeichnen.
Sollten Meßintentionen an einen anderen Priester übergeben werden, „muss auch das ganze Stipendium weitergegeben werden“, außer es wäre vom Stifter eindeutig verfügt worden, daß der überschüssige Betrag beispielsweise für den das Stipendium annehmenden Priester persönlich gemeint war.
Die Eintragung in das Intentionenbuch diene auch dazu, daß die Verpflichtung, die durch das Stipendium entsteht, eingehalten wird, also die heilige Messe auch wirklich zelebriert wird, „selbst wenn das Stipendium verloren ginge oder der Priester stirbt“.
Um jede Form der Geschäftemacherei auszuschließen, darf ein Priester, selbst wenn er an einem Tag mehrere heilige Messen zu feiern hätte, „nur für eine Messe ein Stipendium für sich persönlich nehmen. Alle anderen Stipendien gehen an die Pfarre bzw. Ordensgemeinschaft“.
Wortgottesdienst ist keine heilige Messe
Ein Wortgottesdienst könne zwar durchaus mit einem „Gebetsgedenken“ an einen Verstorbenen verbunden und auch in der Gottesdienstordnung vermerkt werden. Er habe aber weder etwas mit einer heiligen Messe zu tun noch dürfe irgendwie der Eindruck vermittelt werden, er sei dieser gleichrangig oder gleichbedeutend.
Pater Zimmer erwähnt einen zu hörenden Hinweis, daß es „für manche auch passt, wenn es nur ein Wortgottesdienst ist“. Das lasse den Verdacht aufkommen, ob „hier nicht die Unwissenheit von Gläubigen ausgenützt“ werde, um sich „Einnahmen“ zu verschaffen, „die so nicht vorgesehen sind“.
„Wenn der Stifter einer heiligen Messe zwar weiß, dass keine heilige Messe gefeiert, sondern nur ein Wortgottesdienst gehalten wird, kann man zwar nicht von Betrug im strengen Sinn des Wortes sprechen, aber in Ordnung ist das auch nicht.“
Pfarrsekretärinnen, so Pater Zimmer, hätten bei solchen Gelegenheiten vielmehr die Chance „über den Wert der heiligen Messe aufzuklären und den Unterschied zum Wortgottesdienst darzulegen. Das wäre echte und wertvolle Mitarbeit von Laien am Dienst der Priester.“
Offene Fragen
„Die schwerwiegendste Frage in diesem Zusammenhang bleibt allerdings offen: ‚Wie sieht es aus mit der Aufsichtspflicht des Ordinarius?‘“
Canon 957 spreche von „Pflicht und Recht“ des Ortsordinarius bzw. des Ordensoberen, „darüber zu wachen, dass die Messverpflichtungen eingehalten werden“. Ebenso, daß die Intentionenbücher vom Ordinarius jährlich „selbst oder durch andere“ zu überprüfen sind.
Pater Zimmer schließt seine Ausführungen, indem er selbst einige Fragen formuliert:
„Wird das gemacht? Messstipendien, die in Spenden uminterpretiert wurden, sind restitutionspflichtig oder die heiligen Messen müssen nachgeholt werden? Wer kümmert sich darum?“
Text: Giuseppe Nardi
Bild: AEPC (Screenshot)
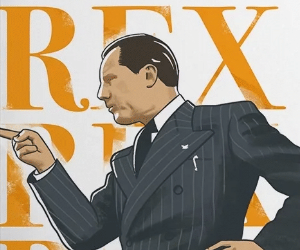



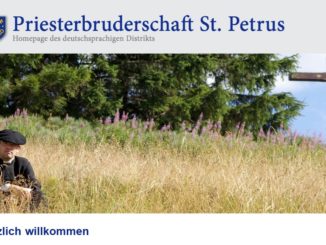
Falls dies tatsächlich so ablaufen sollte, würden dadurch die negativen Einstellungen, die heute vielerorts gegenüber der Kirche geäußert werden, weiterhin gestärkt werden. Vorurteile, der Kirche würde es nur ums Geld gehen etc. werden durch solche Roßtäuschung noch bestätigt. Es wäre doch bildhaft gesprochen so, als würde man in der Bäckerei einen Laib Brot bestellen und bezahlen und statt dessen dann ein kleines Brötchen erhalten.
Das Brötchen wäre ja noch dieselbe Materie, nein, es ist viel schlimmer. Bestellt wird ein Brot, aber man erhält ein Papierbild von einem Brötchen.
Ein Missbrauch liegt auch dann vor, wenn mehrere Intentionen in einer hl. Messe „gebündelt“ werden, wie es in nicht wenigen Pfarreien praktiziert wird. Das Angebot an hl. Messen wird tendenziell immer weniger, aber die Intentionen bleiben in etwa gleich. So fasst man diese dann eben in einer hl. Messe zusammen. Oft scheint die Vermeldung der Intentionen zu Beginn der hl. Messe wichtiger zu sein als der Tagesheilige oder der jeweilige Sonntag im Kirchenjahr. Eine Aufklärung der Stipendiaten findet nicht statt. Und so ist hier eine mehr als bedenkliche Schieflage entstanden.