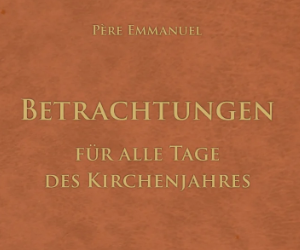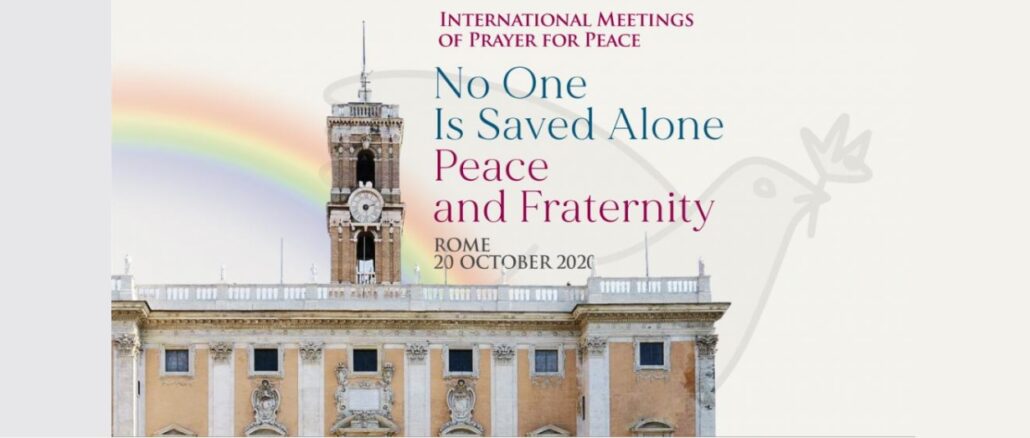
Unter dem Motto „Niemand rettet sich allein – Frieden und Brüderlichkeit“ wird Papst Franziskus an einem Friedensgebet „im Geist von Assisi“ teilnehmen, einem Geist, dem Papst Benedikt XVI. mißtraute.
Am 20. Oktober wird in der römischen Basilika Santa Maria in Aracoeli ein „ökumenisches Friedensgebet“ und anschließend eine „interreligiöse Begegnung“ stattfinden. Gestern bestätigte Vatikansprecher Matteo Bruni die Anwesenheit von Papst Franziskus:
„Am Nachmittag des 20. Oktober wird, wie von der Präfektur des Päpstlichen Hauses mitgeteilt, der Heilige Vater bei der Begegnung des Friedensgebetes im Geist von Assisi mit dem Titel ‚Niemand rettet sich allein – Frieden und Brüderlichkeit’ anwesend sein, die von der Gemeinschaft von Sant’Egidio initiiert wird.“
Im Gegensatz zu anderen Sprachen wird die Brüderlichkeit auf deutsch von Sant’Egidio selbst wie inzwischen auch vom Vatikan mit „Geschwisterlichkeit“ wiedergegeben.
Vorgesehen ist die Teilnahme des Papstes an beiden Teilen des Treffens, sowohl am ökumenischen Gebet mit Vertretern anderer christlicher Bekenntnisse in der Basilika auf dem Kapitol als auch an der anschließenden Zeremonie mit „Vertretern der großen Weltreligionen“ auf dem Kapitolsplatz.
Den „Geist von Assisi“ bezieht die Kirche auf den heiligen Franz von Assisi, doch von der Gemeinschaft von Sant’Egidio wurde er umgeprägt und auf die von ihr organisierten interreligiösen „Friedensgebete“ bezogen.
Vor 34 Jahren, im Jahr 1986, organisierte die Gemeinschaft erstmals ein solches „Friedensgebet“ in Assisi. Es stand unter dem Motto: „Frieden ist eine Werkstatt, die allen offensteht“. Für die Idee konnte sie den damaligen Papst Johannes Paul II. gewinnen, in dessen Namen Einladungen an „die Oberhäupter der großen Weltreligionen“ erfolgten.
Der Assisi-Skandal von 1986
Die erste Veranstaltung dieser Art wurde zum großen Skandal. Die verschiedenen Religionsvertreter beteten miteinander, obwohl aufgrund des unvereinbaren Religionsverständnisses unklar war, zu wem. Zudem erhielten heidnische Religionen Kirchen zugewiesen, in denen durch kirchenfremde Kulthandlungen Sakrilege stattfanden. Die Kritik an dem relativistischen und synkretistischen Spektakel, der sich auch der damalige Glaubenspräfekt Joseph Kardinal Ratzinger anschloß, war kirchenintern sehr stark.
2011 schrieb der damalige RAI-Vatikanist Aldo Maria Valli, daß mit dem ersten Treffen von Assisi 1986 „der ‚Geist von Assisi‘ geboren wurde, der zu einer Formel wurde: wunderschön für einige, zerstörerisch für andere“.
Die Gemeinschaft von Sant’Egidio, die durch die Anwesenheit des Papstes und das völlige Novum der Veranstaltung – nie hatte es Vergleichbares zuvor gegeben – große internationale Aufmerksamkeit erzielt hatte, hielt am neugeborenen „Geist von Assisi“ fest. Jährlich wird seither ein solches Friedensgebet in verschiedenen Ländern und Städten durchgeführt. Medieninteresse finden aber vor allem die „Hauptveranstaltungen“ in Assisi, die in unregelmäßigen Abständen, aber jeweils in Anwesenheit des Papstes stattfinden. Diese Assisi-Treffen wurden weitgehend von den beanstandeten Elementen gereinigt, um an der Grundidee, einer Begegnung der Weltreligionen und eines gemeinsamen Bekenntnisses zum Frieden, festhalten zu können. Die anderen Religionen erhalten keine Sakralräume mehr und auch ein gemeinsames Gebet ist nicht mehr vorgesehen, wenngleich alle Delegationen angehalten werden, nach ihrem Bekenntnis für den Frieden und die Brüderlichkeit zu beten.

Johannes Paul II. habe die Initiative unterstützt, weil sie dem Papsttum einen Primat unter den Religionsführern einräumt oder zumindest einzuräumen scheint. Diese Idee wurde besonders von Papst Franziskus aufgegriffen, der den interreligiösen Gedanken stärker als alle Vorgänger vertritt. Tatsächlich wurde allein ihm in Vertretung der Kirche, aber faktisch aller Religionen, 2015 Rederecht vor der UNO-Hauptversammlung eingeräumt, als die politischen Ziele der UNO, die sogenannten Post-Millenniums-Ziele, für den Zeitraum 2015–2030 verabschiedet wurden.
Papst Franziskus reiste 2016 nach Assisi, als der 30. Jahrestag des ersten interreligiösen Friedensgebetes von 1986 begangen wurde. Zuvor war bereits Benedikt XVI. 2011 nach Assisi gekommen. Dessen Teilnahme stand lange auf der Kippe und war vor allem ein Ringen mit sich selbst. Dem 20. Jahrestag 2006 hatte er sich noch entzogen und dem Bischof von Assisi lediglich ein Schreiben mit einigen Ermahnungen zukommen lassen. Er bat die Kritiker der Veranstaltung ausdrücklich um Verständnis, indem er auf die Bedeutung des Friedensanliegens verwies und versicherte, alles in seiner Macht stehende zu tun, daß es keinen Anlaß mehr zur Kritik geben werde, die noch die beiden vorhergehenden Treffen unter Johannes Paul II. getroffen hatte. Wie 1986 Kardinal Ratzinger, blieb 2016 auch Glaubenspräfekt Müller dem Assisi-Treffen fern (siehe dazu Assisi und die abwesenden Glaubenspräfekten).
Die Gemeinschaft von Sant’Egidio, die im Gegensatz zu anderen 68er-Gründungen die besondere Nähe zu den Päpsten suchte, identifiziert sich zweifelsohne besonders mit dem Pontifikat von Papst Franziskus. Unter ihm erhielt die Gemeinschaft ihren ersten Kardinal, was einer „Adelung“ gleichkommt, die von ihr seit mehr als 20 Jahren angestrebt, aber von den beiden Vorgängerpäpsten nicht gewährt wurde.
Am 1. September 2019 gab Franziskus bekannt, den von ihm ernannten Erzbischof von Bologna, Msgr. Matteo Zuppi, Angehöriger der Gemeinschaft von Sant’Egidio, zum Kardinal zu kreieren. Dem ersten Kardinal der Gemeinschaft wurde mit seiner Erhebung am 5. Oktober jenes Jahres zudem die Besonderheit zuteil, daß Franziskus die für die Gemeinschaft namensgebende Kirche Sant’Egidio in Trastevere zur Titelkirche erhob und ihm verlieh.
Das Zentrum von Sant’Egidio

Die heute dem heiligen Ägidius am gleichnamigen Platz geweihte Kirche im Stadtteil Trastevere geht zumindest auf das Hochmittelalter zurück. Die älteste Erwähnung findet sich 1123 in einer Bulle von Papst Calixtus II. Sie war dem heiligen Blasius geweiht und wurde nach 1550 der Zunft der Schuster zugewiesen, die eine den heiligen Crispinus und Crispinianus geweihte Kapelle anbauten. 1610 wurde sie den Unbeschuhten Karmelitinnen übereignet, deren Kloster 1611 von Papst Sixtus V. kanonisch errichtet wurde. Die Ordensfrauen ließen 1630 anstelle der bestehenden die heutige Kirche errichten und übertrugen das Patrozinium des heiligen Ägidius aus einer nahegelegenen Kirche, die sie ebenfalls erhielten, aber für zwei Kirchen keinen Bedarf hatten. Das Kloster, in dem 1662 20 Chorschwestern, 15 Novizinnen und drei Konversen lebten, fiel 1873 dem kirchenfeindlichen Klostersturm durch das Königreich Italien zum Opfer, der auf die Eroberung des Kirchenstaates folgte. Das Kloster wurde aufgehoben, die Schwestern vertrieben und die Gebäude vom neuem Staat beschlagnahmt.
Obwohl sich schnell herausstellte, daß dieser keinen Bedarf dafür hatte, gab er sie den Ordensfrauen nicht zurück, sondern verschenkte sie an die Stadt Rom. Diese errichtete im Ersten Weltkrieg ein Lazarett für Kinder, die an Malaria erkrankt waren, eine Krankheit, an der Rom viele Jahrhunderte zu leiden hatte, bis Benito Mussolini ab 1930 die Sümpfe um Rom trockenlegen ließ.
Ein Teil des ehemaligen Karmelitinnenklosters ist heute Hauptsitz der Gemeinschaft von Sant’Egidio, die ihn faktisch besetzte. 1973 wurden ihr Kirche und Gebäude offiziell übertragen.
Das Jesuskind und der heidnische Kaiser
Die Kirche Santa Maria in Aracoeli, wo das gemeinsame Friedensgebet der christlichen Konfessionen stattfinden wird, ist die eigentlichen Wallfahrtskirche der Römer, die das Gnadenbild des Jesuskindes, das „Santo Bambino“, aufsuchen. Ihre Ursprünge lassen sich bis um 590 zurückverfolgen, als Papst Gregor der Große regierte und mit der Marienkirche ein griechisches Mönchskloster verbunden war. Später betreuten sie Benediktiner, heute Franziskaner. Das wundertätige „Jesuskind“ soll von einem Franziskaner aus dem Holz eines Olivenbaums aus dem Garten Gethsemani in Jerusalem geschnitzt worden sein.
1994 wurde das „Santo Bambino“ gestohlen und ist bis heute nicht wiedergefunden worden. Die römische Unterwelt war empört über den Frevel. Die in den beiden Gefängnissen der Stadt, Rebibbia und Regina Coeli, einsitzenden Kriminellen veröffentlichten eine Erklärung, mit der sie sich von der Tat distanzierten und die Schuldigen aufforderten, das Jesuskind zurückzugeben. Als das nicht geschah, starteten sie eine Geldsammlung. Mit dem Geld wurde eine originalgetreue Kopie angefertigt, die seither in der Kirche verehrt wird.
In Santa Maria in Aracoeli befinden sich das Grab der heiligen Helena, der Mutter von Kaiser Konstantin dem Großen, der die Christenheit viel verdankt, darunter die Auffindung des heiligen Kreuzes während ihrer Pilgerreise ins Heilige Land, und das Grab von Papst Honorius IV. (1285–1287).
Der zweite, interreligiöse Teil des Treffens wird hingegen mit den Vertretern der anderen Weltreligionen auf dem Kapitolsplatz stattfinden, der vom Reiterstandbild des heidnischen Kaisers Mark Aurel (161–180) dominiert wird, unter dem das christliche Bekenntnis noch als Kapitalverbrechen galt. Das Denkmal, das ursprünglich beim päpstlichen Lateranpalast stand, blieb erhalten, weil im Mittelalter die Überzeugung vorherrschte, es handle sich um eine Darstellung von Kaiser Konstantin dem Großen. Als 1447 die tatsächliche Identität geklärt wurde, war das Interesse für die Antike und die Kunst so groß, daß sie keine hundert Jahre später auf dem von Michelangelo neugestalteten Kapitolsplatz Aufstellung fand. Das Original befindet sich inzwischen allerdings im angrenzenden Konservatorenpalast. Auf dem Platz steht seit 1997 eine Kopie.
Das Reiterstandbild des heidnischen Kaisers bildet am 20. Oktober gewissermaßen „die Brücke“ zwischen der Kirche in Aracoeli, wo die Christen beten, und dem Ort, wo sich die Weltreligionen begegnen.

Text: Giuseppe Nardi
Bild: Santegidio/Wikicommons (Screenshot)