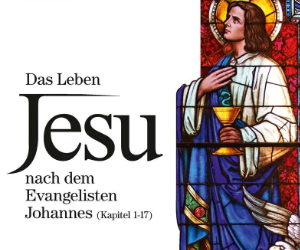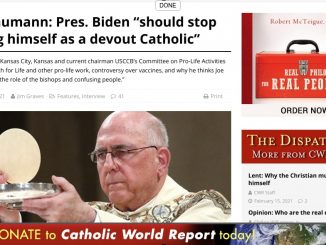(Paris) Bemerkenswerte Anmerkungen zur aktuellen Lage der Kirche in Corona-Zeiten kommen von unerwarteter Seite. „Die Kirche hat sich zu einer Art Gewerkschaft reduziert.“ Diese Feststellung stammt von Olivier Roy, einem der bekanntesten französischen Politikwissenschaftler.
In Sachen Corona-Epidemie und staatlichen Radikalmaßnahmen bewegt sich die Kirche wie eine „Gewerkschaft der Gläubigen“, die nicht imstande ist, den Politikern klarzumachen, daß das Recht auf freie Religionsausübung viel wichtiger ist als die Möglichkeit, ein Fußballspiel besuchen oder bei McDonald’s einen Burger essen zu können.
Der französische Politikwissenschaftler Olivier Roy kann manchen Alleinstellungsanspruch erheben. Das beginnt bei der eher ungewöhnlichen Herkunft aus einer protestantischen Familie der Vendée. Als Jahrgang 1949 wurde Roy zum „klassischen“ 68er, der in seiner Studienzeit bei der radikalen Linken aktiv war und sich in maoistischen Gruppen engagierte. Nachdem er an der Universität Philosophie und Persisch studiert hatte, schlug er eine wissenschaftliche Laufbahn ein, promovierte an der Elitehochschule Institut d’études politiques de Paris und forschte im Bereich der empirischen Ethnologie.
Er ließ sich an der Schußwaffe ausbilden und nahm Anfang der 80er Jahre in Afghanistan am Kampf gegen die Sowjetunion teil. Ob das im Auftrag der französischen Regierung (eines Geheimdienstes) geschah, ist nicht bekannt. In weiteren Reisen erkundete er den Nahen Osten, den Islam und die islamische Welt. Nicht zuletzt wegen seiner Sprach- und Ortskenntnisse sowie seiner Bücher über den politischen Islam wurde er 1984 Berater des französischen Außenministeriums, das damals von Roland Dumas geleitet wurde. Premierminister war Laurent Fabius, Staatspräsident François Mitterrand (alle drei Sozialistische Partei PS). Eine Position, die er bis 2008 beibehalten sollte.
1988 wurde Roy erstmals zur jährlichen Bilderberger-Konferenz eingeladen und im selben Jahr auch Berater der UNO, deren Afghanistan-Mission UNOCA er leitete. Zahlreiche weitere Einladungen zu den Bilderberger-Konferenzen folgten. Ab 1993 vertrat er mehrere Monate die OSZE in Tadschikistan. Sein Buch „L’Échec de l’Islam politique“ (Das Scheitern des politischen Islams) von 1992 gilt als Standardwerk. Darin vertritt er die These, daß auf das Scheitern des politischen ein fundamentalistischer Islam folgte. Seit 2009 ist Roy Professor am Robert-Schuman-Zentrum des Europäischen Hochschulinstituts in Florenz. Den in Europa wütenden islamischen Terror will Roy vom Islam entkoppelt wissen. Es sei eine Art Rebellion von Nihilisten, ein Aufbegehren junger Muslime oder Konvertiten gegen die europäische Gesellschaft, in der sie leben. Die Täter seien zwar mehr oder weniger islamisch sozialisiert, aber Ausgangspunkt ihres Handelns sei nicht religiöse Frömmigkeit, sondern eine Radikalisierung. Die Etikette des Islams, mit dem sie sich umgeben, sei mehr oder weniger ein zeitbedingtes Zufallsprodukt. Es könnte ebensogut eine andere Ideologie oder Religion sein, die ihnen Raum zur destruktiven Radikalität biete.
Schließlich muß es zu einem Zerwürfnis gekommen sein. Seit 2011 wurde Roy nicht mehr zu den Bilderbergern eingeladen, wo den freigewordenen Platz sein Kontrahent Gilles Kepel einnahm. Auch seine Mitgliedschaft bei dem von George Soros gegründeten European Council on Foreign Relations (ECFR), dem europäischen Ableger des amerikanischen Council on Foreign Relations (CFR), ist nicht mehr aktiv.

Die Selbstreduzierung der Kirche in Corona-Zeiten
Roy veröffentlichte im Nouvel Observateur Gedanken zum Urteil des französischen Staatsrats (Oberstes Verwaltungsgericht), mit dem die Regierung gezwungen wurde, innerhalb von acht Tagen das völlige Verbot von öffentlichen Gottesdienstes aufzuheben. Der Politikwissenschafter befaßt sich in diesem Zusammenhang mit der Reaktion der Kirche (der Religionsvertreter) auf die massiven staatlichen Eingriffe wegen des Coronavirus.
In dem Aufsatz stellt er seine Beobachtung in den Mittelpunkt, daß die katholische Kirche (aber ebenso andere christliche Konfessionen und andere Religionen) nie „religiös über diese Epidemie“ gesprochen habe. Wenn überhaupt in diese Richtung etwas anklinge, dann gehe es um medizinische Rationalität, die mit den Rechten der Gläubigen in Einklang zu bringen sei. Die Kirche verhalte sich, so Roy, als ob es unerhört wäre, einen religiösen Ansatz im Zusammenhang mit der Epidemie und ihrer Beurteilung zu haben. Dabei gehe es um die Frage, was die Epidemie für die Menschheit bedeutet. Durch ein solches Verhalten werde der Diskurs über das Phänomen, das alle Menschen in allen Bereichen betreffe, reduziert und verarme. Vor allem bedeute es seine Selbsteinschränkung der Kirche, die sich in ihrem universalen Handeln und Anspruch beschneide. Die Kirche laufe so Gefahr, sich letzten Ende nur mehr wie eine Art „Gewerkschaft der Katholiken“ zu verhalten“.
Ausgangspunkt von Roys Analyse ist die Beobachtung, daß die Bischöfe (aber auch die protestantischen Konfessionen, die Rabbiner, die Imame und die Vertreter anderer Religionen) die radikalen Eingriffe und Einschränkungen der Kultusfreiheit vorbehaltlos akzeptiert und an ihre Gläubigen weitergegeben haben. Das geschah, obwohl davon auch hohe Feste wie Ostern, Pessach und Ramadan betroffen waren. Protest habe es zwar gegeben, doch sei er begrenzt und überschaubar geblieben.
Roy folgert daraus eine Stärkung der Position, daß der Staat religiöse Praktiken nicht als wesentliches Bedürfnis betrachtet (und betrachten muß). Zumindest die katholische Kirche sei sich „dieser Laizität der Ignoranz und der Gleichgültigkeit erschrocken bewußt geworden“. Warum nicht über Skype beichten und die konsekrierte Hostie über Amazon bestellen?
„Die Regeln der Regierung stellen McDonald’s vor Kirche, Moschee oder Synagoge. In Italien wurden von der Regierung die Museen vor den Kirchen geöffnet, als ob Religion nach der Kultur käme oder, schlimmer noch, nichts mit Kultur zu tun habe.“
Macron, Merkel und Kurz machten es nicht anders.
„Das schwerwiegendste Problem ist, daß religiöse Praktiken von Politikern und der öffentlichen Meinung als optional und individuell angesehen werden, aber keine Gemeinschaft von Individuen betreffen. Christen werden der Messen beraubt, so wie Fußballfans der Fußballspiele.“
Daraus zieht Olivier Roy eine dramatische Schlußfolgerung:
„Diese Gleichgültigkeit kommt der Verfolgung sehr nahe.“
Text: Giuseppe Nardi
Bild: Nouvel Observateur/MiL (Screenshots)