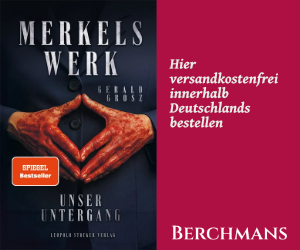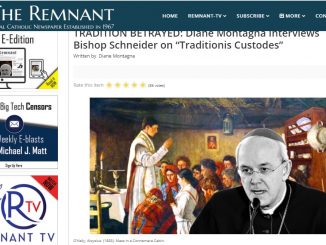Von Caminante Wanderer*
Sowohl im Osten als auch im Westen entwickelten die Christen – nach der Zeit der Verfolgungen und sobald sich der Glaube zu festigen begann – eine Spiritualität, die zutiefst in der Liturgie verwurzelt war. Es war durch die Liturgie und in der Liturgie, daßsich das Herz des Menschen wandelte und dem Herzen Gottes gleichgestaltet wurde. Das Gebet entsprang der Feier der Heiligen Messe und nährte sich aus ihr, ebenso wie aus dem Stundengebet. Sowohl Kleriker als auch Laien lernten die Psalmen auswendig, die sie im Laufe des Tages immer wieder singend wiederholten.
Doch im 16. Jahrhundert änderte sich alles.
Ich möchte einen Text als Ausgangspunkt vorschlagen: einen von einem Theologen – Maurice Festugière. Maurice Festugière wurde 1870 in Frankreich geboren, war zunächst Marineoffizier und trat im Alter von 25 Jahren in die Benediktinerabtei von Maredsous in Belgien ein, wo er sein ganzes Leben als Mönch verbrachte – mit Ausnahme eines Romaufenthalts zur Promotion in Theologie sowie seines Dienstes als Marinekaplan im Ersten Weltkrieg. Der folgende Auszug stammt aus seinem Werk La liturgie catholique. Essai d’une synthèse (Abtei Maredsous, 1913), in dem er die liturgische Spiritualität entfaltet – die Spiritualität der Benediktiner und, im Kern, diejenige der Christen in den ersten dreizehn Jahrhunderten der Kirche.
Der Einfluß, den Ignatius von Loyola auf das geistliche Leben und die religiöse Erfahrung der katholischen Kirche hatte, ist erheblich – ja sogar grundlegend. Dieser Einfluß wirkte sich sowohl über die Gesellschaft Jesu selbst als auch über all jene aus, die sich an seinem Beispiel orientierten – und das sind Legionen.
Ignatius lebte in einer Epoche des ausgeprägten Individualismus.
[Anmerkung: Wenn Festugière von „Individualismus“ spricht, ist damit nicht der moderne Egoismus gemeint, sondern eine geistliche Haltung, die die persönliche Gottesbeziehung übermäßig betont – auf Kosten der gemeinschaftlichen Dimension des Glaubens. Diese individualistische Haltung ist typisch für das 15. Jahrhundert und findet ihren radikalsten Ausdruck im Protestantismus, der die Liturgie abschaffte und die persönliche Beziehung zu Gott absolut setzte.]
Nur wenige seiner Zeitgenossen verstanden, welche geistlichen Schätze die Liturgie über Jahrhunderte hinweg hervorgebracht und weitergegeben hatte. Ignatius setzte sich zum Ziel, gegen die Reformation vorzugehen – und in dieser Hinsicht bewies er unbestreitbar ein Genie: Er übernahm einen Teil des Programms des protestantischen Individualismus, paßte ihn jedoch vollkommen der römischen Orthodoxie an. Sein Streben richtete sich daher vor allem darauf, den Seelen, die sich seiner geistlichen Bewegung anschlossen, eine ausgesprochen individualistische Formung zu geben – und sie von allen sozialen Bindungen zu befreien, die ihre geistliche Wirkungskraft hemmen könnten.
Zur Umsetzung dieses zentralen Gedankens bedurfte es zweier entscheidender Neuerungen:
- Die Gründung eines Ordens, der vom gemeinschaftlichen Chorgebet vollständig dispensiert war. Das war in der gesamten Kirchengeschichte ein Novum: Noch nie hatte ein religiöser Orden auf das gemeinsame Stundengebet verzichtet.
- Die Einführung eines völlig neuen Meditationsverfahrens, das radikal mit allen bisherigen und traditionellen Formen des persönlichen Gebets brach.
Selbst in wenigen Worten lassen sich die Konsequenzen dieser Entscheidungen umreißen – Konsequenzen, die enorme Auswirkungen auf das gesamte katholische Leben haben sollten.
Die Söhne des Ignatius – und sie selbst geben dies unumwunden zu – schöpfen ihre geistliche Nahrung vor allem aus der persönlichen Meditation. Der Inhalt dieser Meditation hat dabei häufig keinerlei Bezug zur Liturgie. Das Brevier ist für sie lediglich eine religiöse Pflichtübung. Die feierliche Messe oder das gesungene Abendlob sind für sie Ausnahmen – und deshalb fördern sie nicht jene gemeinschaftlichen Formen des Gebets, die für das Leben einer Pfarrei so notwendig sind.
Bis hierhin ist alles klar. Doch die Analyse der ignatianischen Meditationsmethode aus Sicht der Liturgie erfordert noch tiefere Aufmerksamkeit.
Der Geist der Liturgie ist ein Geist liebevoller Freiheit.
Zwar waren Psalmen und andere heilige Texte von jeher besonders geschätzt, doch war die Liturgie niemals die einzige Quelle für das Gebet – sie war aber die prägende. Wie die ersten Christen beteten auch die Mönche in freier Weise, überließen sich kindlich der Gnade und den inneren Regungen der Seele. Dies war auch das Gebetsverständnis der Franziskaner – und es bestand lange vor dem Auftreten der Jesuiten.
In den Exerzitien jedoch führte Ignatius ein militärisches Gebetssystem ein, das die Seele und ihre Kräfte im Gleichschritt marschieren läßt – in einem blindem Gehorsam, wie der Rekrut dem Feldwebel folgt. Dieses Verfahren brachte zweifellos bedeutende Früchte der Heiligkeit in der Kirche hervor. Doch für eine große Zahl von Menschen ist es mit dem Geist der liturgischen Freiheit kaum vereinbar. Daher erleben jene, deren Seelen durch die Liturgie geprägt wurden, ein starkes Unbehagen – trotz guten Willens – wenn sie dem ignatianischen Schema unterworfen werden. Umgekehrt neigen Menschen, die von Kindheit an im ignatianischen Geist geformt wurden, dazu, die traditionellen Werkzeuge des Gebets als „wenig ernsthaft“ abzutun.
Der Liturgiehistoriker muß feststellen, daß der Jesuitenorden – trotz seines eifrigen Engagements für den katholischen Glauben seit dem 16. Jahrhundert – nichts unternommen hat, um die Gläubigen von der Entfremdung gegenüber der alten Pfarr- und Volksfrömmigkeit zu heilen. Vergleicht man den enormen Aufwand, den die Jesuiten betrieben (Jugenderziehung, Literaturverbreitung, Predigt usw.), mit dem eher bescheidenen Erfolg, den sie damit erzielten, so fragt man sich traurig, ob eine solche Kraft katholischer Vitalität nicht verschwendet wurde.
[Anmerkung: Wir sind nicht naiv genug, um die Liturgie als Allheilmittel zu betrachten. Aber welcher gewissenhafte Arzt würde sich – inmitten einer Krankheit – nicht vorwerfen, ein erprobtes Heilmittel vergessen zu haben? Ein Blick auf das Frankreich des 19. Jahrhunderts zeigt: Als das Konkordat von 1801 die Kirchen wieder für die Gläubigen öffnete und die Seelen der Jugend neu geprägt werden konnten – wie viele echte Christen sind daraus hervorgegangen? Die Statistiken und weiteren Ereignisse sind ernüchternd. Es wäre wichtig, sich zu fragen: Warum?]
Gibt es einen unversöhnlichen Gegensatz zwischen der alten Spiritualität und der von Ignatius begründeten? Eine heikle Frage.
Was uns als wahr erscheint:
- Bezüglich der Inhalte der Meditation besteht kein Widerspruch. Mit etwas gutem Willen läßt sich auch aus liturgischen Themen ein strukturiertes, systematisches Meditationsschema entwickeln, das dem liturgischen Jahreskreis folgt.
- Was jedoch den ignatianischen Methodus betrifft, sind wir weniger optimistisch.
Wenn man Kleriker, Laien und junge Menschen zum Verständnis und zur Wertschätzung der Liturgie führen will – wenn man sie dafür gewinnen möchte, aus der Liturgie zu leben, wie es die Christen der ersten dreizehn Jahrhunderte taten –, dann darf man ihnen keine geistliche Prägung geben, die dem liturgischen Geist entgegensteht.
Denn Erfahrung und Nachdenken lehren uns: Der ignatianische Weg läuft dem Geist der Liturgie entgegen. Deshalb wäre es dringend nötig, die starren Strukturen dieses Systems zu mildern.
Kann man dieser Schlußfolgerung entgehen? Wir wünschen, daß Geschicktere als wir es vermögen – doch wir konnten es nicht.
Ein möglicher Einspruch: Erzielt das ignatianische System nicht wirksamere moralische Ergebnisse als andere Gebetsweisen?
Eine knappe Antwort:
Wenn wir von bereits fortgeschrittenen Seelen sprechen, würde sogar Ignatius selbst zugeben, daß sein System für sie nicht notwendig ist.
Wenn es sich um gewöhnliche Christen handelt, die ausschließlich ignatianisch und nicht liturgisch gebildet wurden, wird ihnen die Liturgie tatsächlich leer erscheinen. Für jene jedoch, die eine liturgische Bildung empfangen haben, ist die Lage eine andere: Sie leben aus ihr – wie die Christen der ersten Jahrhunderte.
[Anmerkung: Wer aus der individualistischen Mentalität moderner Frömmigkeit in die liturgische Mentalität zurückfinden will, muß einen tiefgreifenden Wandel durchmachen – eine langsame, geduldige Umerziehung. Ohne diese Verwandlung begreift man nicht, was es heißt, aus der Liturgie zu leben. Man versteht nicht, wie das Innenleben der Katholiken in den ersten dreizehn Jahrhunderten beschaffen war. Wir kennen Menschen, die Jahre gebraucht haben, um zu erfassen, daß die Teilnahme an einer feierlichen Messe etwas „Erfüllenderes“ ist als der Besuch einer stillen Messe.]
Aber man könnte uns einen weiteren Einwand entgegenhalten: Gibt es nicht einen Zusammenhang zwischen den Methoden des Gebets und den theologischen Theorien über die Gnade – zwischen der Weise, in der der Christ seine geistlichen Erfahrungen „lenkt“ (denn wenn man die mystischen Zustände beiseiteläßt, ist es offensichtlich, dass die Seele die Fähigkeit besitzt, ihre Erfahrungen zu steuern), und der Weise, in der er das Wirken Gottes auf die menschliche Freiheit auffaßt?
Die augustinische Gnadenlehre etwa paßt wunderbar zur alten Gebetspraxis, die die Seele dem Hauch göttlicher Inspiration überläßt. Sie paßt aber weniger gut zur strukturierten, vorbereiteten und „willensgesteuerten“ ignatianischen Meditation. Die Regel des heiligen Benedikt atmet den Geist der augustinischen Theologie. Doch es wäre falsch, hier einen schroffen Gegensatz zur ignatianischen oder gar molinistischen Theologie zu konstruieren.
Allerdings scheint uns, daß die Theologie des Molinismus in direkter Verbindung zu den Exerzitien des Ignatius steht. Die Redewendung id quod volo („das, was ich will“) – die in den Exerzitien wie die Sporen eines Reiters auf dem Pflaster klirrt – ist hier besonders bezeichnend.
Ignatius selbst entwickelte keine eigene Gnadentheologie; sein Genie war ganz auf die Praxis und das geistliche Leben ausgerichtet. Doch es fällt schwer, sich nicht dem folgenden Eindruck anzuschließen: Die molinistische Theologie ist im Grunde aus einem Handbuch für Spiritualität und Askese hervorgegangen, das vom Gründer der Gesellschaft Jesu verfaßt wurde. Theologie und Spiritualität gehen hier Hand in Hand – als koordinierte Antwort auf den Protestantismus.
[Anmerkung: Der Molinismus geht zurück auf Luis de Molina, einen Theologen der Gesellschaft Jesu im 16. Jahrhundert, der in der berühmten De-auxiliis-Kontroverse gegen die Dominikaner für die Rolle des freien Willens in der Gnade eintrat – im Gegensatz zur augustinischen Betonung der unverdienten Gnade. Molina gilt auch als geistiger Vorläufer der modernen Demokratie: Er behauptete, daß die Macht nicht vom Herrscher, sondern von den Regierten ausgehe – also von den Bürgern als Einzelpersonen. Damit nahm er viele spätere Freiheitsideen der Neuzeit vorweg.]
*Caminante Wanderer, argentinischer Philosoph und Blogger
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: gesuiti.it (Screenshot)