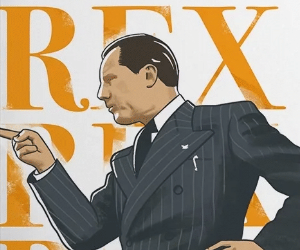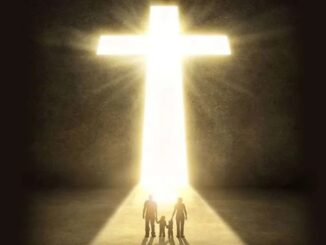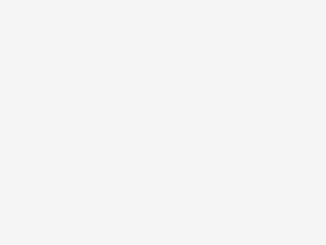Im Jahre 1974 brachte der hessische Kultusminister Ludwig von Friedeburg die „Rahmenrichtlinie Gesellschaftslehre“ heraus, die bundesweit als linksideologische Indoktrination bekannt werden sollten.
Ein Gastbeitrag von Hubert Hecker.
Der damalige Kultusminister der hessischen SPD/FDP-Regierung war vorher Mitarbeiter des marxistisch orientierten Frankfurter Instituts für Sozialforschung gewesen. Er hatte 1960 bei Adorno habilitiert.
Die von Adorno und Horkheimer inspirierten Schriften überfluteten seit von Friedeburgs Dienstantritt 1969 die hessischen Schulen und Lehrer, um sie auf marxistische Linie zu bringen.
Neo-Marxisten an die Schülerfront
Das Literaturverzeichnis der Rahmenrichtlinie liest sich wie ein Gruselkabinett linksideologischer Aktivisten und Propagandisten: Karl Marx und Friedrich Engels natürlich, Rosa Luxemburg und Wolfgang Abendroth, Wilhelm Reich und viele andere Alt-Marxisten. An aktuellen Schriften wurden die Werke vom „Schülerladen Rote Freiheit“ empfohlen sowie weitere Neo-Marxisten.
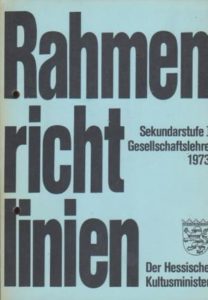
Der Pädophilenaktivist Helmut Kentler warb für „repressionsfreie Sexualpolitik“, Dietrich Haensch wetterte gegen „repressive Familienpolitik“, Herbert Marcuse verurteilte „repressive Toleranz“, Peter Brückner klärte über „Schülerliebe“ auf, Ludwig Marcuse über „Obszönitäten“, Margret Mead warb mit ihrer gefälschten Feldanalyse in primitiven Gesellschaften für freie Liebe.
Mit dem neugeschaffenen Fach „Gesellschaftslehre“ zollte man dem damals modischen Soziologismus Tribut. Dabei wurden die Fachinhalte der Fächer Geographie und Geschichte, Wirtschaftslehre und Politik unter der kritischen Gesellschaftsphilosophie der Frankfurter Schule vereinigt und vereinnahmt.
„Dementsprechend bildet die Befähigung zur Selbst- und Mitbestimmung das oberste Lernziel der Gesellschaftslehre“, heißt es in der Einleitung der Rahmenrichtlinie.
Zu diesem Ziel sollte die „Autoritätsfixierung“ in allen gesellschaftlichen Dimensionen und Bereichen von Politik, Erziehung und Wirtschaft zerstört werden. Mit dem Kampf gegen „autoritäre Charakterstruktur“ wollten die Autoren der Gesellschaftslehre Adornos Theorie des autoritären Charakters in der schulischen Praxis umsetzen.
Die Lehrplanmacher schrieben vor, dass „Autoritätsfixierung“ für die Schüler der 9. Klasse „als Ergebnis von Triebunterdrückung“ zu vermitteln sei (S. 150f). Die psychischen Mechanismen autoritärer Erziehung würden zu Anpassung und „Herrschaftssicherung“ des Establishments ge- und missbraucht werden. Auf der andern Seite führten „nicht realisierbare Triebwünsche“ zu diffamierenden „Projektionen auf Minderheiten“.
Weg mit der Triebunterdrückung!
Unter diesen psychoanalytischen Theorien hatte auch die Behandlung der frühkindlichen Sexualitätsentwicklung zu stehen. So sollten die Schüler/innnen dahingehend orientiert werden, dass während der sogenannten „oralen und analen Phase des Kleinkinds“ auf die „Lockerung der traditionellen Rituale bei der Ernährung“ sowie die „Abkehr von der Sauberkeitsdressur“ erfolgte. Denn nach der Psychoanalyse von Sigmund Freud würde die Sauberkeitserziehung einen anal-autoritär fixierten Charakter hervorbringen.
Bei den Verhaltensweisen von Jugendlichen sollten die Probleme wie „Onanie, Petting, Geschlechtsverkehr, Orgasmus, Potenzängste, Pornographie, Schwangerschaftsverhütung, Homosexualität und Partnerwahl“ bei den Neuntklässler frei und offen zwischen der kulturell berechtigten Forderung nach Triebsublimierung und der abzulehnenden „Triebunterdrückung im Sinne von Herrschaftssicherung“ erörtert werden.
In weiteren Lernschritten müssten die Schüler lernen, die gesamte Geschichte und Gesellschaft nach irrationalen Autoritätsansprüchen und ‑bindungen durchzukämmen.
Freie Bahn für antiautoritäres Chaos!
Auch im Schulbereich selbst sollen die Schüler jeden personalen und strukturellen Autoritätsanspruch infrage stellen können: „Jede Anerkennung von Autorität ist an deren kritische Prüfung zu binden“. Die Schüler wurden aufgefordert, jede pädagogische Maßnahme der Lehrpersonen unter autoritätsideologischen Gesichtspunkten zu prüfen und auch die Autorität des Lehrers grundsätzlich unter kritische Beobachtung zu stellen.

So wurde das antiautoritäre Chaos an den Schulen der 70er Jahre programmiert: Clevere Schüler provozierten die Lehrer mit Dauerkritik als autoritäre Staatsbüttel – nach dem Vorbild der 68er Studenten gegen ihrer Lehrer Adorno selbst (siehe Der ‚autoritäre Charakter’ ist an allem schuld). Desinteressierte Schüler reagierten mit Lernverweigerung und Störungen.
Wenn in diesem Chaos Schüler nach „strengen Durchgreifen und Strafen“ verlangen würden, um einigermaßen geordneten Unterricht zu ermöglichen, dann dürfte der Lehrer einer solchen irrationalen Einstellung nach Autoritätsformen keinesfalls nachgeben.
„Die mangelnde Fähigkeit der Schüler, ihre Bereitschaft zur Selbst- und Mitbestimmung und ihrem Wunsch nach vernünftigem Verhalten auch nachzukommen, sollte nicht lediglich als Ausdruck für mangelnde Reife verstanden werden“ (S. 154).
Vielmehr müssten solche Erfahrungen Anlass dafür sein zu fragen, was Elternhaus und Schule bisher versäumt hätten, um Schüler bei der Wahrnehmung ihrer Selbst- und Mitbestimmungsrechte zu befähigen.
Auch zu den staatlichen Institutionen sollten die Schüler zu subversiv-kritischer Einstellung animiert werden: „So braucht also der Unterricht nicht nachzuweisen, dass Gerichte, Polizei oder Feuerwehr notwendig sind, sondern Unterricht setzt dort an, wo bestimmte Maßnahmen / Entscheidungen von Trägern öffentlicher Aufgaben Kritik auslösen“.
Ergänzt wurde dieses Kernstück hessischer Gesellschaftslehre nach dem Geist der Frankfurter Schule mit dem Thema: „Jugendkriminalität als Protesthaltung“. Drogenmissbrauch, Gewalttätigkeit, Körperverletzung, Sittlichkeitsverbrechen, Eigentumsdelikte sollen vor allem nach den sozialen Bedingungen und Verhältnissen hin untersucht werden, die zu diesen Konflikten und Delikten geführt hätten.
Die in dem kriminellen Handeln der Jugendlichen zum Ausdruck kommende Protesthaltung gegen die herrschenden gesellschaftlichen Normen sollten den Schülern zum Anlass gegeben werden, eben diese Normen kritisch zu prüfen und gegebenenfalls auf Änderung zu dringen.
Diese linksideologische Methode der Erklärung und Verharmlosung von Drogenmissbrauch und Gewalttätigkeiten kommt einer indirekten Rechtfertigung und Förderung gleich. Im Drogenbereich jedenfalls schnellten die Zahlen von Missbrauchsfällen Anfang der 70er Jahre in ungeahnte Höhen.
Autoritäre Vorschriften zu herrschaftsfreier Didaktik
In ähnliche Richtung ging auch die hessische Rahmenrichtlinie Deutsch, nach der den Lehrern untersagt war, schlechtes Deutsch und die mangelnde Sprachkompetenz der sogenannten Unterschichtkinder zu korrigieren und auf die Ebene der Hochsprache zu heben, weil dadurch die Kinder diskriminiert würden.
Einübung von Rechtschreibung wurde als „Ausübung von Herrschaft“ angesehen. Sich an die Regeln der Orthographie zu halten kritisierte man als „Unterwerfung unter herrschende Normen“.

Wer nun meint, eine solches verrücktes Chaos und Ineffektivität produzierendes Pädagogikprogramm müsste doch spätestens nach der Erprobungsphase im Papierkorb gelandet sein, unterschätzt die Energie der 68er.
Die Schule war die erste Station des Gangs durch die Institutionen und das erste Experimentierfeld einer totalen „Systemveränderung“, was in Hessen nur teilweise gelang und von zwei CDU-Regierungen wieder zurückgedrängt werden musste.
Aber der damalige Geist ist an hessischen Schulen immer noch und immer wieder zu spüren, wenn die damals linksverdrehten Schüler heute als Eltern ihre Kinder zu Schülerstreiks und frechen Unbotmäßigkeiten aufstacheln und manche Lehrer nur verängstigt und übervorsichtig ihrer pädagogischen Autorität und Aufgabe gerecht werden.
In anderen Bundesländern behauptet die linkslastige Arroganz weiterhin ihre lähmenden Bürde. Mit der nordrhein-westfälischen Rahmenrichtlinie für das Fach Geschichte von 1993 etwa wird den Lehrern eine streng herrschaftsfreie Geschichtsdidaktik – autoritär – vorgeschrieben.
Der Lehrplan untersagt ein „lehrerzentriertes asymmetrisches Kommunikationsverhalten“, weil das „bei den Schülerinnen und Schülern rezeptive Lern- und Verhaltensmuster erzeugen“ würde. Auf Deutsch: Der ausgebildete Fachlehrer soll den Stoff nicht lehren und die Schüler sollen nicht eifrig – „rezeptiv“ – lernen.
Stattdessen soll der Lehrer die jeweiligen „Lernbedürfnisse und Erkenntnisinteressen der Schüler“ herausfinden und davon ausgehend bei den Schülern einen Prozess selbständiger und selbsttätiger Geschichtserforschung evozieren. Dieser Lernprozess sei nur über „symmetrische Kommunikationsformen zu erreichen, in denen Herrschaft mittels der Sprache durch sprachliche Hilfe ersetzt ist.“
Dabei seien die „differierenden Sprachstrategien und entwicklungspsychologischen Artikulationsgewohnheiten von Jungen und Mädchen zu berücksichtigen, … die nicht mit Leistungsverweigerung verwechselt“ werden dürften.
Wenn etwa Schüler im Geschichtsunterricht äußern: „Wir haben heute kein’ Bock auf Mittelalter!“, so soll der Lehrer dieses aktuelle Desinteresse als entwicklungspsychologische Sprechstrategie akzeptieren und mittels einer symmetrischen Kommunikationsform herausfinden, welche Geschichtsepoche den jungen Leuten denn aktuell ein Lernbedürfnis und für sie im Augenblick erkenntnisinteressant wäre.
Der Lehrer setzt sich also in den Schülerkreis und fragt: Was hättet ihr denn heute gern mal gemacht? Und wenn die Schüler irgendwann sagen: Müssen wir heute wieder machen, was wir wollen, dann hat der Lehrer sie über ihren Mangel an Selbstbestimmungsbewusstsein aufklären, was durch die elterliche Dressur in der oral-analen Phase der frühkindlichen Erziehung entstanden sei.
Die Methode einer herrschaftsfreien Didaktik, die den Lernstoff als Ergebnis einer kommunikationssymmetrischen Diskussion zwischen Lehrer und Schüler setzt, erklärt hinreichend den PISA-Lernrückstand von Neuntklässlern in Bundesländern mit vieljähriger SPD-Herrschaft. Im roten Bremen war der Einfluss der 68er auf Schule und Hochschule besonders nachhaltig. Das kleine Bundesland belegte bei dem ersten PISA-Test einen der letzten Plätze der untersuchten OECD-Länder. Die CDU/CSU-geführten Länder Bayern und Baden-Württemberg dagegen standen damals an 9. bzw. 10 Stelle, direkt hinter Schweden.
In der Reihe bereits veröffentlicht:
- Marxistische Elitedenker der Frankfurter Schule – Adorno und die 68er (1)
- Die Wacht am Nein – Adorno und die 68er (2)
- Der ‚autoritäre Charakter’ ist an allem schuld – Adorno und die 68er (3)
Text: Hubert Hecker
Bild: Wikicommons