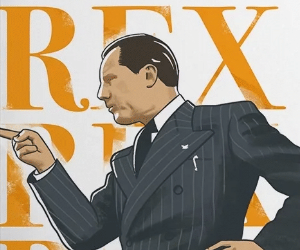(Rom) Knapp 30 Minuten dauerte die Begegnung zwischen Papst Franziskus und US-Präsident Donald Trump. Sie war für 8.30 Uhr angesetzt worden. Um 9.30 Uhr begann auf dem Petersplatz bereits die Generalaudienz. Die Zusammenkunft zwischen dem katholischen Kirchenoberhaupt und dem neuen US-Präsidenten fand hinter verschlossenen Türen statt.
Kurienerzbischof Georg Gänswein begrüßte Präsident Trump und sein Gefolge im Damasushof und begleitete ihn zum Papst, wo die Begegnung unter Ausschluß der Öffentlichkeit fortgesetzt wurde. Nur ein junger, englischsprachiger Priester war als Übersetzer zugegen. Anschließend begrüßte Franziskus auch die Begleitung des Präsidenten, dessen Frau Melania, Tochter Ivanka und Schwiegersohn Jared Kushner.
Trump traf sich zudem mit Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin, der von Msgr. Paul Richard Gallagher, dem vatikanischen „Außenminister“ begleitet wurde.
Laut vatikanischem Presseamt sei die beiderseitige Genugtuung über die guten bilateralen Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl und den USA hervorgehoben worden. Betont wurden auch das gemeinsame Interesse und der gemeinsame Einsatz für das Leben und die Freiheit der Religion und des Gewissens.
Beide Seiten hätten sich, laut Presseamt, für eine gute Zusammenarbeit zwischen Kirche und Staat in den USA aus im gemeinsamen Einsatz für die Menschen in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Hilfe für die Einwanderer.
Am Ende der halbstündigen Aussprache habe der US-Präsident dem Papst versichert: „Ich werde Ihre Worte nicht vergessen“.
Wall Street Journal: Versuch einer Gleichsetzung von Papst und Präsident

Gestern schrieb Bill McGurn in der Europa-Ausgabe des Wall Street Journal, daß Papst Franziskus und Donald Trump sich näher sein könnten, als die Öffentlichkeit denkt. Als Beispiel nannte der Kolumnist, daß beide dazu neigen, Personen „zu beleidigen“, die nicht ihrer Meinung sind.
Als konkretes Beispiel schrieb McGurn: „Derselbe Mann, der berühmterweise sagte, ‚Wer bin ich, um zu urteilen‘, hatte kein Problem damit, jemand, der daran denkt, eine Grenzmauer zu errichten, als ‚unchristlich‘ zu verurteilen.“ Derselbe Papst sagte ein Jahr später, er mag es nicht, wenn „vorschnell“ über Personen geurteilt werde. Gleichzeitig warnte er vor der „Gefahr“, „Populisten“ zu wählen und verglich diese mit Hitler.
US-Präsident Trump, so McGurn, sei nicht der einzige, der den „päpstlichen Stachel“ zu spüren bekomme. Franziskus halte auch einen Großteil seiner Herde für „bedauernswert“. Den katholischen Frauen sagte er, sie sollten sich „nicht wie Karnickel vermehren“. Wen jemand nicht mit ihm übereinstimme, so ließ Franziskus wissen, habe er wohl einen „psychisches Schaden“.
Die gemeinsame Neigung von Papst und Präsident, ihre Gegner zu beleidigen, werde von kaum jemand bemerkt.
McGurns Grundtenor ist seine Verteidigung von Freihandelsabkommen. Donald Trump, so der Kolumnist, mache kein Hehl aus seiner Abneigung gegen den allgemeinen Freihandel. Er habe protektionistische Ansätze und kritisiere die Verlagerung von Produktionsstätten ins Ausland als „unpatriotisch“. Papst Franziskus unterscheide sich nicht wirklich darin, denn auch er behandle den Freihandel als Form des Yankee-Imperialismus. In Evangelii gaudium schrieb er von einer „Wirtschaft, die tötet“.
McGurn wirft Papst Franziskus vor, zur Krise in Venezuela zu schweigen, weil dieses Land sozialistisch regiert wird. Doch nicht in Hong Kong, wo der Kapitalismus herrsche, werden Menschen getötet, sondern in Venezuela.
Wie genau sich die päpstliche Kapitalismus-Kritik, die McGurn beklagt, mit dem ausgeprägten Geschäftssinn von Donald Trump auf eine gemeinsame Linie bringen läßt, der in den Augen des Papstes als Prototyp eines Kapitalisten erscheinen muß, verrät der Kolumnist in seiner etwas gezwungen wirkenden Gleichsetzung der beiden Staatsführer nicht.
McGurn abschließend:
„Die wahre Tragödie der Begegnung am Mittwoch im Vatikan ist, daß weder der Präsident noch der Papst in der Situation ist, sich auf den anderen einzulassen.“
Text: Andreas Becker
Bild: CTV/vatican.va (Screenshots)