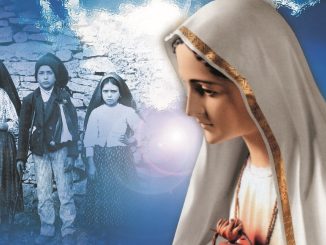(Rom) Die Zahl der weltweiten „Erscheinungsorte“, an denen Engel, Maria oder Jesus einem oder mehreren Personen erscheinen, „Botschaften“ geben, spezielle „Offenbarungen“ enthüllen, „wundersame“ Zeichen schenken, Heilungen passieren, hat in den vergangenen Jahr stark zugenommen. Was sagt die Kirche dazu? Skepsis und Vorsicht gegenüber Formen des Apparitionismus sind geboten. Dennoch steht die Frage im Raum, was es damit auf sich hat.
Zunächst stellt sich die Frage nach der Echtheit des einen oder anderen Phänomens. Die Kirche reagiert vorsichtig, zurückhaltend und behutsam. Sie hat keine Eile, weil die göttliche Offenbarung mit Christus abgeschlossen ist und „Sonderoffenbarungen“ ihr nichts mehr hinzufügen können, was nicht schon gesagt ist. Es handelt sich dabei, ob anerkannt oder nicht, bei allen Phänomen seither um Privatoffenbarungen, denen kein offizieller Charakter zukommt und die – selbst bei kirchlicher Anerkennung – von keinem Gläubigen geglaubt und anerkannt werden müssen.

Die Marienerscheinungen von Fatima, die vor 100 Jahren stattfanden und von der Kirche offiziell anerkannt sind, lassen sich mit der Aufforderung zu Buße und Umkehr zusammenfassen, die mit der Verheißung verbunden ist, daß dadurch Frieden, Eintracht und Wohlergehen herrschen werden, aber auch mit der Warnung, daß andernfalls durch die Sünde der Menschen Krieg und Verderben heraufbeschwört werden. Die Botschaft von Fatima sind keine neue Offenbarung, sondern eine Bekräftigung und Verdeutlichung des bereits Bekannten.
Wenn die Kirche eingreift, dann primär unter dem Gesichtspunkt, Gläubige vor Ab- und Irrwegen zu bewahren. Privatoffenbarungen sind dann als falsch abzulehnen, wenn sie die göttliche Offenbarung Jesu Christi verbessern, vervollständigen, ergänzen, überwinden oder korrigieren wollen. Privatoffenbarungen können nur dann echt sein, so die Kirche, wenn sie die Gläubigen an die göttliche Offenbarung heranführen und beitragen, daß die Menschen diese besser verstehen und sich zu eigen machen. Als Maßstab bei der Frage nach der Echtheit gilt, ob eine „Erscheinung“ sich verselbständigt oder vom genannten Ziel abweicht und ein anderes oder „besseres“ Angebot macht, als den Heilsweg Christi. Privatoffenbarungen führen, wenn sie echt sind, immer zur geoffenbarten Wahrheit hin. Ein besonderes Merkmal ist, daß sie zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Gegend auf eine bestimmte Wahrheit hinweisen, die gerade bedroht ist. Echte Erscheinungen können nie der bloßen Sensationslust dienen, wie Papst Franziskus mehrfach kritisierte und sogar von einer Erscheinungs- und Botschaftensucht sprach.
Warum nehmen „Erscheinungen“ immer mehr zu?
Weiter stellt sich die Frage, warum es heute so viele Phänomene gibt, diese weltweit auftreten und an Zahl immer mehr zunehmen. Hat das eine besondere Bedeutung? Sind es warnende Zeichen einer Negativbeschleunigung im Weltenlauf? Offenbar sind sie Signale einer Überhitzung, doch welcher? Überhitzt sich die Welt durch eine sündhafte Abkehr von Gott? Überhitzen sich Teile der Christenheit als Reaktion auf eine um sich greifende Entchristlichung? Oder handelt es sich um eine vom Himmel gewährte Form der spirituellen Regulierung, weil die derzeitigen Kirchenvertreter den Gläubigen nicht mehr ausreichend geistliche Nahrung geben?
Es gibt Tabellen, in denen alle bekannten Marienerscheinungen der Geschichte chronologisch aufgelistet sind. Die Auflistungen sind unterschiedlich. Der bekannte Mariologe René Laurentin, der wenige Tage nach der letzten Marienerscheinung in Fatima geboren wurde und daher im 100. Lebensjahr steht, listet in seinem 2010 erschienen, monumentalen Dictionnaire des apparitions de la vierge Marie mehr als 2.400 unterschiedliche Marienerscheinungen auf. Der weitaus größte Teil ereignete sich in den vergangenen 350 Jahren, von denen nur überschaubare 15 von der Kirche offiziell anerkannt wurden (Ort, Zeit, Name des Sehers):
- Laus (1664–1718), Benà´ite Rencurel
- Rom (1842), Alphonse Ratisbonne
- La Salette (1846), Maximin Giraud, Melanie Calvat
- Lourdes (1858), Bernadette Soubirous
- Champion (1859), Adele Brise
- Pontmain (1871) Eugene Barbedette, Joseph Barbedette, Francois Richer, Jeanne Lebossé
- Dietrichswalde (1877), Justine Schafrinska, Barbara Samulowska
- Knock (1879), Margaret Beirne und weitere Personen
- Fatima (1917), Lucia Dos Santos, Franciso Marto, Jacinta Marto
- Beauraing (1932), Fernande Voisin, Gilberte Voisin, Albert Voisin, Andrée Degeimbre, Gilberte Degeimbre
- Banneux (1932), Mariette Béco
- Amsterdam (1945–1959), Ida Peerdemann
- Akita (1973–1981), Agnes Sasagawa
- Betania (1976–1988) Maria Esperanza Medano
- Kibeho (1981–1986), Aphonsine Mumereke, Nathalie Ukamazimpaka, Marie-Claire Mukangango
Welche Bedeutung hat die Topograhie der Erscheinungen?
Welche Bedeutung kommt der Topographie dieser anerkannten Erscheinungsorte zu? Welche Bedeutung ihrem zeitlichen Auftreten? Es fällt auf, daß der italienische (Ratisbonne war Sohn einer jüdischen Familie aus dem Elsaß) und der deutsche Sprachraum (die beiden Seherinnen im ermländischen Dietrichswalde waren Polinnen) nicht davon berührt sind, stark hingegen der französische Sprachraum.

An den Tabellen läßt sich ablesen, daß in jüngster Zeit eine rapide Zunahme dieser Phänomene stattgefunden hat. Wie erklärt sich das? Psychologisierend wird in diesem Zusammenhang gerne, gelegentlich auch innerkirchlich, auf eine unbewußte Sehnsucht religiöser Menschen nach Sicherheit in einer zunehmend agnostischen und unsicher werdenden Welt verwiesen. Sind die „Erscheinungsphänomene“ nur Projektionen eines inneren Sicherheitsbedürfnisses überspannter Zeitgenossen? Das Erklärungsmuster ist alt und reicht bereits in vorigen Jahrhunderte zurück. So wenig wie es damals taugte, scheint es auch heute untauglich, die quantitative und qualitative Bandbreite des Erscheinungsphänomens ausreichend erfassen und erklären zu können. Ihm haftet zudem der Beigeschmack antiklerikaler Ablehnung an. Wer nicht glauben will, wehrt sich massiv gegen übernatürliche Phänomene, weil er instinktiv wittert, daß die Bereitschaft, auch nur die Echtheit eines einzigen Phänomens anzuerkennen, aufgrund der intellektuellen Redlichkeit zwangsläufig die Anerkennung eines personalen Gottes, der Herr über Leben und Tod und Gedeih und Verderb ist, nach sich zieht. Die Kirche hat von diesem antiklerikalen Zwang viel profitiert, wie das Gezerre um die Echtheit des Turiner Grabtuches belegt. Wer ehrlich auf der Suche nach der Wahrheit ist, und aus dieser Haltung heraus, die Echtheit eines übernatürlichen Phänomens zu widerlegen versucht, dient letztlich der Kirche, denn er wird am Ende Gegenargumente entkräften und neue Indizien für die Echtheit liefern. Kein Nutzen entsteht dort, wo nicht Wahrheitssuche, sondern verstockte Ablehnung am Werk sind. Die Mittel dieser Gegner sind nicht die Wissenschaft, sondern Niedertracht und Spott.
Sind die zahlreichen „Erscheinungen“ sogar hinderlich für die Glaubensweitergabe? Dies behaupten manche in der Kirche, die einen Irrationalismus gegen die Ratio am Werk sehen, der zu einer weiteren Entfremdung von Christen und Nicht-Christen beitrage und die Kluft zwischen der modernen Welt und einer zurückgebliebenen Kirche vertiefe. Oder ist das Erscheinungsphänomen ein notwendiges Hilfsmittel, das der Himmel gerade in unserer Zeit großzügig gewährt, um die Menschen daran zu erinnern, daß Gott die Naturgesetze geschaffen hat und sie selbst überwinden kann, damit sie nicht im Materialismus ersticken?
Welche Bedeutung hat die Botschaftenflut?
Mit der Zunahme der „Erscheinungsorte“ hat auch die Zahl der „Botschaften“ zugenommen. Damit ist nicht die Gleichung mehr Orte, mehr Botschaften gemeint. Die Zahl der an den einzelnen „Erscheinungsorten“ ausgegebenen Botschaften hat sich vielmehr teils exorbitant vermehrt. Es scheint eine ganze Privatoffenbarungsindustrie zu geben. Wie erklärt sich dieses Phänomen? Welchen Sinn und Nutzen hätte es, sollte es echt sein? Wieviel davon ist echt? Wieviel Trittbrettfahrertum? Wieviel Betrug?
Medjugorje scheint dabei ein Eckpunkt zu sein. Auch davor gab es Visionäre, die oft jahrelang Schauungen hatten, die sich in verschiedener Formen artikulierten, aber nur in kleinem Umfang in Form von Botschaften für die Öffentlichkeit. Medjugorje ist der erste „Erscheinungsort“, wo seit 1981 eine kaum mehr überschaubare Anzahl an „Botschaften“ an die ganze Menschheit ausgegeben wurde und weiterhin werden. Diese „Botschaftenflut“, die zuvor in der Kirchengeschichte unbekannt war, trat seither an zahlreichen anderen Orten auf. Haben Erscheinungen in einer bestimmten historischen Epoche bestimmte, gemeinsame Merkmale? Ist die Botschaftenflut die ein Merkmal unserer Zeit?
In den vergangenen Jahren kam das Phänomen von „Anonymbotschaften“ hinzu, das unter dem Stichwort „Die Wahrheit“ bekannt wurde. Niemand kennt den oder die „Seher“, alles geschieht anonym, unüberprüfbar und unkontrollierbar. Die Kirche nahm nicht offiziell dazu Stellung. Von verschiedenen Kirchenvertretern wurde das Phänomen jedoch als offenkundiger Betrug kritisiert und namentlich mit einer Sekte mit Bezug zu Australien in Zusammenhang gebracht, deren Guru wegen sexuellen Mißbrauchs im Gefängnis sitzt. Was es auch immer damit auf sich haben sollte: Anonymbotschaften des Himmels sind ein Widerspruch in sich, wie Kirchenvertreter betonen.
So wie die „Die Wahrheit“ auftauchte, verschwand sie auch wieder. Auch in diesem Fall gibt es Nachfolgephänomene, die plötzlich demselben Muster folgen und wie Trittbrettfahrer wirken.
Kirchliches Vorgehen
1978 erließ die Glaubenskongregation Normen „über die Vorgangsweise bei der Beurteilung angeblicher Erscheinungen und Offenbarungen“. Zuständig ist demnach der Ortsbischof. Er hat eine Expertenkommission zu berufen und das Phänomen untersuchen zu lassen. Auf der Grundlage dieser Untersuchung kann er sich äußern. Ist Gefahr im Verzug muß er sich äußern. Aufgrund von Besonderheiten und Auswirkungen, die über die Diözesangrenzen hinausgehen, kann sich die Bischofskonferenz des Landes damit befassen oder auch der Heilige Stuhl.
Schon damals beklagte die Glaubenskongregation:
„Andererseits machen es die heutige Mentalität und die Notwendigkeit einer kritischen wissenschaftlichen Untersuchung schwieriger, wenn nicht fast unmöglich, mit der gebotenen Schnelligkeit jenes Urteil zu fällen, das in der Vergangenheit die Untersuchungen zur Sache abgeschlossen hat (constat de supernaturalitate, non constat de supernaturalitate) und den Ordinarien die Möglichkeit bot, den öffentlichen Kult oder andere Formen der Verehrung durch die Gläubigen zu gestatten oder zu verbieten.“
Drei mögliche Entscheidungen bezüglich der Echtheit sind vorgesehen: ein negatives Urteil (constat de non supernaturalitate; die Nicht-Übernatürlichkeit steht fest), ein abwartendes Urteil (non constat de supernaturalitate; die Übernatürlichkeit steht nicht fest) und ein positives Urteil (constat de supernaturalite; die Übernatürlichkeit steht fest). Das abwartende Urteil besagt neutral, daß zum gegebenen Zeitpunkt eine Übernatürlichkeit des Phänomens nicht feststeht, aber ebensowenig ein negatives Urteil abgegeben werden kann. In den Normen von 1978 ist diese neutrale Zwischenstufe nicht vorgesehen, wird aber seither praktiziert.
Im März 2015 sprach der Erzbischof von Brindisi ein negatives Urteil über die von einem örtlichen „Seher“ behaupteten „Erscheinungen“ aus.
Es gibt noch einen vierten Weg, der in der Vergangenheit mehrfach begangen wurde. Ein Ortsbischof äußert sich offiziell gar nicht zu einem Phänomen, erkennt aber die Güte der dadurch geförderten Frömmigkeit an. In diesem Fall wurden „Erscheinungsorte“ nicht als solche anerkannt, aber zu Gebetsstätten erhoben und damit der Kult in gewisser Weise erlaubt. So ist es in Heroldsbach geschehen oder jüngst durch den Erzbischof von Catania, der 2000 den „Erscheinungsort“ von Belpasso zur Gebetsstätte erhob. Dort soll von 1981–1986 die Gottesmutter erschienen sein. Die Erscheinungen wurden nicht anerkannt. Der Erzbischof begab sich dennoch jährlich zum Jahrestag der „Erscheinungen“ zur Gebetsstätte, ebenso inzwischen sein Nachfolger.
Auch Guadalupe in Mexiko wurde offiziell nie anerkannt, sondern nur de facto. Weil die Anerkennungen seit Jahrhunderten konsolidiert ist, verzichtet die Kirche auf eine nachträgliche Formalisierung.

Als die Gottesmutter dem bereits getauften Azteken Juan Diego (sein heidnischer Name war Cuauhtlatoatzin) 1531 erschien, war das Christentum gerade erst seit zehn Jahren bis in diese Gegend vorgedrungen. Der Ortsbischof ließ am Ort der Erscheinung eine Kapelle errichten. Kurz darauf gewährte Papst Gregor XIII. den Pilgern einen vollkommenen Ablaß. Die Anerkennung erfolgte sofort, wenn auch ohne Dekret. 2002 wurde Juan Diego von Papst Johannes Paul II. heiliggesprochen.
Keine offizielle Anerkennung gibt es auch für die Erscheinungen der heiligen Catherine Labouré von Paris. Eine solche lehnte Labouré ab, weil sie jedes Aufsehen um ihre Person vermeiden wollte. Ihre Mitschwestern im Orden erfuhren erst Jahrzehnte später, daß die Gottesmutter ihr den Auftrag zum Prägen der Wundertätigen Medaille erteilt hatte. Die Medaille war daher vom Erzbischof von Paris nur mittels pastoraler Maßnahmen anerkannt und gefördert worden.
Erscheinungen und Privatoffenbarungen können, wenn sie echt sind, immer nur zum Glauben hinführen, aber nie Grund sein, vom Glauben wegzuführen. Wo sie mehr Anlaß zu Streit und Konflikten in der Kirche und unter den Gläubigen sind, scheinen Zweifel angebracht.
Die ganz unterschiedlichen, nicht anerkannten Phänomene wie Medjugorje, Garabandal, Civitavecchia, Schio, Oliveto Citra, Cuapa, Bayside, Heede, Marpingen, St. Leonhard in Kärnten, Ghiaie di Bonate, Placanica, San Damiano Piacentino, Turin, Terni, Malta, Piana del Tauro und viele andere mehr stellen in jedem Fall eine Herausforderung für die Kirche dar. Selbst bei einem abwartenden oder negativen Urteil sind die Hintergründe jedes einzelnen Phänomens zu untersuchen und zu ergründen.
Text: Gertraud Schwaiger
Bild: