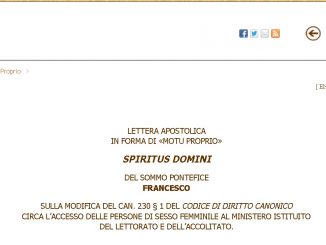(Rom) “Die Revolution von Papst Franziskus bringt die Kirche durcheinander. Doch auch sein sanftmütiger Vorgänger namens Benedikt ist nicht ohne“, so der Vatikanist Sandro Magister. Er befaßt sich mit jüngsten Äußerungen und Gesten zur bisher in der Kirchengeschichte einzigartigen Situation, daß es zwei legitime „Päpste“ in der Form eines regierenden und eines emeritierten Papstes gibt. Magister stellt sich dabei die Frage, ob sowohl Franziskus als auch Benedikt XVI. das Papsttum verändern wollen und, wenn ja, in welche Richtung.
„Der Verzicht auf das Papstamt war nicht seine letzte Handlung“, so Magister über Benedikt XVI. Bereits beim Rückzug vom Stuhl Petri, in jenem denkwürdigen Februar 2013, habe Joseph Ratzinger Wert auf die Feststellung gelegt, daß seine Wahl zum Papst etwas sei, was „für immer“ bleibt“.
Im Gegensatz zu den beiden einzigen, einigermaßen vergleichbaren Amtsverzichten in der Geschichte des Papsttums, jenem von Coelestin V. (1294) und Gregor XII. (1406–1415), trägt Benedikt weiterhin das weiße Gewand des Papstes und unterzeichnet mit „Benedictus XVI Papa emeritus“, während Franziskus nur mit „Franciscus“ unterschreibt. Benedikt führt auch weiterhin das Wappen mit den Petrusschlüsseln, lebt obendrein „im engeren Bereich des heiligen Petrus“ und läßt sich als „Heiligkeit“ und „Heiliger Vater“ ansprechen.
Ein „quasi gemeinsamer Dienst“ von Franziskus und Benedikt XVI.
Jüngst erklärte sein persönlicher Sekretär, Kurienerzbischof Georg Gänswein kryptisch, daß Benedikt „seinen Stuhl geräumt, doch diesen Dienst mit seinem Schritt vom 11. Februar 2013 eben nicht verlassen“ habe. Er habe vielmehr das Papsttum weiterentwickelt, denn: „Seit der Wahl seines Nachfolgers Franziskus am 13. März 2013 gibt es also keine zwei Päpste, aber de facto ein erweitertes Amt – mit einem aktiven und einem kontemplativen Teilhaber.“ Ein „erweitertes Amt“? Gänswein dazu: „Er hat das personale Amt ergänzt um eine kollegiale und synodale Dimension“, so als gäbe es zwischen Franziskus und Benedikt XVI. einen „quasi gemeinsamen Dienst“.
Diese „verblüffenden Aussagen“ von Gänswein, so Magister, fielen am vergangenen 20. Mai im Festsaal der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom anläßlich der Vorstellung des Buches „Oltre la crisi della Chiesa“ (Jenseits der Kirchenkrise) von Roberto Regoli über das Pontifikat von Papst Benedikt XVI.
Die Aussagen lösten gerade unter Bewunderern Ratzingers nicht wenig Bestürzung aus. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Niemand bezweifelt nämlich, daß die Gänswein-Interpretation dem tatsächlichen Denken Benedikts entspricht und von diesem autorisiert wurde. Niemand hätte sich jedoch gerade vom deutschen Papst einen so eklatanten und präzedenzlosen Bruch in der Papstgeschichte erwartet.
Wie kommt es, daß der Privatsekretär erst drei Jahre nach der Wahl eines neuen Papstes eine solche Interpretation von sich gibt? War es nur halbherziger Rücktritt? Ein Widerspruch? Soll lediglich nachträglich eine umstrittene Handlung verklärt werden, weil Benedikt selbst Zweifel hegt, daß er mit seiner Entscheidung dem Petrusamt gerecht geworden ist, oder weil manche den Rücktritt als Flucht vor der Verantwortung oder als letztlich nicht wirklich freie Handlung auslegen, oder wieder andere Benedikt zum Vorwurf machen, daß dieser Verzicht erst das Pontifikat Franziskus möglich machte?
Herrscht „eine Art göttlicher Ausnahmezustand“?
„Viele empfinden diese neue Situation heute immer noch als eine Art göttlichen Ausnahmezustandes“, dem bereits ein „Ausnahmepontifikat“ vorangegangen sei, so Gänswein, worin ihm viele Katholiken beipflichten werden. Was aber meinte er genau damit?
„Die absolute Neuheit ist nicht der Amtsverzicht, sondern das danach“, so Magister.
Als Coelestin V. am 13. Dezember 1294 seinen Amtsverzicht ankündigte, so wird berichtet, „stieg er von der Kathedra herunter, nahm die Tiara von seinem Haupt und legte sie am Boden ab, und den Mantel und den Ring, von allem entledigte er sich vor den erstaunten Kardinälen“. Er wurde wieder ein einfacher Mönch und Einsiedler, der sich in die Abgeschiedenheit zurückzog, aus der man ihn in einem schwierigen Moment für das Papsttum gegen seinen Willen herausgerissen und zum Papst gemacht hatte. Er hatte seinen Widerwillen, das Papstamt zu übernehmen, von Anfang bekundet und ebenso erklärt, auf das Amt ehestmöglich verzichten zu wollen.
Einen solchen Schritt erwartete sich auch der wohl renommierteste katholische Kirchenrechtler, der Jesuit Gianfranco Ghirlanda, als er unmittelbar nach der überraschenden Verzichtsankündigung vom Rosenmontag 2013 in der Civiltà Cattolica einen Artikel veröffentlichte. Ghirlanda nahm an, daß Benedikt natürlich Bischof bleibe, um genau zu sein, „emeritierter Bischof von Rom“, da das Weihesakrament unauslöschlich ist, aber daß er „alle seine Primatsvollmachten verlieren“ werde, „weil ihm diese nicht durch die Bischofsweihe, sondern direkt von Christus durch die Annahme der rechtmäßigen Wahl zukamen“.
„Das tatsächliche Verhalten Ratzingers widersprach dann jedoch dieser natürlichen Ordnung der Dinge“, so Magister.
„Aktive und kontemplative Teilhabe“ an dem einen Petrusdienst
Bald tauchten solche auf, die Benedikts beispielloses Verhalten theoretisch rechtfertigten. Dazu gehört der Kanonist Stefano Violi, der den Standpunkt vertritt, Benedikt XVI. habe keineswegs auf das Petrusamt verzichtet, sondern nur auf die Ausübung der Regierungsgeschäfte und des Lehramtes. Die Ausübung des Gebets und des Mitleidens habe er hingegen beibehalten.
Genau diese Position behauptete nun Gänswein vor einem Monat als Tatsache: Es gebe ein doppeltes Papsttum „mit einem aktiven und einem kontemplativen Teilhaber“ am Petrusamt. Franziskus und Benedikt in einem „quasi gemeinsamen Dienst“?
Was aber heißt das konkret? Ist Benedikt noch immer und, solange er lebt, „für immer“ rechtmäßiger Papst? Ist Franziskus nur geschäftsführender Papst, der im Namen Benedikts den aktiven Petrusdienst ausübt?
Oder ist es letztlich nur eine Banalisierung des Petrusamtes durch Zurückstufung auf ein bürokratisch reglementiertes Kirchenamt wie die anderen auch, mit altersbedingten Pensionierungsfristen und –pflichten? Nur eben nicht mit 75 Jahren wie bei Bischöfen, mit 80 Jahren wie bei Kardinälen, sondern mit 85 Jahren?
„Daß es in der katholischen Kirche zwei Päpste geben könnte, wenn auch mit unterschiedlichem Profil, aber doch mehr als nur einer, ist etwas, was Theologen und Kirchenrechtler von Rang wie Geraldina Boni und Carlo Fontappiਠnicht nur für unerhört, sondern geradezu ‚abnorm‘ halten, abgesehen davon, daß sie darin Vorboten von Konflikten erkennen“, so Magister.
Ideelle Überlegenheit des „kontemplativen“ Papstes über den „aktiven“
Dem nicht genug, denn Violi theoretisiert sogar „die ideelle Überlegenheit des ‚kontemplativen‘ Papstes über den ‚aktiven‘, da dieser dem Vorbild Jesu näher sei, der sich von allem entledigt habe, auch von seiner Göttlichkeit.“
Vor allem aber stimme es einfach nicht, so Magister, daß die Unterscheidung der Rollen zwischen Franziskus und Benedikt so klar sei, wie Gänswein es darstellte.
Benedikt habe mehrfach sein selbstauferlegtes Schweigen gebrochen. In mindestens einem Dutzend Fälle ist er in den vergangenen drei Jahren schriftlich oder mündlich an die Öffentlichkeit getreten. Jedes Mal zwang er damit, zu studieren, was davon mit dem Lehramt des „aktiven“ Papstes übereinstimmt und was nicht.
So nahm Benedikt XVI. beispielsweise zwischen den beiden Bischofssynoden über die Familie seine noch 1972 als Theologe vertretene Position zurück, daß es vielleicht unter bestimmten Bedingungen die Anerkennung einer Zweitehe geben könne. Der emeritierte Papst distanzierte sich von seiner damaligen Aussage, um sich gleichzeitig auch demonstrativ von der Position von Kardinal Walter Kasper zu distanzieren. Für seine „Gesammelten Schriften“ korrigierte er den Aufsatz von 1972 grundlegend und nahm damit bereits im November 2014 eine Kritik am nachsynodalen Schreiben Amoris laetitia vorweg, das Papst Franziskus am vergangenen 8. April veröffentlichen ließ.
„Im Lehramt von Franziskus triumphiert die Zweideutigkeit, aber auch das ‚emeritierte Papsttum‘ von Benedikt ist ein ungelöstes Rätsel“, so Magister.
Text: Settimo Cielo/Giuseppe Nardi
Bild: Urban V./Wikicommons/MiL