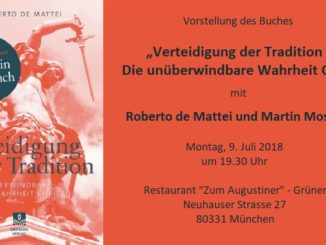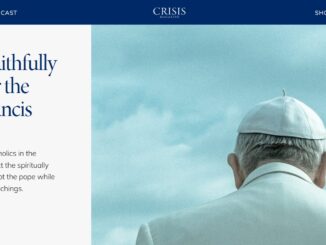von Roberto de Mattei*
Sandro Magister hat mit einem fundierten Artikel die Wunde dokumentiert, die Papst Franziskus der christlichen Ehe mit seinen beiden Motu proprio zugefügt hat, der sich den Anmerkungen von Antonio Socci in der Tageszeitung Libero, von Paolo Pasqualucci auf Chiesa e postconcilio und meiner Stellungnahme auf Corrispondenza Romana anschließt. Das Klima ernster Besorgnis im Vatikan wurde auch durch eine Meldung der Wochenzeitung Die Zeit vom 10. September bestätigt, im Vatikan sei ein Dossier gegen die Änderungen der Ehenichtigkeitsverfahren durch Papst Franziskus in Umlauf.
Damit stellt sich vielen Gewissen ein heikles Problem. Welches Urteil wir auch immer zum Motu proprio haben, es handelt sich um eine persönliche und direkte Regierungsentscheidung des Papstes. Kann aber ein Papst bei der öffentlichen Bekanntmachung von kirchlichen Gesetzen irren? Und ist es im Falle der Mißbilligung nicht dennoch geboten eine Haltung des Schweigens ihm gegenüber einzunehmen? Die Antwort gibt uns die Lehre und die Geschichte der Kirche. Viele Male ist es nämlich geschehen, daß Päpste in ihren politischen, pastoralen und sogar lehramtlichen Handlungen geirrt haben, ohne daß dadurch auf irgendeine Weise das Dogma der Unfehlbarkeit und der römische Primat beeinträchtig worden wären. Der Widerstand der Gläubigen gegen diese irrigen, und in einigen Fällen sogar unrechtmäßigen Handlungen der Päpste hat sich immer wohltuend für das Leben der Kirche ausgewirkt.
Ohne zu weit in der Zeit zurückzugehen, möchte ich ein Ereignis betrachten, das zwei Jahrhunderte zurückliegt. Das Pontifikat von Pius VII. (Gregorio Chiaramonti 1800–1823) wie das seines Vorgängers Pius VI. erlebte Momente schmerzlicher Spannungen und harter Kämpfe zwischen dem Heiligen Stuhl und Napoleon Bonaparte, dem Kaiser der Franzosen.
Pius VII. unterzeichnete am 15. Juli 1801 ein Konkordat mit Napoleon in der Hoffnung, damit die Epoche der Französischen Revolution zu beenden, doch Bonaparte zeigte bald, daß seine wirkliche Absicht hingegen die Bildung einer seiner Macht dienstbar gemachten Nationalkirche war. Am 2. Dezember 1804 krönte sich Napoleon mit seinen eigenen Händen zum Kaiser und wenige Jahre später fiel er erneut in Rom ein und annektierte die Kirchenstaaten an Frankreich. Der Papst wurde gefangengenommen und nach Grenoble, dann nach Savona verschleppt (1809–1812). Der Gegensatz spitzte sich anläßlich der zweiten Ehe des Kaisers zu. Napoleon hatte vor seiner Selbstkrönung die Witwe Joséphine de Beauharnais (geborene Marie Josephe de Tascher) geheiratet. Die angehende Kaiserin warf sich vor Pius VII. auf die Knie und bekannte, daß sie mit Napoleon nur in standesamtlicher Ehe verbunden war. Der Papst ließ Bonaparte daraufhin wissen, daß die Krönung erst nach einer kirchlichen Trauung stattfinden könne. In aller Eile wurde noch in der Nacht die Hochzeit von Kardinal Fesch, dem Onkel Napoleons geschlossen. Josephine schenkte Napoleon jedoch keine Erben und ihre Herkunft war zu bescheiden für jemanden, der ganz Europa beherrschen und sich mit den Herrscherfamilien verwandtschaftlich verbinden wollte. Der Kaiser beschloß daher, die Ehe mit Josephine zu annullieren, um die Erzherzogin und Tochter des bedeutendsten europäischen Monarchen, des letzten römisch-deutschen und ersten österreichischen Kaisers Franz II. (Franz I.), Marie Louise von Österreich, heiraten zu können.
1810 löste ein Senatus Consultum die standesamtliche Ehe von Napoleon mit Josephine auf und gleich danach erklärte das Diözesangericht des Erzbistums Paris die Nichtigkeit der kirchlichen Ehe. Der Heilige Stuhl verweigerte die Anerkennung der Ehenichtigkeitserklärung, da die Pariser Prälaten ein Gefälligkeitsurteil gefaßt hatten. Als der Kaiser am 2. April 1810 die Kapelle des Louvre betrat, um die Zweitehe mit Marie Louise einzugehen, waren die Plätze von 13 Kardinälen, die eingeladen worden waren, leer. Der neue Kaiser behandelte sie wie Rebellen und Staatsfeinde, weil sie durch ihre Geste ihre Überzeugung zum Ausdruck brachten, daß sein Eheband nur durch den Papst gelöst werden konnte. Die Nichtigkeitserklärung seiner Ehe konnte nur durch den Papst ratifiziert werden. Die dreizehn Kardinäle wurden dazu verurteilt, sofort ihre Insignien und Gewänder abzulegen und durften sich nur mehr als einfache Priester kleiden. Daher rührt die Bezeichnung der „schwarzen Kardinäle“ oder „Eiferer“ im Gegensatz zu den „roten“, die Napoleon untertänig waren und seiner neuen Ehe zustimmten.
Pius VII. schwankte zwischen den beiden Richtungen. Doch am 25. Januar 1813 unterzeichnete er, erschöpft von den Kämpfen, ein Abkommen zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Kaiser, mit dem er die Unterschrift unter einige Bedingungen setzte, die mit der katholischen Lehre unvereinbar sind. Das Dokument, bekannt als „Konkordat von Fontainebleau“ (Enchiridion dei Concordati. Due secoli dei rapporti Chiesa-Stato, EDB, Bologna 2003, Nr. 44–55), akzeptierte den Grundsatz der Unterordnung des Heiligen Stuhls unter die Autorität des französischen Staates und legte damit faktisch die Kirche in die Hände des Kaisers. Dieser Akt, in dem der Papst öffentlich als katholisches Kirchenoberhaupt handelte, wurde sofort von den zeitgenössischen Katholiken als Katastrophe betrachtet und als solche wird er auch von den Kirchenhistorikern gesehen. Pater Ilario Rinieri, der den Beziehungen zwischen Pius VII. und Napoleon eine dreibändige Studie widmete, schreibt, daß das Konkordat von Fontainebleau „verheerend sowohl für die Souveränität des römischen Papstes als auch für den Apostolischen Stuhl“ war (Ilario Rinieri: Napoleone e Pio VII – 1804–1813. Relazioni storiche su documenti inediti dell’archivio vaticano, Unione Tipografico-Editrice, Torino 1906, Bd. III, S. 323) mit dem Zusatz: „Wie es dazu kommen konnte, daß sich der Heilige Vater Pius VII. bewegen ließ, ein Abkommen zu unterzeichnen, das so verheerende Bedingungen enthielt, ist eines jener Phänomene, deren Erklärung den Anspruch der Geschichte übersteigt“ (ibd. S. 325).
„Man kann nicht den unglücklichen Eindruck und den negativen Effekt beschreiben, den die Veröffentlichung dieses Konkordats nach sich zog“, erinnerte sich Kardinal Bartolomeo Pacca (1756–1844) in seinen Historischen Erinnerungen (Memorie storiche, Ghiringhello e Vaccarino, Roma 1836, Bd. 1, S. 190). Es fehlten nicht jene, die das Konkordat mit Begeisterung aufnahmen und auch nicht jene, die es zwar hinter vorgehaltener Hand kritisierten, aber nicht wagten, es öffentlich zu tun, aus Unterwürfigkeit oder weil sie eine schlechte theologische Lehre vertraten. Kardinal Pacca, Pro-Staatssekretär von Pius VII. gehörte hingegen zu jener Gruppe von Kardinälen, die, nachdem sie vergeblich versucht hatten den Papst davon abzuhalten, das Dokument zu unterschreiben, erklärten, daß „es keinen anderen Weg gebe, um das Ärgernis und die schwerwiegenden Übel, die eine Umsetzung dieses Konkordats der Katholizität und der Kirche zufügen würde, als einen sofortigen Widerruf und eine generelle Annullierung des Ganzen durch den Papst und fügten das bekannte Beispiel in der Kirchengeschichte von Paschalis II. hinzu (Memorie storiche, Bd. 2, S. 88).
Der Widerruf erfolgte. Angesichts der Hartnäckigkeit der „eifrigen“ Kardinäle, wurde sich Pius VII. mit großer Demut seines Irrtums bewußt. Am 24. März unterzeichnete er ein Schreiben an Napoleon, in dem folgende Worte zu lesen sind: „Von diesem Blatt, obwohl von uns unterschrieben, sagen wir Eurer Majestät dasselbe, was unser Vorgänger Paschalis II. in einem vergleichbaren Fall von einem von ihm unterzeichneten Schreiben sagte, das ein Zugeständnis zugunsten von Heinrich V. enthielt, das sein Gewissen aus gutem Grund bereute, nämlich: ‚so wie wir jenes Schreiben als schlecht erkennen, so bekennen wir unser schlechtes Handeln, und mit der Hilfe des Herrn wünschen wir, daß es umgehend berichtigt wird, damit der Kirche kein Schaden entsteht und auch nicht unserer Seele“ (Enchiridion dei Concordati. Due secoli dei rapporti Chiesa-Stato, EDB, Bologna 2003, Nr. 45, S. 16–21).
In Italien wurde der Widerruf des Papstes nicht sofort bekannt, sondern nur die Unterzeichnung des Konkordats. Deshalb verfaßte der ehrwürdige Diener Gottes Pio Brunone Lanteri (1759–1830), der die Bewegung der Katholischen Freundschaften (Amicizie Cattoliche) leitete, umgehend ein Dokument entschiedener Kritik an der päpstlichen Handlung. Unter anderem schrieb er: „Man wird mir sagen, daß der Heilige Vater alles kann, ’quodcumque solveris, quodcumque ligaveris etc.’, doch er kann nichts gegen die göttliche Konstitution der Kirche. Er ist der Stellvertreter Gottes, aber er ist weder Gott noch kann er das Werk Gottes zerstören“ (Scritti e documenti d’Archivio, Bd. II: Polemici-Apologetici, Edizione Lanteri, Roma-Fermo 2002, S. 1019–1037, hier S. 1024). Der ehrwürdige Diener Gottes, ein entschiedener Verteidiger der Rechte des Papsttums, gestand die Möglichkeit zu, dem Papst im Falle eines Irrtums zu widerstehen, weil er wußte, daß der Papst zwar die höchste Macht hat, aber keine unbegrenzte und willkürliche Macht. Der Papst, wie jeder Gläubige, muß das natürliche und das göttliche Gesetz respektieren, dessen Bewahrer er durch göttlichen Auftrag ist. Er kann weder die Regeln des Glaubens noch die göttliche Verfassung der Kirche (zum Beispiel die Sieben Sakramente) verändern, ebensowenig wie ein weltlicher Souverän nicht die Grundgesetze seines Reichs ändern kann, weil man, wie der französische Bischof und Geschichtsphilosoph Jacques-Benigne Bousset (1627–1704) erinnert, durch deren Verletzung „alle Grundfesten der Erde wanken.“ (Psalm 82,5) (Jacques-Benigne Bossuet, Politique tirée des propres paroles de l’Ecriture Sainte, Droz, Genf 1967, Erstveröffentlichung 1709, S. 28).
Niemand könnte Kardinal Pacca eine überzogene Sprache vorwerfen oder Pio Brunone Lanteri mangelnde Anhänglichkeit dem Papsttum gegenüber. Die Konkordate, wie die Motuproprien, die apostolischen Konstitutionen, die Enzykliken, die Bullen, die Breven sind legislative Akte, die den päpstlichen Willen zum Ausdruck bringen, aber nicht unfehlbar sind, außer der Papst beabsichtigt mit ihrer Verkündigung Punkte des Glaubens oder der Moral auf eine für alle Katholiken verbindliche Weise zu definieren (vgl. Raoul Naz, Lois ecclésiastique, in Dictionnaire de Théologie catholique, Bd. VI, Sp. 635–677).
Das Motu proprio von Papst Franziskus über die Ehenichtigkeitserklärungen ist ein Regierungsakt, über den diskutiert werden und der durch einen späteren Regierungsakt wieder aufgehoben werden kann. Das Motu proprio Summorum Pontificum von Benedikt XVI. vom 7. Juli 2007 über die überlieferte Liturgie wurde diskutiert und hart kritisiert (s. z.B. das Streitgespräch Andrea Grillo-Pietro De Marco: Ecclesia universa o introversa. Dibattito sul motu proprio Summorum Pontificum, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2013).
Das Motu proprio von Papst Franziskus, das bisher seine revolutionärste Amtshandlung war, ist bis zum 8. Dezember 2015 noch nicht in Kraft. Ist es illegitim zu fordern, daß die Synode über diese Ehereform diskutiert und daß eine Gruppe „eifriger“ Kardinäle seine Aufhebung fordert?
*Roberto de Mattei, Historiker, Vater von fünf Kindern, Professor für Neuere Geschichte und Geschichte des Christentums an der Europäischen Universität Rom, Vorsitzender der Stiftung Lepanto, Schriftleiter der Monatszeitschrift Radici Cristiane und der Online-Nachrichtenagentur Corrispondenza Romana, Autor zahlreicher Bücher, zuletzt erschienen: Vicario di Cristo. Il primato di Pietro tra normalità ed eccezione (Stellvertreter Christi. Der Primat des Petrus zwischen Normalität und Ausnahme), Verona 2013; in deutscher Übersetzung zuletzt: Das Zweite Vatikanische Konzil – eine bislang ungeschriebene Geschichte, Ruppichteroth 2011.
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Corrispondenza Romana