
(Rom) Der bekannte Historiker Roberto de Mattei befaßt sich in seinem jüngsten Aufsatz mit der Frage nach dem rechten Verhältnis von Zweck und Mittel. Ein Verhältnis, zu dem auch unter Katholiken heute große Verwirrung herrsche. Er geht dabei auf das richtige Verständnis des Papsttums ein. Angesichts jüngster Entwicklungen sieht der traditionsverbundene Intellektuelle die Notwendigkeit zu einer Präzisierung. Dabei behandelt er die Frage nach dem wahren Gehorsam, den jeder Katholik dem Papst schulde. Ein Gehorsam, der nicht der Person des Papstes gelte, sondern Christus, dessen Vertreter der Papst auf Erden ist. Dem Papst sei immer Respekt geschuldet, aber kein Gehorsam, wenn er vom Willen Gottes, der im Naturrecht, im göttlichen Gesetz und in der Tradition der Kirche Ausdruck findet, abweichen sollte. Vielmehr sei ihm dann respektvoller, aber entschiedener Widerstand zu leisten. Die Zwischentitel wurden von der Redaktion gewählt.
Der Zweck und die Mittel
von Roberto de Mattei
In der aus dem Gleichgewicht geratenen Welt, in der wir leben, entstehen viele Verhaltensfehler aus der Verwirrung der Ideen und Begriffe. Eines der größten Mißverständnisse betrifft das Verhältnis zwischen Zweck und Mittel menschlichen Handelns. Dabei geht es grundlegend darum, warum für einen Katholiken, mag der Zweck auch noch so gut sein, der Einsatz von unerlaubten Mitteln zu dessen Erreichung nicht gestattet ist.
Man kann nicht das Böse tun, um das Gute zu erreichen. Die Achtung und Einhaltung des moralischen Gesetzes muß absolut sein und duldet keine Ausnahmen. Es gibt im christlichen Leben jedoch einen weiteren Grundsatz, wonach die Mittel, so edel und erhaben sie auch sein mögen, nie über dem Zweck stehen, sondern diesem immer untergeordnet sein müssen. Andernfalls würde es zu einer Umkehrung der Werte zwischen Zweck und Mitteln kommen.
Eigentlicher und letzter Zweck des menschlichen Daseins ist die Verherrlichung Gottes
Der Zweck menschlichen Handelns kann vielfältig sein und noch zahlreicher die Mittel zu seiner Erreichung. Es gibt jedoch einen letzten Zweck, von dem alle anderen abhängen. Dieser Zweck ist Gott, Urgrund und Endpunkt jeglicher Existenz, von dem alles kommt und zu dem alles zurückkehrt: „das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende“, wie die Offenbarung (22,13) enthüllt. Die Ehre Gottes ist das einzige Ziel aller Dinge und auch ihr einziges Gut.
Dom François Pollien (1853–1936) erinnert daran, daß Himmel und Erde, Engel und Menschen, Kirche und Gesellschaft, Gnade und Sakramente, Tiere und Pflanzen, Handeln und Kraft der Wesen, historische und kosmische Ereignisse, da Geschöpfe, als Instrumente und nichts anderes als Instrumente zu betrachten sind, als Mittel mit Blick auf den letzten Zweck: die Verherrlichung Gottes, mit der untrennbar unser Glück gekoppelt ist. Das gilt für jedes Geschöpf, und sei es das höchste.
Auch der Papst als Edelstes der Geschöpfe ist Instrument und nicht Zweck
Selbst die Person des Papstes, als Stellvertreter Christi auf Erden das Edelste der Geschöpfe, ist Instrument und nicht Zweck und als solches muß es zum Einsatz kommen, wenn wir das Verhältnis zwischen Mittel und Zweck nicht verkehren wollen. Das zu betonen ist wichtig, gerade in einem Moment, in dem vor allem unter frommen Katholiken viel Verwirrung in diesem Zusammenhang herrscht. Der Katechismus lehrt uns, daß man dem Papst zu gehorchen hat, weil Gehorsam eine moralische Tugend ist, die uns an den Willen des Vorgesetzten bindet, und unter allen Autoritäten der Erde gibt es keine höhere als den Papst. Aber auch der Gehorsam dem Papst gegenüber ist ein Instrument und nicht ein Zweck.
Der Gehorsam in der Kirche bedeutet für den Untergebenen immer die Pflicht, nicht den Willen des Vorgesetzten zu erfüllen, sondern einzig und allein den Willen Gottes. Daher ist der Gehorsam nie ein blinder oder bedingungsloser Gehorsam. Er hat seine Grenzen im Willen Gottes, der im Naturrecht und im Gottesrecht sowie in der Tradition der Kirche zum Ausdruck kommt, deren Bewahrer und nicht Urheber der Papst ist.
Die heute so weitverbreitete Tendenz, jedes Wort und Verhalten des Papstes in den Rang der Unfehlbarkeit zu erheben, entspringt einer historistischen und immanentistischen Mentalität, die das Göttliche in den Menschen und in der Geschichte sucht und die unfähig ist, die Menschen und die Geschichte im Licht jenes Natur- und Gottesrechts zu beurteilen, das der direkte Reflex Gottes ist. Die Kirche Christi, die die Geschichte übersteigt, wird ersetzt durch die modernistische, die eingetaucht in die Geschichte lebt. Das ewige Lehramt wird durch das „lebendige“ ersetzt, das in einer gefühlsbetonten und vagen pastoralen Lehre zum Ausdruck kommt, die sich jeden Tag verändert und ihre regula fidei im Subjekt der Autorität und nicht im Objekt der vermittelten Wahrheit hat.
Tendenz jeder Geste des Papstes „Unfehlbarkeit“ zuzuschreiben – Gefahr der Papolatrie
Es verfehlt sich, wer gegenüber dem Papst sarkastische und respektlose Worte gebraucht. Die gebührende Ehrerbietung, die dem Stellvertreter Christi zukommt, gilt aber nicht dem Menschen, sondern dem, den er vertritt. Dem Menschen als solchen kann man, in Ausnahmefällen, sogar widerstehen. Die treuen Katholiken rühmten sich sogar der Bezeichnungen Papisten und Ultramontane, die ihnen von den Feinden der Kirche abschätzig verpaßt wurden. Aber kein wirklicher Katholik ist je einer Papolatrie verfallen, die in einer Art von Vergöttlichung des Vikars Christi besteht, die so weit geht, dadurch Christus selbst zu ersetzen. Die Papolatrie ist Ausdruck einer Verwechslung der Mittel mit dem Zweck und ist ein psychologisches Verhalten, dem ein doktrinärer Irrtum zugrunde liegt.
Der Theologe aus dem Passionistenorden Enrico Zoffoli (1915–1996) erinnert uns in seinem Buch Potere e obbedienze nella Chiesa (Macht und Gehorsam in der Kirche, Rom 1996), daß Petrus, der erste Stellvertreter Christi, seiner Pflicht nicht nachkam, nicht etwa weil er die Wahrheit verraten hätte, aber weil er es zuließ, daß die Gläubigen im Zweifel blieben und daher in der Verwirrung. Paulus aber wagte es, ihn öffentlich zu ermahnen („Als Kephas aber nach Antiochia gekommen war, bin ich ihm offen entgegengetreten, weil er sich ins Unrecht gesetzt hatte“, Galater 2,11), weil die Pflicht recht zu wandeln entsprechend der Wahrheit des Evangeliums (Galater 2,14) wichtiger ist, als gehorchen und schweigen.
Autorität des Papstes endet, wo sie sich gegen die Wahrheit richtet oder sie nicht ausreichend verteidigt
Die menschliche Autorität endet, wo sie ihre Grenzen überschreitet und die Wahrheit beleidigt oder die Wahrheit nicht in ausreichender Form verteidigt, auf daß sie nicht verraten werde. „Man muß Gott mehr gehorchen als den Menschen“ (Apostelgeschichte 5,29), hatte Petrus selbst vor dem Sanhedrin in Jerusalem erklärt. Auch der Heilige Thomas von Aquin, im Zusammenhang mit dem Verhalten des Petrus einer Meinung mit dem Heiligen Augustinus, ist der Meinung, daß man aus Furcht vor einem Skandal nicht auf die Wahrheit verzichten darf: „Veritas numquam dimittenda est propter timorem scandali“ (Super epistolam B. Pauli ad Galatas 2, 11–14, lect. 3, n. 80). Gegen den Gehorsam kann man sich durch Übertreibung verfehlen, indem man rechtswidrigen Dingen gehorcht, oder durch Mangel, indem man den rechtmäßigen Dingen nicht gehorcht.
Angesichts eines ungerechten Befehls, der nur unsere Person schädigt, verhält man sich sogar heldenhaft, wenn man gehorcht; wenn der Befehl jedoch das Natur- und Gottesrecht und damit Allgemeinwohl schädigt, findet das Heldentum seinen Ausdruck im Widerstand: gehorchen wäre dann nämlich reiner Servilismus. Man darf in dieser Hinsicht keine Furcht haben. Pater Enrico Zoffoli erinnert daran, daß keine Zensur – und sei es sogar die päpstliche – irgendeinen Wert hat, wenn sie auf objektiv falschen Motiven beruht oder nicht den Bereich des Glaubens oder der Sitten betrifft. Tatsächlich besagt das Kirchenrecht: „Niemand wird bestraft, es sei denn, die von ihm begangene äußere Verletzung von Gesetz oder Verwaltungsbefehl ist wegen Vorsatz oder Fahrlässigkeit schwerwiegend zurechenbar“ (Can. 1321).
Das Kriterium nach dem der Gläubige einem ungerechten Befehl der höchsten kirchlichen Autorität widerstehen kann, gründet nicht auf den freien Willen, dem das Prinzip der Unabhängigkeit der menschlichen Vernunft von jeder Autorität zugrunde liegt, sondern auf dem sensus fidei, der jedem Getauften gemeinsam ist, oder anders gesagt, auf jenem Glauben, der aus jedem Katholiken im Dienst für die Wahrheit einen freien Menschen macht. Wenn ein Papst zum Beispiel das gemeinsame Gebet mit den Moslems einführen, den überlieferten Römischen Ritus abschaffen oder den Priesterzölibat aufheben wollte, dann wäre ein respektvoller aber entschlossener Widerstand nötig. Der sensus fidei würde sich widersetzen. Allerdings je stärker der Widerstand wäre, um so mehr müßte er stets von einer erneuerten Liebe zum Papsttum, zur Kirche und zu ihrem Stifter Jesus Christus begleitet werden.
In Momenten der Verwirrung Blick auf Christus und Maria richten
Zwischen Gott und den Geschöpfen gibt es eine unerschöpfliche Fülle von Vermittlung, mit Hilfe derer die Kreaturen leichter ihren Zweck erreichen können. Nach Jesus Christus, Gottes Sohn und selbst Gott, nach dem alles gestaltet ist, gibt es nur eine perfekte Vermittlung, jene der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, Miterlöserin und Mittlerin aller Gnaden, die ohne Erbsünde Gezeugte und daher frei von jeder Sünde und jedem Irrtum. Die Gottesmutter, bevorzugte Tochter des Vaters, Mutter des Sohnes, Braut des Heiligen Geistes wird von den Theologen als complementum Trinitatis gesehen. Sie und nur Sie, ist nach Jesus Christus die perfekte Mittlerin.
In Momenten des Zweifels, der Verwirrung, der Verdunkelung erhebt der Christ seine Augen zu seinem Ziel und gibt sich voll Vertrauen dem vorzüglichsten aller Mittel, dem einzigen unfehlbaren Mittel zur Erreichung seines Ziels: der seligen Jungfrau Maria, jener, die allein in der Nacht auf den Karsamstag nicht schwankte, als die Apostel flohen, während sie den Glauben der entstehenden Kirche in sich zusammenfaßte.
Text: Corrispondenza Romana
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Corrispondenza Romana


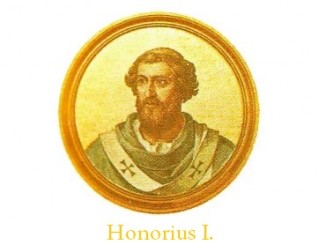

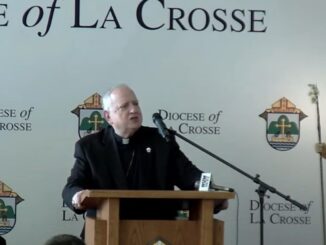
Sehr guter Beitrag, welcher genau unsere jetzige Situation anspricht. Ich befürchte, dass es unter diesem Papst noch einige Male zu solchen Aufständen kommen muss! Beten wir dafür, dass Papst Franz es nicht soweit kommen lässt..
Herzlichen Dank für diese sehr wichtige Klarstellung. Roberto de Mattei scheint weit und breit einer der ganz wenigen Intellektuellen zu sein, die angesichts der neuen kirchlichen Situation nicht in Schockstarre, Schweigen oder schlimmstenfalls in servilem Jubel verharren. Ein besonders wichtiger Passus für alle, die Verantwortung für die Angehörigen religiöser Gemeinschaften tragen: „Angesichts eines ungerechten Befehls, der nur unsere Person schädigt, verhält man sich sogar heldenhaft, wenn man gehorcht; wenn der Befehl jedoch das Natur- und Gottesrecht und damit Allgemeinwohl schädigt, findet das Heldentum seinen Ausdruck im Widerstand.“
Unterm Strich kann man zusammenfassend sagen, dass der werte Herr Professor und Dom François Pollien, den er hier bemüht, die Meinung vertreten, jeder Mensch sei ein Mittel zum Zweck, und nichts mehr.
Wer war noch gleich derjenige, dessen Vater – laut christlichem Glauben – den Menschen die Würde eines Menschen verleiht (anstatt eines Mittels) und die Menschen erinnert, dass sie zur Freiheit berufen sich, sich zu entscheiden, wie sie leben wollen würden, da er ihnen vertraut, zu ihm zu finden? Oh, es war Jesus.
Ob man sich selbst als Mittel oder als Mensch begreifen möchte, ist zwar nicht das Thema der Diskussion, aber beeinflusst meine persönliche Meinung zu Herrn de Mattei recht grundlegend.
Es ist – erstens – hier nicht die Rede davon, dass ein Mensch „Mittel zum Zweck“, sondern das Amt ist „Mittel“, das dieser Mensch ausübt. Es ist – zweitens ‑aber, der Mensch von Gott geschaffen und damit alles was der Mensch ist und besitzt nicht „Eigentum“ des Menschen, sondern das Eigentum Gottes und der Mensch nur sein Verwalter. Sinn und Zweck des menschlichen Lebens ist die Gemeinschaft mit Gott, die ihre Erfüllung in der Ewigkeit findet. Am Ende jedes menschlichen Lebens gibt es entweder die Rettung zu dieser Erfüllung oder ein Scheitern. Dazwischen gibt es nichts. Es gibt nämlich nichts außerhalb Gottes. Was Ihre Einschätzung Jesu angeht, würde ich mich noch einmal genauer mit den biblischen Texten beschäftigen: Da ist die Rede vom „schmalen Weg“, vom fehlenden „Hochzeitsgewand“, von fehlendem „Lampenöl“ u.a. Die Warnung vom Verpassen der Chance sein Leben zu retten ist sehr oft die Rede. Die Freiheit die Jesus meint, ist eben keine Freiheit von Zwängen, sondern eine Freiheit, die aus der erkannten Wahrheit entsteht, und vor fatalen Fehlentscheidungen beschützt. Diese Freiheit ist nur durch das Geschenk der Gnade gegeben, das man aber annehmen und bewahren muss.
Es ist nicht nur die Rede davon, es steht wörtlich im Text.
“ da Geschöpfe, als Instrumente und nichts anderes als Instrumente zu betrachten sind, als Mittel mit Blick auf den letzten Zweck: die Verherrlichung Gottes, mit der untrennbar unser Glück gekoppelt ist. Das gilt für jedes Geschöpf, und sei es das Höchste.“
Die Betrachtung jedes Menschen als ‚Instrument‘ ist schon fernab jedes christlichen Verständnisses, aber der Text geht noch darüber hinaus.
Nein, Gott hat nicht jeden Menschen so geformt, dass Anbetung sein ‚finaler Zweck‘ sei – hätte er dies gewollt, würde es keinen Sinn machen, dem Menschen Freiheit zu schenken, auf dass er selbst den Weg zum Vater zurück einschlage. Es geht nicht um den Zweck eines Menschen, sondern darum, ob wir die Einladung Gottes als Ziel unseres Lebens erkennen und mit frohem Herzen annehmen.
Jeder Mensch muss für sich selbst entscheiden, welchen Weg er in seinem Leben einschlagen möchte – das ist in keinster Weise ein Widerspruch dazu, dass der Weg zu Gott, wie er uns gelehrt hat, ein sehr Schmaler ist.
Ihnen kann ich nur raten, den Artikel noch mal sorgsam zu lesen und sich in ein paar philosophische Grundbegriffe (Aristoteles, Thomas von Aquin) einführen zu lassen.
Mit „Instrument“ ist hier nicht gemeint, was man heute unter „Mittel zum Zweck“ versteht. Vielleicht hilft es Ihnen, wenn man es so erklärt:
Mein Dasein erfüllt seinen Sinn vollkommen dann, wenn es sein Ziel (Telos/finis) erreicht. Dieser Zweck/dieses Ziel ist Gott. Alles, was man erfülltes Leben nennen kann, besteht in der Hingabe, der Hingeordnetheit auf diesen Zweck.
Das lehrt uns schon alleine die Vernunft und das Naturrecht: meine biologische Verfasstheit ist dann zu ihrem Ziel gekommen, wenn ich mein Mann- oder Frausein annehme und darin auch Frucht bringe. Alles andere wird mich auf Dauer einsam und unerfüllt zurücklassen. Der tiefste Sinn meines Daseins ist die selige Anschauung Gottes. In ihr bin ich ganz mit IHM vereint.
Menschenwürde ist kein christlicher Begriff. Christlich gesprochen haben wir die Personwürde als imago Dei. Es geht dabei nicht um Freiheit im Sinne der „Selbstbestimmung“, sondern um die Restauration des gefallenen Menschen hin zu dem, wofür der Mensch geschaffen ist: zur Freiheit, IHN ungetrübt anzubeten, in IHM erst das zu werden, was potentiell in einem angelegt ist vom Schöpfer, Freihit, die allein in IHM den Namen Freiheit verdient. Nur ER, der mich geschaffen hat, weiß wirklich, als was ER mich gedacht hatte. IHN bestimmen zu lassen ist die Klugheit dessen, der sich selbst so will, wie Gott ihn will.
Jesus „vertraut“ uns daher nicht, „zu ihm zu finden“, wie Sie meinen, sondern ER ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das jedenfalls bezeugt die Hl. Schrift.
Ihr Problem ist, dass Sie die säkularen Begrifflichkeiten der aufklärerischen Philosophie, die die Theologie total verunklart und verzweideutigt hat, für christlich halten.
Prof. de Mattei aber benutzt den korrekten Begriff, wie er von alters her innerhalb der Kirche verwendet wird.
Also Schritt 1 zum besseren Verstehen: Informieren Sie sich über die Begriffe „Zweck“, „Mittel“ in der Philosophie, v.a. in der scholastischen Philosophie. Es lohnt sich.
Danke.
Vielen Dank an Herrn de Mattei und an die Redaktion, dass Sie diesen Artikel geschrieben bzw. veröffentlicht haben!
Das klärt wirklich so manche Fragen und so manchen Streit, die auch hier im Forum aufgekommen sind.
Nach 50 Jahren Einübung des „Menschen in den Mittelpunkt-Stellens“ – als der angeblich wahren Froh-Botschaft – haben wir verlernt, im Papst einen wirklich nur amtlichen Stellvertreter Christi zu sehen, dessen Person vollkommen verblassen müsste vor der Überordnung Jesu Christi. Päpste wie Benedikt, die wenigstens darum bemüht waren, diese Objektivität der eigenen Person unterzuordnen, wurden nicht anerkannt und von den Bischöfen boykottiert. Selbst Paul VI. – solange er machte, was er dachte, ehrte man ihn, als er aber in Humanae vitae nicht umhin konnte, die objektive Lehre zu entfalten (was jeder unschwer aufgrund der Vernunft, die nur dann als Vernunft zu bezeichnen ist, wenn sie das Naturrecht, die Hl. Schrift und die Lehre der Kirche respektiert, erkennen kann!), kündigten ihm wieder die Bischöfe den Gehorsam auf. Was heißt ihm – sie kündigten hier dem Herrn selbst den Gehorsam auf. Wo es galt, dem irrenden Menschen Montini zu gehorchen, waren sie beflissen dabei…
Franziskus nun lehrt objektiv nicht das, was die Kirche immer gelehrt hat – er predigt ein widersprüchliches Sammelsurium, das für jeden ein bisschen was zum „Hier-fühl-ich-mich-wohl“-Singen bereithält. Und was geschieht: die Nicht-Glaubenden jubeln und die Glaubenden auch, egal, ob das ein EB Zollitsch ist oder ein Konservativer wie Herr Schwibach, ob die Zenit-Website oder die Anhängerschaft der FSSP. In all seiner Unklarheit und seinen widersprüchlichen Andeutungen dient er für jedermann als perfekte narzisstische Spiegelfläche. Man hält ihm, weil man ihn persönlich anhimmelt, alles zugute, was offen zutage tritt, ja für jeden vernünftigen Menschen ohne Not erkennbar ist, auch für den Ungläubigen. Wir Katholiken sind es, die im Papst nicht mehr Jesus sehen wollen, den objektiven Jesus, sondern wir haben nun einen Papst, in dem wir uns spiegelnd wohlfühlen können, einer, der uns endlich ohne Vorbehalte unseren Narzissmus befriedigt. Plötzlich ist relevant, welche Klamotten er trägt, welche Schuhfarbe, wie er geschaut hat, was er isst und ob er nett ist. Ob er jemandem ein Briefchen geschickt hat oder Scalfari umarmt hat.
Nicht dass mich jemand missversteht: Das alles ist nicht abzuwerten – aber es hat nichts mit dem objektiven, unfehlbaren Lehramt zu tun. Der Schmeichelkurs wird aufhören. Niemand lasse sich blenden.
Wie kommt es, dass wir alle kaum ertragen, wenn jemand kritisch an diesem Idol kratzt, wenn jemand ihn an seinen Worten misst und an der wahren Lehre? Plötzlich verlegen sich die Debatten auf die Metaebene, ob das wohl alles richtig übersetzt ist, ob man ihn nur nicht verstehen will, als ob für ihn nicht gälte, dass A=A und B=B, 1+1=2 und A=nonA falsch ist!
Suchen wir nach der wahren Lehre, fragen wir das reine Lehramt: MARIA.
Beten wir für die Umkehr
..sorry… es muss heißen in Zeile 6 „Päpste wie Benedikt, die (..) bemüht waren, diese Objektivität der eigenen Person ü b e r z u o r d n e n“
ZS: Vielen Dank !
Ubi Petrus, ibi Ecclesia. Basta.
Lesen Sie noch mal ganz genau den Artikel und schlagen Sie ihnen unverständliche Dinge nach.
Sonst könnte Sie sich leicht als einer der hunderte Millionen von Katholiken wiederfinden, die bei der völlig unkritischen Nachfolge der letzten vier Päpste ohne es zu merken Protestanten geworden sind oder ganz den wahren Glauben verloren haben.
@Nikolaus Barabas. Ihr Einwand ist nur bedingt passend. Denn wenn ein Papst eine Häresie lehren und verkünden würde, darf man ihm nicht folgen. Dem Nachfolger Petri ist die Unfehlbarkeit nur insoweit gegen, wenn er eine Lehre die schon immer geglaubt und verkündet wurde als von Gott geoffenbarte Wahrheit verkündet. Privatmeinungen und Äußerungen eines Papstes sind nicht unfehlbar. Wollen Sie etwa behaupten, wenn der Papst jetzt sagen würde, die katholische Kirche sei nicht von Gott gegründet und es müsste auch niemand mehr missionieren. Das wir dann dem Papst folgen müssen????? Letztendlich muss man Gott mehr gehorchen als den Menschen und wenn ein Papst Dinge verlangt, die im Gegensatz zur geoffenbarten Glaubens- und Sittenlehre stehen, dürfen wir ihm gar nicht folgen.
Es muss natürlich heißen: Dem Nachfolger Petri ist die Unfehlbarkeit insoweit gegeben.….
„Basta“ bedeutet: „es genügt“.
Aber genügt es wirklich?
Es gibt verschiedene Abwandlungen dieses Satzes.
Der älteste Satz dürfte vom hl. Märtyrer Ignatius von Antiochien (1.–2. Jh.) sein, der, so eine Überlieferung, jenes Kind war, das Jesus in den Arm nahm, als er sagte: Lasset die Kinder zu mir kommen, und der im hohen Alter von den Löwen im Kolosseum zerrissen wurde. Ignatius nun schrieb: „Ubi Christus, ibi ecclesia.“
Eine spätere Abwandlung ist das Wort, das dem hl. Cyprian (3. Jh.) zugeschrieben wird: „Ubi episcopus, ibi ecclesia, ubi ecclesia, ibi episcopus“.
Die Formulierung „Ubi Petrus, ibi ecclesia“ hingegen stammt erst vom hl. Ambrosius (4. Jh.).
Heißt es nicht „Ubi episcopus ibi ecclesia“?
O, ich sehe gerade, Leo Lämmlein hat dazu schon was gesagt…
Sehr interessanter Artikel. Gestehe allerdings, dass ich nicht verstehe, weshalb auch eine Abschaffung des überlieferten römischen Ritus und des Priesterzölibats vom Widerstandsrecht umfasst sein sollen. Insbesondere beim Priesterzölibat, den ich beibehalten wissen möchte, verstehe ich bei einer gegenteiligen Entscheidung des Papstes das Widerstandsrecht nicht. Klar kann man auch dann seine abweichende Meinung haben und auch äußern. Aber Widerstand? Kann mich hier jemand aufklären?
Ihr Argument basiert auf der demokratischen Vorstellung, dass ich, trotz abweicehnder Meinung, einen Mehrheitsentscheid oder einen autoritären Akt mittragen muss. So ist die Demokratie konstruiert – undd amit diktatorisch. Autorität in der Kirche hat eine andere Struktur, auch wenn sie „absolutistisch“ wirkt – wirkt! aber nicht ist!
R. de Mattei geht es nicht um „abweichende Meinungen“, die in der Autonomie des Gewissens wurzeln, sondern um den sensus fidei (der absolut zu unterscheiden ist von dem von Progressisten ständig bemühten „sensus fidelium“!), der einer ungerechten und falschen Entscheidung des Papstes widerstehen muss.
Der sensus fidei („Glaubenssinn“) ist das Wissen um den rechten Glauben in jedem echten Gläubigen.
Wenn die Messordnung regelrecht verboten würde, die so im wesentlichen immer galt, zumal es ja das Schreiben „Summorum pontificum“ gibt, würde der Papst sich in Gegensatz zur Tradition der Kirche stellen. Und das sagt jedem Gläubigen der unfehlbare sensus fidei, dass das nicht sein kann. Was 2000 Jahre galt, kann nicht plötzlich falsch sein.
Beim Priesterzölibat geht es darum, dass die Tendenz zur zölibatären Lebensweise der Priester von Anfang an – mit Jesus und dem Hl. paulus ausdrücklich, wahrscheinlich aber viel mehr Aposteln – gegeben war und in der Hl. Schrift auch ausdrücklich empfohlen wird.
Eine Kirche, die plötzlich in die andere Richtung zieht, also einen geistlichen „Rückschritt“ vollzöge, würde den Glaubenssinn der Gläubigen erheblich verletzen. Dagegen spricht auch nicht, dass manche Kirchen den Zölibat für Priester noch nicht ganz konsequnet entfaltet haben.
Das geistliche Problem besteht darin, dass ich oder auch die ganze Kirche, die einmal etwas erkannt hat, nur unter Beleidigung des Hl. Geistes wieder zurücksetzen kann. Diese Sünde ist die schwerste mögliche Sünde.
Tut der Papst so etwas, muss ihm niemand in die Hölle folgen dadurch, dass er oder sie stillschweigend die Zähne zusammenbeißt und damit – - zustimmt!
Da kann ich Ihnen nur beipflichten.
Dieser Tage las ich in einer Meldung, Georg Ratzinger habe die völlige Einigkeit betont, die zwischen Papst em. Benedikt und S.H. Franziskus bestehe. Da habe ich mich gefragt: Weiß Benedikt überhaupt, was Fr. sagt, schreibt und tut?
Heute nun war zu hören, Benedikt habe im Gespräch mit Besuchern das Verbot gegen die Franziskaner der Immakulata als einen Verstoß gegen das Motuproprio ‚Summorum pontificum‘ bezeichnet. Deo gratias!
Die Überlegungen von Roberto de Mattei kommen zur rechten Den Betreibern dieses Forums bin , dass sie die Erörterung der Problematik zulassen, und übrigens auch Ihnen für Ihre trefflichen Analysen.
Die Dinge in Welt und Kirche gehen nicht im gleichen Tempo weiter. Eine Beschleunigung ist spür- und feststellbar, und mit unerwarteten, sich überstürzenden Veränderungen (im Verborgenen sorgfältig vorbereitet) ist zu rechnen, buchstäblich von einem Tag auf den andern.
Innerkirchlich finden seit der Regentschaft von SH Fr. Veränderungen statt, deren Tragweite nur von einer Minderheit mit empfindlichem sensus fidelium wahrgenommen wird. Es sind raffinierte, aber entscheidende „Kleinigkeiten“, wie die Verweigerung der Kniebeuge vor dem Allerheiligsten, die von Fr. ausging und in der ganzen Kirche um sich greift.
(Kaum jemand auch hat an der schrecklichen Figur des hl. Erzengels Michael in den vatikanischen Gärten Anstoß genommen.)
Blicken wir aufmerksam auf die bevorstehende Marienweihe, und sehen wir genau hin, was da im Detail tatsächlich ablaufen wird.
Ich bitte um Entschuldigung für die Satzbrüche, die ich zu spät bemerkt habe. (Ein Streich, den ich mir von der Funktion strg+z habe spielen lassen.)
Erzengel Michael-Statue:
Doch, ich! Sie wirkt auf mich…sagen wir aus der Requisitenkammer der SM-Szene. Ich finde diese Statue ekelhaft und auch blasphemisch. Traditionelle wird der Erzengel ja eher als Ritter, mit Rüstung etc. dargestellt.
Was ich nicht verstehe, das ist diese Hand, sie aus dem Globus herauswächst. Was ist das? Verstehen Sie das Symbol?
Mich befremdet überhaupt die Identifikation der Kirche mit der Welt. Um den Globus herum ist dieses Spruchband montiert „non praevalebunt“.
Nun ist diese Zusage aber nicht an die Welt, sondern an die Kirche gerichtet und das ist bei Jesus immer zweierlei!!!
Mir scheint, dass es bei bestimmten innerkirchlichen Netzwerken mittlerweile Mode geworden ist, sich auf mehr oder weniger sublime Weise über christliche Symbolik lächerlich zu machen. Ich denke da an das Uterus-„Kreuz“, das auf dem Umschlag des neuen „Gotteslob“ prangt, an das barbusige Medusenhaupt im Wiener Stephansdom, mit dem man das Andenken an eine von den Nationalsozialisten ermordeten Ordensschwester verhöhnt oder eben an diese alle Attribute einer Gay-Ikone aufweisende Erzengel Michael Figur in den Vatikanischen Gärten. Dan Brown dürfte seine helle Freude an dieser Symbolsprache haben.
Wenn die Theologenmeinung, der Zölibat sei lediglich eine Disziplin kirchlichen Rechts, die folglich jederzeit abschaffbar sei, sich beim Obersten Lehramt definitiv durchsetzen und daraus die Konsequenz gezogen würde, den Zölibat abzuschaffen oder zu modifizieren, müsste man schon aus dem Grunde Widerstand leisten, weil dadurch der Kirche größter Schaden zugefügt würde, indem sie vor aller Augen von einer Heilsanstalt in eine Unheilsanstalt gewandelt und vollkommen unglaubwürdig gemacht würde. Denn wie kann es sein, dass eine Religionsgemeinschaft ihren Kultdienern jahrhundertelang, eigentlich seit ihrem Bestehen, derart tiefgreifende Verpflichtungen wie die sexuelle Enthaltsamkeit auferlegt und sie bei Verstößen suspendiert, um sie dann plötzlich, einfach weil es nicht mehr zeitgemäß und opportun erscheint, von dieser Verpflichtung zu entbinden. Was für ein ekelhaft wankelmütiges Monster wäre eine solche Kirche, wie hätte sie sich über Jahrhunderte an denen, die Jesu als Kleriker nachfolgten, versündigt. Eine solche Kirche würde vollkommen unglaubwürdig und wäre in all ihren Lehren und Prinzipien nicht mehr ernst zu nehmen, weil sie ihren Gläubigen heute dies und morgen das lehrt und von ihnen fordert. Heute werden Geschiedene von den Sakramenten ferngehalten, morgen erhalten sie die Ehrenplätze, heute gilt homosexuelle Lebensweise als schwer sündhaft, morgen wird sie gesegnet, heute werden Kleriker aus ihrem Klerikerstand entlassen und in die Wüste geschickt, weil sie ihr Zölibatsversprechen gebrochen haben, morgen werden sie in allen Ehren wieder eingesetzt, gestern wurde man aufgrund einer Mitgliedschaft in freimaurerischen Organisationen exkommuniziert, heute kann man als Rotarier Bischof oder sogar Papst werden, gestern galt Leichenverbrennung als antichristlicher Akt, heute werden Kirchenunter Beifall und Belobigung und für gutes Geld zu Urnenabstellstätten umfunktioniert. Was für eine lächerliche, weil prinzipienlose Religionsgemeinschaft! So schafft man sich selber ab. Und das ist auch das verborgene Ziel der Leute, die diesen Kurs unter dem Beifall der Welt fahren. Und dagegen muss jeder, der seien Glauben ernst nimmt, Widerstand leisten, denn man muss Gott mehr gehorchen, als den Menschen, die Gott nur im Munde führen, aber nach ihrem eigenen Willen handeln und befehlen.
Es ist völlig unerheblich für die Weltkirche, ob ein paar Anhänger der Piusbruderschaft Papst Franziskus folgen oder nicht, da sich die Piusbruderschaft NICHT in Gemeinschaft mit der kath. Kirche befindet sondern im Schisma.
Sie können sich hier empören so viel Sie wollen, das interessiert in unserer offiziellen röm-kath. Kirche kein Mensch.
@Rapunzel: Sie verbreiten doch tatsächlich eine LÜGE. Wo bitte ist eine Piusbruderschaft im Schisma? Wer gibt Ihnen das Recht eine Gemeinschaft „schismatisch“ zu nennen, nur weil diese die Überlieferung und Tradition bewahren will?? Ihre Äußerungen sind überheblich und zeugen von Hochmut und zeigt, wie untolerant Sie anderen Meinungen gegenüber stehen. Wenn Sie schon von Schisma reden, dann müssten Sie aber auch die deutschen, schweizer und österreichischen Bischöfe nennen, die die Anweisungen aus Rom einfach ignorieren. Was bitte ist den Ihrer Meinung nach die offizielle römisch-katholische Kirche??
Sie überschreiten Ihre Zuständigkeit, wenn Sie für alle Mitglieder der römisch-katholischen Kirche sprechen wollen.
Ich z.B. bin auch ein Mensch, und gehöre zu „Ihrer“ bzw. „unserer“ offiziellen römisch-katholischen Kirche, wie Sie es ausdrücken (die Kirche gehört Jesus Christus), bin aber anderer Auffassung als Sie hinsichtlich der Piusbruderschaft.
Die Piusbruderschaft gehört voll zur Kirche; im Unterschied zu innerkirchlichen Gruppen, die seit Jahren gegen die katholische Glaubens- und Sittenlehre und Disziplin rebellieren. .
Würde die Piusbruderschaft nicht zur Kirche gehören, dann (z.B.) wäre es nicht die Glaubenskongregation gewesen, die die Verhandlungen mit ihr führte, dann wäre eine andere Vatikanbehörde zuständig gewesen, nämlich diejenige, die mit den nichtkatholischen Konfessionen verhandelt.
Wenn die „offizielle“ Kirche nicht sehr gut aufpasst, dann kann bald sie es sein, die im Schisma ist (was Gott verhüten möge), und da wird es für die Sache selbst „unerheblich“ sein, wenn sie, zu Beginn wenigstens, in der Überzahl ist.
„Sie können sich hier empören so viel Sie wollen, das interessiert in unserer offiziellen röm-kath. Kirche kein Mensch.“
Es könnte aber sein das Christus (um den es eigentlich geht) sich sehr wohl für die interessiert die bis zuletzt standhaft bleiben und sich nicht irre machen lassen. Bleibt die große Masse der protestantisierenden Katholiken standhaft?
„Na, dann fragen Sie doch mal den Präfekt der Glaubenskongregation, ob die Piusbruderschaft sich im Schisma befindet oder nicht.“
Zuerst muß ich erstmal rausbekommen was er mit den Hymen der Mutter Gottes uns sagen will. Wir stehen erst am Anfang.
„Für Studium und Praxis der Theologie“, in dem Müller schreibt: [es geht] „nicht um abweichende physiologische Besonderheiten in dem natürlichen Vorgang der Geburt (wie etwa die Nichteröffnung der Geburtswege, die Nichtverletzung des Hymen und der nicht eingetretenen Geburtsschmerzen), sondern um den heilenden und erlösenden Einfluss der Gnade des Erlösers auf die menschliche Natur“
Per Mariam ad Christum.
Wo Petrus ist, ist die Kirche! Und Papst Franziskus ist der vom Konklave gültig gewählte Nachfolger des Hl. Petrus!
Benedikt ist Papst emeritus und damit nach eigener Aussage kein Papst mehr.
@ Rapunzel: Was hat diese Aussage mit Ihrer Behauptung zu tun, die Piusbruderschaft sei Schismatisch???? So weit ich informiert bin, erkennt die Bruderschaft St. Pius X. Papst Franziskus als Papst an. Sie hat aber auch das Recht und die Pflicht, Äußerungen von Franziskus, die im Widerspruch zur Lehre stehen zu kritisieren. Es gilt noch immer das Gebot: Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und wenn ein Papst einmal Häresien von sich gibt, so dürfen wir ihm in diesen Punkten nicht folgen. Der Papst hat keine Macht neue Lehren zu verkünden, dazu wurde ihm die Unfehlbarkeit nicht verliehen. Aber mit Ihrer lächerlichen „Schismakeule“ gegen die Piusbruderschaft erkennt man Sie, als ewig gestrig.
Na, dann fragen Sie doch mal den Präfekt der Glaubenskongregation, ob die Piusbruderschaft sich im Schisma befindet oder nicht.
Bin gespannt, was der Ihnen antwortet.
Warum sollte man einen mit häretischen Tendenzen (http://pius.info/archiv-news/734-beziehungen_zu_rom/6969-interview-mit-pater-gaudron) fragen, wer nun angeblich zu Kirche Gottes unseres Herrn gehört oder nicht? Können sie bitte ein offizielles Schreiben aus dem Vatikan benennen in dem ihre Aussage bestätigt wird das sich die hochlöbliche Priesterbruderschaft St. PIUS X offiziell im Schisma befindet? Oder wollen sie hier nur seine Heiligkeit Papst Benedikt XVI. verunglimpfen in dem sie diesen des Gesetzesbruches bezichtigen???
Gottes und Mariens Segen auf allen Wegen.
@Rapunzel: Sie stellen die private Meinung eines Bischofs, der Dogmen leugnet, über die Wahrheit! Es ist doch bekannt, dass Bischof Müller die FSSPX hasst, wie der Teufel das Weihwasser. Eine Lüge, wird auch nicht wahrer, wenn sie diese tausendmal wiederholen. Die FSSPX ist nicht im Schisma, ihr kanonischer Status ist jedoch noch nicht geklärt. Das ist die Wahrheit und wenn Sie nun einen Kopfstand machen und mit den Beinen strampeln wollen, bitteschön, das können Sie gerne machen. Ihre Behauptung wird deswegen aber nicht wahrer werden. Die FSSPX ist nicht schismatisch!!!!! Jedoch sind die im Schisma, die sich hartnäckig weigern, die Anweisungen aus Rom zu befolgen und immer für die eigene Nation Ausnahmeregeln schaffen.
@ Rapunzel:
Ich bitte Sie inständig, sich eines sachlichen Stils zu befleißigen. EB Müller kann doch denken, was er will. Es ist unerheblich, wenn er sachlich im Irrtum ist.
Die FSSPX ist nicht im Schisma. Schisma heißt, dass jemand Dogmen der Kirche oder einen gültig gewählten Papst leugnet und daraus das Recht ableitet, einen neue Kirche aufzumachen oder einen neuen Papst zu wählen.
Das hat Lefèbvre nie getan!
Das Problem unserer Tage ist, dass häretische Bischöfe nicht mehr – wie vor Jahrhunderten – die Kirche verließen und eine neue aufgemacht haben. Heute bleiben sie in der Kirche und vergiften von innen die Atmosphäre.
Da die Dogmen objektiv formuliert sind, ist es jedoch hier nicht schwer, nachzuprüfen, ob nicht vielleicht Müller eher ein Häretiker ist als die FSSPX, deren einziger „Fehler“ darin bestand, Bischofsweihen vorzunehmen, die JPII. hinausgezögert und verschleppt hatte.
JPII., der andererseits all die Häretiker, die jetzt die Kirche zerstören, ohne Not zu Bischöfen erhoben hat: Lehmann, Zollitsch, Bergoglio, Schönborn etc.
EB Lefèbvre hat erkennbar und unbezweifelbar die Absicht gehabt, die eigentliche Lehre der Kirche, wie sie immer war und die Hl. Messe, wie sie im wesentlichen immer gefeiert wurde, zu retten für den Tag, an dem Jesus diesem Mainstream-Treiben ein Ende bereiten wird. Dazu mag man stehen wie man will – aber ein schismatisches Verhalten kann man darin sachlich nicht erkennen!
Nein, meine Liebe, ab jetzt werden Sie sorgsam nachdenken, sehr sorgsam – vorausgesetzt, Sie lieben die Wahrheit.
Was mich einwenig irritiert ist, daß man Rapunzel soviel Aufmerksamkeit schenkt. Rapunzel betreibt offensichtlich Rufmord , eine äußerst schwere Sünde, doch heute leider vielverbreitet.
…weil man einem Rufmord nur durch massive Einwendungen entgegenhalten kann…logisch?!
Richtig! Und man sollte es mit allen Kräften versuchen. Es geht ja nicht, darum den Ruf Einzelner zu schützen, sondern um die heilsnotwendige Wahrheit für Jeden.
Wer einen so schweren Rufmord, fahrlässig oder bewußt in zig tausend Fällen betreibt, der ist blind und verstockt. Auch die besten Argumente erreichen ihn nicht.