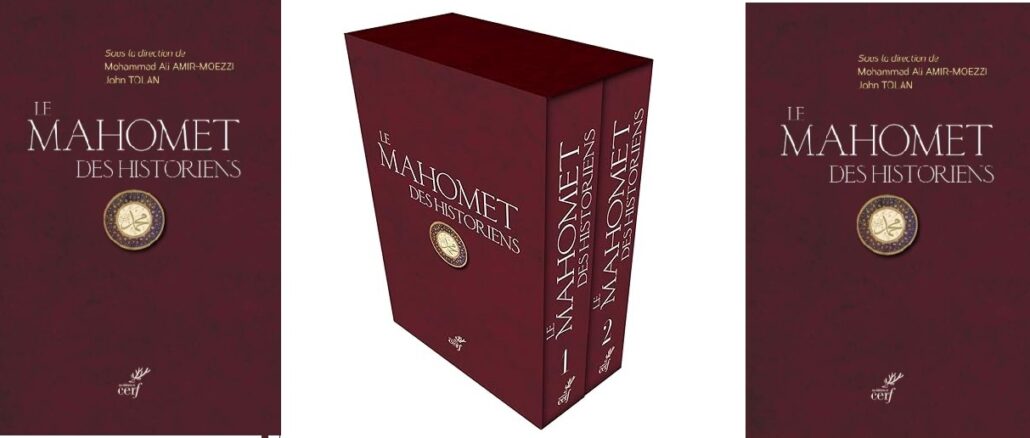
In Frankreich ist Mitte Oktober ein monumentales Werk erschienen: Le Mahomet des historiens („Der Mohammed der Historiker“) in zwei Bänden (über 2.000 Seiten) bei Les Éditions du Cerf. Herausgegeben wird das Werk von Mohammad Ali Amir-Moezzi und John Tolan, mit Beiträgen von fünfzig internationalen Fachleuten. Ziel des Projektes ist es, die historische Figur Mohammeds, sein Wirken und seinen kulturellen Einfluß wissenschaftlich zu untersuchen – jenseits von Mythos, religiöser Verehrung und apologetischen Darstellungen. Dabei werden alle verfügbaren Quellen herangezogen: islamische und nicht-islamische, arabische, christliche, persische und afrikanische Texte sowie mystische und literarische Schriften. Und das Ergebnis ist verblüffend.
Kaum gesicherte historische Fakten
Trotz des enormen Umfangs weisen die beteiligten Historiker auf eine grundlegende, ja entscheidende Einschränkung hin: Über die historische Person Mohammeds läßt sich kaum etwas mit Sicherheit sagen. Kein Wunder also, daß es eine ganze Strömung in der Islamwissenschaft gibt, die sich auf die Frühphase des Islams konzentriert und sogar die Existenz Mohammeds infrage stellt. Die Autoren des neuen Werks zählen jedoch nicht zu dieser Richtung.
In einem Interview mit Le Monde erklärt der Projektleiter Mohammad Ali Amir-Moezzi, emeritierter Direktor an der École Pratique des Hautes Études in Paris und einer der führenden Islamwissenschaftler der Welt, daß „das, was Historiker über Mohammed mit Sicherheit sagen können, kaum zwei Seiten füllt“.
Bereits vor drei Jahrzehnten hatte die Anthropologin Jacqueline Chabbi in der Fachzeitschrift Arabica darauf hingewiesen, daß eine historische Biographie Mohammeds mit kritischen Methoden unmöglich sei, da die Quellen spät, widersprüchlich, ungenau und theologisch wie politisch gefärbt seien. Der erste biographische Bericht, verfaßt von Ibn Ishaq und überarbeitet von Ibn Hisham, entstand erst mehr als ein Jahrhundert nach Mohammeds Tod.
Amir-Moezzi und John Tolan, emeritierter Professor an der Universität Nantes, bestätigen: „Wenn man überhaupt eine Biographie über Mohammed schreiben kann, liegt das daran, daß man die Texte nicht kritisch untersucht. Wer hingegen einen kritischen Ansatz verfolgt, findet sich bald in einer unlösbaren Situation.“
Ein biblisches, kein islamisches Botschaftsbild
Sicher rekonstruierbar sei lediglich, so die Autoren, daß Mohammed im späten 6. Jahrhundert in Westarabien gelebt habe. Alles Weitere – Geburts- und Sterbedaten, Zahl der Kinder und Ehefrauen, seine Taten – bleibt in den nebulösen, spät entstandenen und widersprüchlichen Quellen verborgen.
Was jedoch mit einiger Sicherheit festgehalten werden könne, sei die Art seiner Botschaft: Mohammed verkündete, so die Forscher, „eine Botschaft innerhalb der monotheistischen Tradition von Judentum und Christentum“, rief zu Buße, Frömmigkeit, Nächstenliebe und Mildtätigkeit auf und warnte vor der göttlichen Strafe.
Amir-Moezzi betont, daß der Koran „als Fortsetzung der Tora des Mose und des Evangeliums Jesu (Sure 5,46) präsentiert wird“ und apokalyptische Themen behandelt, die eindeutig jüdisch-christlichen Ursprungs sind. Der einzige Unterschied liege darin, daß Gott im Koran regelmäßig in der Ich-Form spreche.
John Tolan hebt hervor, daß der Koran eine Bevölkerung voraussetzt, die bereits „breit vertraut ist mit der monotheistischen, also biblischen Tradition“. Die zahlreichen Anspielungen auf biblische Geschichten, insbesondere die der Propheten des Alten und Neuen Testaments, setzen ein entsprechendes Vorwissen voraus.
In diesem Zusammenhang verweist Tolan auf aktuelle Forschungsergebnisse, die den Koran in bezug auf die syrische Peschitta betrachten, eine syrische-aramäische Übersetzung des Evangeliums. Auffällig ist: Mohammed selbst wird im Koran nur viermal erwähnt, und es gibt keinen Hinweis darauf, daß er sich bewußt von jüdischen oder christlichen Propheten unterscheiden wollte oder eine neue Religion gründen wollte.
Der Koran und die europäische Wahrnehmung
Im Mittelalter galt Mohammed den europäischen Christen, so Amir-Moezzi, als falscher Prophet, nicht zuletzt, weil die Evangelien solche falschen Propheten vorhersagten. Daß der Koran zahlreiche biblische Elemente enthielt, verstärkte diesen Eindruck noch.
Eine entscheidende Wende kam 1543 mit der Herausgabe einer älteren lateinischen Übersetzung des Korans, aber versehen mit einer deutschen Vorrede von Martin Luther. Luther unterstützte die Koran-Veröffentlichung, und es ist kein Zufall, daß protestantische Prediger darin fortan Argumente gegen die katholische Kirche fanden. Der Islam wurde in dieser Perspektive – trotz weiterhin negativer Gesamtbewertung – als ein „geringeres Übel“ gegenüber dem Katholizismus betrachtet.
Auf dieser protestantischen Linie baute die Aufklärung auf: Das Bild Mohammeds wurde zunehmend positiv gezeichnet – nicht aus historischer Genauigkeit, sondern als ideologisches Instrument gegen die katholische Kirche. Er erschien nun als große spirituelle Figur, als Dichter und Gelehrter, gefeiert schließlich sogar von Goethe und Victor Hugo. Napoleon sah in ihm einen großen Gesetzgeber. Dies geschah vor dem Hintergrund, daß die islamische Welt damals militärisch keine Bedrohung mehr war und daher unter einem exotischen, idealisierten und antikatholisch-instrumentalisierten Blickwinkel betrachtet wurde. Erst mit der islamischen Revolution im Iran 1979 und der damit verbundenen Demütigung der USA trat der politisch motivierte Islam wieder in den Vordergrund und wurde zunehmend als reale Bedrohung wahrgenommen.
Ein Vergleich zu christlichen Quellen
Die historisch-kritische Methode führte einen langen „Glaubenskampf“ mit der Behauptung, daß es kaum stichhaltige Quellen über das Leben Jesu gebe – dabei gibt es kaum eine historische Gestalt, die so gut überliefert und zeitgenössisch belegt ist. Dieselbe Methode wird jedoch selten auf Mohammed angewendet, obwohl er etwa 600 Jahre nach Christus gelebt haben soll. Der Grund dafür wird im neuen zweibändigen Werk direkt oder indirekt deutlich: Über Mohammed ist tatsächlich kaum etwas bekannt, das einer historischen Überprüfung standhält. Alles, was über sein Leben überliefert ist, stellt eine nachträgliche Rekonstruktion dar, die den Maßstäben historischer Gewißheit nicht entspricht.
Text: Giuseppe Nardi
Bild: Verlag (Screenshots)
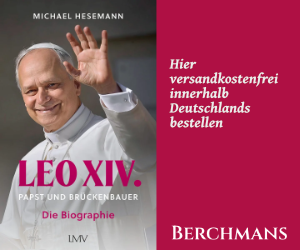




Hinterlasse jetzt einen Kommentar