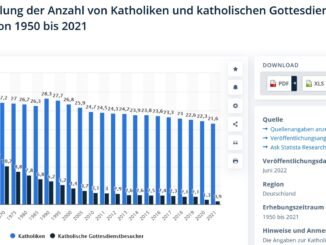Der jahrelange Kampf gegen die Arautos do Evangelho (Herolde des Evangeliums) offenbart eine beunruhigende Seite kirchlicher Machtmechanismen. Was unter Johannes Paul II. als dynamisches pastorales Projekt entstand, wurde unter Papst Franziskus in eine beispiellose Krise getrieben. Die in Brasilien entstandene, aber bald international blühende Gemeinschaft – aktiv heute in rund 80 Ländern – sieht sich seit 2019 einer rigorosen päpstlichen Intervention ausgesetzt, ohne daß je ein stichhaltiger Vorwurf zivil- oder kirchenrechtlich bestätigt wurde.
Ein beispielloser Eingriff ohne transparente Begründung
Die Wurzel des Konflikts liegt in einer apostolischen Visitation, die 2017 begann, gefolgt von einer administrativen Zwangsmaßnahme: Im Herbst 2019 installierte Papst Franziskus einen päpstlichen Kommissar, unterstellte die Gemeinschaft einem außergewöhnlichen Regime, verbot Priester- und Diakonenweihen und untersagte faktisch die Aufnahme neuer Mitglieder.
Was seither beunruhigt: Eine offizielle, nachprüfbare Rechtfertigung dieser drastischen Maßnahmen blieb bis heute aus. Weder die Öffentlichkeit noch die Herolde selbst erhielten jemals nachvollziehbare Darlegungen, welche konkreten Mängel – strukturell, moralisch oder finanziell – den Eingriff legitimierten.
In das Visier von Santa Marta gerieten die Herolde, als 2017 ein internes Video der Öffentlichkeit zugespielt wurde, das dem Gründer und Generaloberen der Gemeinschaft als Kritik an Papst Franziskus ausgelegt wurde. Noch vor der Bekanntgabe einer Visitation erfolgte der Rücktritt des Generaloberen Msgr. João Scognamiglio Clá Dias, um von seiner Gemeinschaft das Schicksal der Franziskaner der Immakulata abzuwenden. Gelungen ist ihm das nicht. Die bergoglianischen Kommissare wurden dennoch entsandt.
Anschuldigungen ohne Substanz?
Trotz zahlreicher kursierender Vorwürfe – unter anderem von Mißbrauch, Ungehorsam oder fragwürdigen „Exorzismen“ – zeigten sich im kirchlichen wie im zivilen Verfahren keine belastenden Tatsachen: Laut Berichten wurden über 30 Verfahren eingestellt oder endeten mit Freisprüchen.
Die massiven Beschuldigungen wiederum basieren häufig auf verzerrten oder medial aufgebauschten Darstellungen, die der kurzfristigen Stimmungsmache dienen, aber einer Überprüfung nicht standhalten. Beispiele dafür sind:
- Die häufig kolportierte Weigerung (Ungehorsam), Minderjährige aus Herolde‑Heimen zu entlassen
– wie es Rom gefordert hatte –, entpuppte sich als das Gegenteil: In vielen Fällen waren es die Eltern selbst, die entschieden, ihre Kinder nicht abzuholen – weil sie von der Spiritualität der Gemeinschaft überzeugt waren und in der Maßnahme eine ungerechte Intervention zur Schwächung der Gemeinschaft sahen. - Behauptete „irreguläre Exorzismen“ wurden von örtlichen Bischöfen als normale Befreiungsgebete eingeordnet – ein in charismatischen, geistlichen Gemeinschaften durchaus gängiger Brauch.
Justiz ohne Anklage: Ein innerkirchliches Paradoxon
In einem fairen kirchlichen Verfahren wären die Rechte der Angeklagten zentral – dazu gehört als Mindeststandard das Recht, die konkreten Anklagegründe zu kennen und darauf angemessen reagieren zu können. Doch nach Aussagen der Herolde wurden ihnen die Gründe für die Visitation und die darauf folgenden Maßnahmen nicht mitgeteilt. Dieses Schweigen wirft ein ernstes Licht auf die kircheninternen Mechanismen: Es erinnert eher an kafkaeske Prozesse denn an normgerechte kanonische Verfahren.
Msgr. João Scognamiglio Clá Dias war ein Schüler des brasilianischen katholischen Denkers Plinio Corrêa de Oliveira. Die Kirche in Brasilien ist stark befreiungstheologisch ausgerichtet. Plinio Corrêa de Oliveira war ein entschiedener Gegner der marxistischen Befreiungstheologie. Das allein machte Msgr. João Scognamiglio Clá Dias in den Augen einiger brasilianischer Bischöfe bereits in hohem Maße „verdächtig“. Mit der Wahl von Papst Franziskus machte sich Rom diesen Vorbehalt zu eigen.
Die Entscheidung vor Leo XIV.: Chance oder Fortsetzung des Stillstands?
Mit Blick auf den Pontifikatswechsel kursiert eine drängende Frage: Wird Papst Leo XIV. den Fall der Herolde des Evangeliums endlich transparent und gerecht abschließen? Er steht vor einer grundlegenden Wahl: entweder die Gerechtigkeit wiederherstellen oder die langjährige Marginalisierung fortschreiben.
Ein solcher Schritt wäre nicht nur ein Signal für die Arautos selbst.
Ihrem Gründer, Msgr. João Scognamiglio Clá Dias, war es nicht vergönnt, die Aufhebung der Sanktionen gegen seine Gemeinschaft zu erleben. Er verstarb Anfang November 2024 im Alter von 85 Jahren in Franco da Rocha im brasilianischen Staat São Paulo an den Folgen eines Schlaganfalls.
Text: Giuseppe Nardi
Bild: Herolde des Evangeliums/MiL