
Reisenotizen von Giuseppe Nardi
In den sanften Hügeln der Toskana, nahe dem mittelalterlichen Städtchen Chiusdino, befindet sich ein Ort, in dem Geschichte, Glaube und Übernatürlichkeit eine außergewöhnliche Einheit erlangten – und sehr viel mit der Artus-Sage zu tun hat.
Dort, in der Rotonda di Montesiepi, steckt ein Schwert in einem Felsen – ein Relikt, das die Geschichte eines Heiligen erzählt und die Entstehung eines weltbekannten Motivs der Artus-Sage begründete. Was nur wenige wissen: Dieses Motiv, das heute vor allem mit König Artus und dem Schwert Excalibur verbunden wird, hat seine Wurzeln nicht in Britannien oder bei den Kelten, sondern in der realen Geschichte eines toskanischen Ritters, der zum Heiligen wurde: Galgano Guidotti. Ein zentrales Motiv der Artus-Sage hat eine ganz reale Vorlage.
Galgano Guidotti: Vom Ritter zum Heiligen
Galgano Guidotti wurde um 1148 in Chiusdino geboren, das damals zur Republik Siena gehörte. Als Sohn des Ritters Guido oder Guidotto war er Abkömmling einer toskanischen Adelsfamilie langobardischer oder fränkischer Herkunft und führte ein Leben voller Kriege, Streitereien und weltlicher Ambitionen. Wie viele junge Ritter seiner Zeit war er stolz, mutig und oft gewalttätig – ein Mann, der das Schicksal in der Waffe suchte. Doch im Alter von etwa 30 Jahren erlebte er eine Vision des Erzengels Michael, die sein Leben für immer veränderte. In dieser Erscheinung erkannte er die Sinnlosigkeit von Krieg und Haß. Die Welt erschien ihm leer und vergänglich, und er spürte den Ruf zu einem anderen, höheren Leben.
Er zog sich auf den Hügel Montesiepi zurück, entschlossen, als Einsiedler zu leben und sich ganz Gott zu weihen. Als äußeres Zeichen dieser radikalen Umkehr stieß er sein Schwert in einen Felsen – ein Akt, der in keiner Weise physikalisch erklärbar ist. Noch heute steckt das Schwert fest in dem Stein, ohne daß menschliche Kraft es entfernen könnte. Es widersetzt sich allen bekannten Gesetzen der Metallurgie und Mechanik und wird daher als Wunder angesehen – als sichtbarer Beweis für die göttliche Macht und als Zeichen, daß Gottes Wille über alle Naturgesetze hinausgeht.
Dieses Ereignis, das um 1180 stattfand, wurde schnell zu einer Quelle der Verehrung. Nach Galganos Tod am 3. Dezember 1181 begann die Verehrung des jungen Heiligen rasch. Bereits 1185 wurde er von Papst Lucius III. heiliggesprochen. Seine Umkehr, symbolisiert durch das unlösbare Schwert, wurde zur Ikone der christlichen Buße und des Verzichts auf weltliche Macht. Schon zu Lebzeiten hatten sich ihm andere junge Männer angeschlossen und eine Eremitengemeinschaft gebildet. Die Rotonda di Montesiepi errichtete Galgano mit seinen Gefährten. Sie beherbergt heute noch das Schwert und zieht Pilger aus aller Welt an.
Die wissenschaftliche Untersuchung des Schwertes
Das Wunder des Schwertes von Galgano ist ein Gegenstand wissenschaftlicher Studien. Im Jahre 2001 untersuchte der Chemiker Luigi Garlaschelli das Schwert. Er bestätigte, daß das Schwert stilistisch und materiell mit Waffen des späten 12. Jahrhunderts übereinstimmt. Die Zusammensetzung des Metalles stimmt mit Eisenabfällen überein, die in der Gegend gefunden wurden. Es handelt sich also nicht um eine spätere Fälschung. Doch trotz der wissenschaftlichen Bestätigung des Alters kann niemand erklären, warum das Schwert bis heute im Stein steckt und keinerlei physische Kraft es lösen kann.

Das Schwert ist ein sichtbarer Gottesbeweis – ein Zeichen, daß Gott die Umkehr eines Menschen segnete und bestätigte. In der religiösen Vorstellung des Mittelalters war dies ein herausragender Beweis für die Überlegenheit göttlicher Macht über die natürliche Welt. Der Umstand, daß ein junger Ritter der Hauptakteur der Ereignisse war, beflügelte die damals stark ritterlich geprägte Zeit.
Vom Hügel Montesiepi in die Artus-Legende
Das Motiv des „Schwerts im Stein“ wurde später weltberühmt, allerdings nicht durch den realen historischen Kontext, sondern durch die Artus-Sage. Das Motiv von Excalibur als unlösbares Schwert, das nur der wahre König von Britannien ziehen kann wird erst wenige Jahre nach dem Tod des heiligen Galganus in die Artus-Sage eingeführt.
Die Geschichte von Galgano, einem Ritter, der sein Schwert in einen Felsen stieß, bildet die Vorlage für die literarische Entwicklung der Artus-Sage, die auf Robert de Boron zurückgeht. Der anglonormannische Dichter, der in Altfranzösisch schrieb, verfaßte zwischen 1190 und 1995 eine Estoire dou Graal (Geschichte des Grals). Darin führte er erstmals das Schwert-Motiv in die Artus-Sage ein, die dann durch weitere Literaten im Laufe der folgenden Jahrhunderte ihre Ausschmückungen fand. Borons Versdichtung entstand rund ein Jahrzehnt nach Galganos Tod und wenige Jahre nach dessen Heiligsprechung.
Der zentrale Aspekt dabei ist die Idee, daß ein Mensch durch göttliche Macht einen Akt vollzieht, der physikalisch unmöglich erscheint, fand ihren Weg in die höfische Literatur des Mittelalters. In der Folgezeit wurde das Motiv in ganz Europa verbreitet und verklärt – während Galgano selbst, der Heilige von Montesiepi, im Schatten der Artus-Sage fast in Vergessenheit geriet.
Beflügelt wurde Boron möglicherweise durch eine entfernte Namensähnlichkeit zwischen Galgano und Gawein. In den 70er Jahren des 12. Jahrhunderts hatte ein anderer berühmter Dichter jener Zeit, Chrétien de Troyes, den Ritter Gawein als Figur in die Literatur eingeführt und um 1180 mit der Artus-Sage verbunden.
Übernatürliche Dimension und religiöse Symbolik
Was das Schwert von Galgano so außergewöhnlich macht, ist nicht nur seine physische Unbeweglichkeit, sondern auch seine spirituelle Bedeutung. Es widersetzt sich allen Naturgesetzen – niemand kann es herausziehen, und es zeigt damit auf dramatische Weise, daß menschliche Macht und Kraft begrenzt sind. Nur Gott kann solche Wunder bewirken.
In der mittelalterlichen Vorstellung war ein solches Zeichen nicht nur ein religiöses Wunder, sondern ein „Beweis“ für die Wahrheit des christlichen Glaubens. Es zeigte der Ritterschaft, den Pilgern und Gläubigen, daß Umkehr, Buße und Demut vor Gott nicht nur moralische Tugenden, sondern von Gott sichtbare Wirklichkeit sind. Das Schwert wird so zu einer Brücke zwischen Himmel und Erde, ein Symbol für den triumphierenden Willen Gottes über die irdischen Gesetze.
Die Rotonda di Montesiepi und die Abtei San Galgano
Die Rotonda di Montesiepi, eine kleine, rund gebaute Kapelle, ist das architektonische Herzstück, durch das der Heilige greifbar wird. Die Fresken im Inneren, die von Ambrogio Lorenzetti aus der Zeit von 1334 bis 1336 stammen, erzählen Szenen aus dem Leben des heiligen Galganus und den Moment, in dem er sein Schwert in den Felsen stößt. Galgano selbst knüpfte Kontakt zu den Zisterziensern. Wenige Jahre nach seinem Tod ist bereits eine Zisterziensergemeinschaft in der ehemaligen Einsiedelei belegt. Da der Ort, an dem der Heilige lebte und verstarb, bald zu klein wurde, erfolgte 1218 am Fuß des Hügels die Gründung einer großen Zisterzienserabtei, die zu einem wichtigen Zentrum des kirchlichen Lebens in der Toskana heranwuchs. 1783 wurde das Kloster von Großherzog Leopold von Toskana, dem späteren Kaiser Leopold II., aufgehoben. Leopold folgte in der Kirchenpolitik ganz den Vorstellungen seines kaiserlichen Bruders Joseph II.
Die Ruinen der Abtei sind noch heute ein beeindruckendes Zeugnis einer glanzvollen Vergangenheit: Hohe Gewölbe, massive Mauern und der weite Blick in die Landschaft zeugen von der einstigen Größe des religiösen Zentrums. Im Gegensatz dazu ist die Rotonda di Montesiepi bis heute gut erhalten, und besonders die Kuppel mit ihre kreisförmigen Bemalung gilt als herausragendes Beispiel mittelalterlicher Sakralkunst.
Die Verbindung von Rotonda und Abtei symbolisiert die Verschmelzung von individuellem Heilsweg, mönchischem Wirken, kirchlicher Präsenz und übernatürlichem Phänomen. Galganos persönliche Buße und spirituelle Umkehr wurden durch die Rotonda und Abtei institutionalisiert und für nachfolgende Generationen sichtbar gemacht. Das Schwert selbst, unlösbar im Stein, bleibt das zentrale Symbol dieses Zeugnisses.
Fazit: Ein Zeichen übernatürlicher Macht
Das Schwert im Stein von San Galgano ist weit mehr als ein Relikt. Es ist ein übernatürliches Zeichen, das die Grenzen menschlicher Möglichkeiten sprengt. Kein physikalisches Gesetz kann erklären, warum es bis heute unbeweglich im Felsen steckt. Für Gläubige ist es ein lebendiger Gottesbeweis – ein Zeichen, daß göttliche Macht über alles Irdische hinausgeht.
Darüber hinaus zeigt das Schwert die Verbindung von Geschichte, die durch die Literatur in anderem Kontext zur Legende wird: Es inspirierte die Artus-Sage, wurde in höfischen Dichtungen weitergegeben. Wirklichkeit und Legende handeln auf der Grundlage des Christentums. Montesiepi ist zum Geheimtipp geworden, da der heilige Galganus weitgehend in Vergessenheit geraten ist. Anziehungspunkt für Besucher sind heute vor allem die beeindruckenden Ruinen der einstigen Zisterzienserabtei. Vergleichbares kennt man aus England und Schottland, dem Land der Artus-Handlung, weil dort Anglikaner und Reformierte einen Klostersturm durchführten. Für den Süden Europas ist der Anblick jedoch ungewöhnlich und entfaltet deshalb den Reiz einer besonderen Sehenswürdigkeit. Im Schatten der Ruinen stoßen nicht alle Besucher auf das nahegelegene Heiligtum von San Galgano mit dem Schwert, das – da Wirklichkeit – eigentlich weit berühmter sein sollte als die Artus-Sage.
Montesiepi ist heute ein Symbol für den Triumph von Glauben, Umkehr und Demut. Galganos Leben und seine Entscheidung, Gewalt und Welt abzuschwören, sind zu einem Monument geworden, das über Zeit und Raum hinausstrahlt und jederzeit der Wiederentdeckung harrt.
Wer heute die Rotonda di Montesiepi besucht, sieht das Schwert im Stein – und wird Zeuge eines Wunders, das die Menschen seit über 800 Jahren in Staunen versetzt, und eines Symbols, das die Kraft des Glaubens in ihrer übernatürlichen Dimension sichtbar macht.
Ein Ort und ein Heiliger, die einer größeren Aufmerksamkeit harren.
Bilder: Giuseppe Nardi




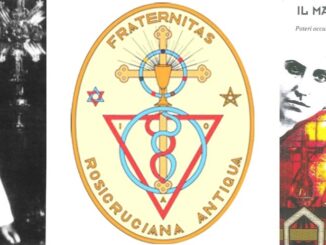


Von dem realen Schwert Excalibur hatte ich noch nie gehört. Robert de Borons „Estoire dou Graal“ ist eine ganz bemerkenswerte Geschichte. Er stellt Joseph von Arimathia in den Mittelpunkt seiner Erzählung. Alle Jünger außer Johannes waren bei der Gefangennahme Jesu geflüchtet. An dieser Stelle treten die beiden Männer auf, die Verantwortung für diese weltgeschichtliche Sitaution übernehmen. Es sind Nikodemus und Joseph. Joseph hatte das Grab für Jesus anlegen lassen. Nikodemus war vorbereitet für die Einbalsamierung. Er wurde nicht umsonst Lehrer Israels genannt. Die beiden benutzten eine ganze Badewanne voll erlesener Kräuter, um den Körper Jesu zu präparieren. Es ist offensichtlich, daß sie im Auftrag des Herrn handeln, der das Flüchten der Jünger voraussah. Der heikelste Moment war zuvor vom römischen Hauptmann Longinus gerettet worden, der ohne Auftrag, sondern aus freiem Entschluß die Lanze warf. Ein Gnadenakt. Exakt die Lanze, die heute in der Wiener Hofburg ausgestellt ist. Hätte Longinus die Lanze nicht geworfen, wäre dem Erlöser stattdessen die Knochen gebrochen worden. Ein laut drei Stellen des Alten Testamentes untersagter Akt bei der Opferung des Lammes. Gawan und Parzival sind in einem früheren Jahrhundert zu suchen. Die realen Artusgestalten liegen noch weiter zurück.