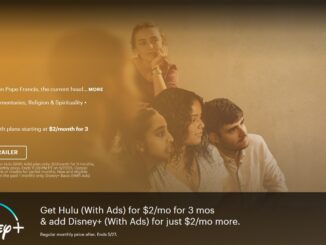Von Plinio Corrêa de Oliveira*
Ich glaube, es ist angebracht, mit der Beantwortung einer grundlegenden Frage einzuleiten – einer Frage, die sich zu Beginn jedes Studienkurses stellt. Die Frage lautet: Welchen konkreten Stellenwert haben die Themen, die wir hier behandeln werden, im Gesamtzusammenhang der modernen Probleme, mit denen ihr euch heute – in eurer Lebenssituation und in eurem jungen Alter – auseinandersetzen müßt? Welche Beziehung haben diese Themen zur heutigen Welt, mit der ihr in ständigem Kontakt steht?
Es scheint mir, daß die Formulierung dieser Frage eine ziemlich ausführliche und gründliche Antwort verlangt, damit sie in angemessener Weise geklärt werden kann. Sind die wesentlichen Punkte dieses Themas einmal richtig gestellt und verstanden, wird es euch leichtfallen zu erkennen, daß es in der heutigen Welt kein wichtigeres Thema gibt als jenes, mit dem wir uns in diesen Tagen beschäftigen werden.
Was ist der Kern aller Probleme, die heutzutage untersucht werden? Man kann feststellen, daß gegenwärtig eine große Unordnung herrscht: ein Kampf von Nation gegen Nation, ein erbitterter Klassenkampf, ein Ringen zwischen unterschiedlichen wirtschaftlichen und kulturellen Interessen usw. In jeder Hinsicht ist der Konflikt das prägende Merkmal der heutigen Welt. Wenn ihr eine Zeitung aufschlagt – sei es aus den Vereinigten Staaten, Argentinien, Bolivien, Chile oder anderswo –, so seht ihr vor allem eines: Konfrontation und Streit.
Was ist die tiefere Ursache dieses Kampfes?
Offensichtlich liegt ihr Ursprung in Interessenskonflikten. Doch jenseits der Interessenskonflikte gibt es Meinungsverschiedenheiten in den Ideen. Denn Interessensgegensätze hat es unter den Menschen immer gegeben; wenn sie jedoch dieselben Überzeugungen teilen, gelingt es ihnen meist, Wege zu finden, um diese Gegensätze zu lösen. Wenn aber neben den Interessenskonflikten auch noch Uneinigkeit in den Ideen herrscht, dann ist der Konflikt total.
In einem solchen Fall – selbst wenn kein offener Krieg herrscht – kann die Situation nicht als Frieden bezeichnet werden. Und genau das ist der Zustand der gegenwärtigen Welt.
Nun lehrt uns die Geschichte – und insbesondere hat uns Papst Leo XIII. dies gelehrt –, daß es eine Zeit gab, in der zwar kein absoluter und vollkommener Friede herrschte, in der aber doch in den grundlegenden Fragen weitgehende Übereinstimmung unter den Menschen bestand. Zumindest in Europa herrschte ein grundlegender Konsens, ein tiefes gegenseitiges Verständnis, auch wenn es hin und wieder zu Kriegen kam.
Diese Epoche war das goldene Zeitalter des Mittelalters. Leo XIII. erklärte in einer seiner Enzykliken, daß sie den Höhepunkt der christlichen Zivilisation darstellte.
Betrachtet man den Verlauf der Geschichte genau, so stellt sich eine naheliegende Frage: Wenn im 13. Jahrhundert – wie Leo XIII., ein großer Papst mit außergewöhnlicher Intelligenz, weithin bekannt für seine Bildung und Gelehrsamkeit und einer der bedeutendsten Intellektuellen seiner Zeit, feststellte – die christliche Zivilisation ihren Höhepunkt erreichte, warum verfiel sie dann? Warum entwickelte sie sich nicht weiter? Warum schritt sie nicht zu noch größerer Ordnung, Eintracht und Frieden fort, sondern gelangte stattdessen in den Zustand extremer Auseinandersetzung, den wir heute erleben?
Auf diese Frage gibt es eine Antwort, die ihr im allgemeinen bereits kennt: Es kam zu einem Verfall der Kirche; es kam zu einem Niedergang der christlichen Zivilisation; und infolge dieses religiösen Verfalls setzte ein allmählicher kultureller und gesellschaftlicher Niedergang ein. Aus diesem Grund befinden wir uns heute in der gegenwärtigen Situation.
Was ich hier darlege, läßt sich aus historischer Sicht leicht durch dokumentierte Belege nachweisen. Es stimmt zwar, daß sich die Welt nach dem Mittelalter in mancher Hinsicht weiterentwickelt hat; ebenso wahr ist es aber, daß mit zunehmender Entwicklung auch die Probleme immer schwerwiegender wurden – und daß dieser Fortschritt oberflächlich war, wie bei einem kranken Jugendlichen.
Ein Jugendlicher kann schwer krank sein und dennoch weiter wachsen. Während er wächst, wächst die Krankheit mit ihm. Wird diese Krankheit nicht rechtzeitig geheilt, stirbt er… größer als vorher, aber kränker denn je.
Genau das ist mit der modernen Gesellschaft geschehen: Sie ist immer kränker geworden und gleichzeitig immer wohlhabender, mächtiger, technischer, besser organisiert… bis sie in den Zusammenbruch geraten ist, den wir heute beobachten. All dies läßt sich durch eine historische Darstellung leicht belegen, wie ihr in den Studientagen hier in Amparo selbst feststellen werdet.
Das Problem historischer Beweise besteht jedoch darin, daß sie viel Zeit erfordern: Man muß zahlreiche Ereignisse untersuchen und sorgfältig analysieren. Das braucht selbstverständlich Zeit.
Ich ziehe es daher vor, dieselbe Aussage – nämlich daß die Ursache der heutigen Krise eine religiöse ist und daß die Welt ihre Probleme nur lösen kann, wenn sie sich dieser religiösen Krise stellt – auf theoretischem Wege zu beweisen. Auch diese theoretische Beweisführung stützt sich auf eine solide historische Grundlage, hat aber den Vorteil, kürzer zu sein und schneller zu einer klaren Schlußfolgerung zu führen.
Dieser Beweis gilt für Katholiken. Und da ich hier zu einem katholischen, apostolischen und römischen Publikum spreche, das die Wahrheit der katholischen Kirche anerkennt, kann ich auf dieser Grundlage aufbauen und die entsprechende Argumentation entwickeln.
Ich beginne also mit folgender Frage: Warum gibt es die Zehn Gebote Gottes, die Grundelemente der katholischen und christlichen Moral? Warum hat Gott dem Menschen bestimmte Handlungen verboten, wie sie in den Zehn Geboten genannt sind? Und warum hat Er dem Menschen das große positive und verpflichtende Gebot des ersten Gebots gegeben: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele…“?
Der heilige Thomas von Aquin erklärt das auf meisterhafte Weise: Gott ist der Schöpfer des Universums. Als solcher ist Er auch der Schöpfer der Natur; und als Schöpfer der Natur ist Er der Urheber der Gesetze, die sie regieren. Die gesamte Natur wird durch Gesetze bestimmt, die Gott im selben Augenblick festgelegt hat, in dem Er das Universum erschuf.
Es gibt die Natur der leblosen Dinge; die Natur der lebendigen Wesen ohne geistige Seele; und die Natur der Lebewesen mit geistiger Seele. Das Zusammenspiel dieser drei Ordnungen von Wesen bildet das Universum, und jede von ihnen wird durch eigene Gesetze geregelt. Manche Gesetze sind allgemeingültig und betreffen alle Geschöpfe – belebte und unbelebte, vernunftbegabte und unvernünftige –, andere sind spezifisch für das vernunftbegabte Wesen.
Diese Gesetze entsprechen der Natur jedes Wesens. Und da sie der Natur des Menschen entsprechen, hat Gott sie in den Zehn Geboten zusammengefaßt, damit der Mensch sie erkennt: damit er die grundlegenden Gesetze kennt, die er befolgen muß, um in der Ordnung zu leben, Gott zu verherrlichen und alle Gaben aus dem Universum zu empfangen, die der Schöpfer ihm durch den rechten Gebrauch der geschaffenen Dinge zugedacht hat.
Wenn wir uns also fragen, warum der Mensch Gott über alles lieben soll, lautet die Antwort: Weil es sich aus dem Wesen Gottes und dem Wesen des Menschen ergibt. Gott ist ein unendliches, vollkommenes Wesen – Urbild, Quelle und Wesen aller Heiligkeit. Der Mensch, nach Seinem Ebenbild erschaffen, ist dazu berufen, diesen vollkommenen Gott anzubeten und Ihm ähnlich zu werden.
Deshalb wird ihm geboten, Gott zu lieben: Indem er Ihn liebt, wird er Ihm ähnlicher; indem er Ihm ähnlicher wird, erfüllt er Seinen Willen. Es liegt in der Natur der Dinge, daß der Mensch Gott lieben soll.
Warum soll der Mensch den heiligen Namen Gottes nicht mißbrauchen? Der Name Gottes steht für die göttliche Person, so wie auch unsere Namen unsere Person repräsentieren. Niemand ist zufrieden, wenn sein Name beleidigend gebraucht wird – denn eine Beleidigung des Namens bedeutet eine Beleidigung der Person.
Genauso begeht derjenige eine Sünde gegen die Natur Gottes, der Seinen Namen mißbraucht oder lästert – denn Gott hat Anspruch auf unsere Verehrung.
So ließen sich alle anderen Gebote durchgehen, um zu zeigen, daß jedes von ihnen nur ein Ausdruck des natürlichen Gesetzes unter einem bestimmten Aspekt ist.
Beispiel: Warum darf ein Mensch keinen anderen töten? Weil jeder Mensch von Natur aus Herr über sich selbst ist, aber nicht Herr über das Leben des anderen. Jemandem das Leben zu nehmen, bedeutet eine besonders schwere Form des Diebstahls: Es widerspricht der menschlichen Natur, von einem anderen getötet zu werden.
„Du sollst nicht stehlen“ und „Du sollst nicht begehren, was deinem Nächsten gehört“ – warum? Weil der Mensch ein Recht auf Eigentum hat. Es liegt in seiner Natur, Herr über sich selbst zu sein. Wenn er arbeitet und durch seine Arbeit etwas schafft, ist er Eigentümer dieses Gutes. Eigentum ist also eine Folge der menschlichen Natur. Wer die Frucht der Arbeit eines anderen stiehlt, verletzt diese Natur.
Kurz gesagt: Wer die Zehn Gebote analysiert, erkennt, daß sie den vollkommensten und erhabensten Kodex der natürlichen Ordnung darstellen, den Gott geschaffen hat.
Stellt euch nun ein Land vor, in dem alle Menschen die Zehn Gebote befolgen: Es liegt auf der Hand, daß ein solches Land ein vollkommenes Land wäre.
Ich greife hier auf ein Argument des heiligen Augustinus zurück, des großen Bischofs von Hippo und Kirchenlehrers: Stellt euch eine Schule vor, in der der Direktor und die Lehrer die Zehn Gebote vollkommen befolgen – und ebenso alle Schüler.
In einer solchen Schule wäre der Unterricht am besten möglich. Der Direktor und die Lehrer würden sich bemühen, den besten Unterricht zu geben, um das Gehalt zu rechtfertigen, das sie von den Eltern erhalten. Die Schüler ihrerseits würden nach besten Kräften lernen.
Wenn Lehrer und Schüler sehr intelligent sind, wird es eine hervorragende Schule sein; wenn sie mittelmäßig sind, wird es trotzdem keine mittelmäßige, sondern eine gute Schule sein: Denn wenn selbst die Mittelmäßigen ihr Bestes geben, ist das Ergebnis gut.
Deshalb ist das Wichtigste in einer Schule nicht das Gebäude, nicht das Unterrichtsmaterial und nicht die Klimaanlage für heiße Tage: Entscheidend ist, daß Direktor, Lehrer und Schüler praktizierende Katholiken sind. Wenn sie es sind, fügt sich alles andere. Wenn sie es nicht sind, profitiert niemand – und das Ergebnis ist ein Desaster.
Dasselbe gilt auch in anderen Bereichen: in der Landwirtschaft, in der Viehzucht, in Unternehmen… Wenn Eigentümer und Arbeiter gute Katholiken sind, bringt das Land die besten Früchte hervor. Wenn nicht, treten früher oder später Konflikte, Spaltungen, Streiks, Krisen und Mißverständnisse auf – bis zum Zusammenbruch.
Ich habe nicht viel Zeit, aber ihr könnt das Gedankenexperiment selbst machen: Stellt euch ein Land vor, in dem alle Menschen katholisch sind – ganz gleich, ob es sich um eine Monarchie wie unter dem heiligen Ludwig im 13. Jahrhundert handelt oder um eine Republik wie Ecuador zur Zeit García Morenos.
Wenn das Staatsoberhaupt ein wahrer Katholik ist – wie es der heilige Ludwig war, wie es García Moreno war – und auch das Volk wirklich katholisch ist, dann wird dieses Land aufblühen. Ist es das nicht, wird es verfallen.
Die Begründung ist einfach: Der wahre Katholik kennt die Grundgesetze der Natur – die Zehn Gebote. Wer sie nicht kennt, kann sie nicht befolgen. Und wer sie nicht befolgt, fällt ins Verderben.
Jemand könnte einwenden: „Aber auch die Protestanten kennen die Zehn Gebote. Wie erklärt sich dann, daß es auch in protestantischen Ländern so viele Krisen gibt?“
Die Antwort ist einfach: Sie interpretieren sie falsch. Zum Beispiel erlauben sie die Ehescheidung. Das neunte Gebot verbietet es, die Frau eines anderen zu begehren – die Protestanten legen es so aus, daß sie die Scheidung erlauben, die es einem erlaubt, die Frau oder den Mann eines anderen zu heiraten. Auf diese Weise wird die Familie zerstört.
Es reicht also nicht aus, die Zehn Gebote zu kennen: Man muß sie richtig kennen. Und um sie richtig zu kennen, braucht es eine unfehlbare Autorität, die sie korrekt auslegt und lehrt.
Diese Autorität existiert, praktisch und wirksam, nur in der katholischen, apostolischen und römischen Kirche.
Daraus ergibt sich eine Konsequenz: Die Zehn Gebote Gottes wären für die Menschheit nutzlos, wenn es die katholische, apostolische und römische Kirche nicht gäbe. Nur in ihren Händen sind diese Gebote wirklich wirksam.
Nehmen wir zum Beispiel die griechisch-schismatischen Christen. Sie erkennen – wie die Katholiken – die Unfehlbarkeit an, jedoch nicht die Unfehlbarkeit des Papstes: nur die Unfehlbarkeit aller Bischöfe der Welt, wenn sie gemeinsam versammelt sind. Doch wie sollte man jedes Jahr eine Generalversammlung aller Bischöfe der Welt einberufen? Das ist unmöglich.
Das Ergebnis ist, daß die Ausübung der Unfehlbarkeit nach ihrem System so schwierig ist, daß sie seit ihrer Trennung von Rom niemals ein unfehlbares Konzil abgehalten haben. Ihre eigene Geschichte zeigt die Unpraktikabilität der Struktur, die sie sich selbst gegeben haben.
Die Kirche hingegen hat zahlreiche Konzilien mit bedeutenden Ergebnissen abgehalten.
Hier also der Gedankengang, den ich darlege:
- Die natürliche Ordnung ist die Voraussetzung jeder anderen Ordnung;
- Die natürliche Ordnung erkennt man in den Geboten;
- Die Gebote erkennt man nur, wenn sie richtig ausgelegt werden;
- Eine richtige Auslegung setzt die Unfehlbarkeit voraus;
- Eine praktisch wirksame Unfehlbarkeit gibt es nur in der Heiligen Katholischen, Apostolischen und Römischen Kirche – unfehlbar in der Versammlung der Bischöfe mit dem Papst, aber auch im Papst selbst, der die Mission hat, unfehlbar zu lehren und die Menschen zur Erkenntnis der Zehn Gebote zu führen.
Aber – ist damit schon alles gesagt? Reicht es, die Zehn Gebote zu kennen, um sie zu befolgen?
In Wirklichkeit nicht.
Es ist einfach, die Gebote zu lesen und ihre Erhabenheit anzuerkennen, ja, man kann sogar den Wunsch haben, sie in die Tat umzusetzen. Doch in dem Moment, wo man sie konkret leben muß, beginnen die Schwierigkeiten.
Wir alle wissen, wie schwer es ist, die Gebote zu befolgen – es ist kompliziert!
Wie also kann ein Mensch die Kraft finden, sie zu befolgen?
Heute ist unter den „Kindern der Finsternis“ die Vorstellung weit verbreitet, daß die katholische Moral so streng und schwierig sei, daß es dem Menschen unmöglich sei, sie zu erfüllen.
Was antwortet die Kirche auf diesen Einwand?
Nehmen wir das Beispiel der Reinheit, der Keuschheit. Es stimmt: Die Keuschheit ist eine sehr schwer zu lebende Tugend – nur ein Dummkopf würde das Gegenteil behaupten.
Wie kann man dann vom Menschen verlangen, keusch zu leben?
Die Kirche gibt darauf eine wunderbare Antwort:
- Erstens: Gott kann dem Menschen nichts Unmögliches befehlen.
- Zweitens: Aus sich selbst heraus ist der Mensch unfähig, die Zehn Gebote dauerhaft und vollkommen zu erfüllen. So tugendhaft er auch sein mag, mit seinen natürlichen Kräften allein kann er sie nicht immer befolgen.
Da Gott jedoch die Befolgung der Gebote befiehlt, folgt daraus, daß Er dem Menschen auch die Kraft dazu verleiht: eine übernatürliche Kraft, von Gott selbst geschaffen, die über die menschliche Natur hinausgeht – und es dem Menschen zum Beispiel ermöglicht, keusch und rein zu leben.
Daher ist – nach katholischer Lehre – der keusche Mann oder die keusche Frau ein Wunder. Ein häufiges Wunder, das jedem zuteilwerden kann, der die Gnade Gottes annimmt – aber dennoch ein Wunder. Denn es ist unmöglich, dauerhaft und vollkommen keusch zu leben ohne die Gnade Gottes.
Diese Gnade bietet Gott allen Menschen an. Man muß sie nur erbitten – und wer sie aufrichtig erbittet, der empfängt sie. Mit dieser Gnade kann jeder Mensch guten Willens, der Opferbereitschaft zeigt und seinen Entschlüssen treu bleibt, keusch leben.
Die Erfahrung bestätigt dies: Dort, wo es keine katholische Kirche gibt, existiert beispielsweise auch kein priesterlicher Zölibat. Bei den Protestanten gibt es ihn nicht; bei den griechisch-schismatischen Christen war eine der ersten Maßnahmen nach der Trennung von Rom die Abschaffung des Zölibats für Priester.
In der katholischen Kirche hingegen gibt es den Zölibat. Und es gab Zeiten, in denen er wirksam und echt gelebt wurde – als die große Mehrheit, wenn nicht sogar alle Priester, tatsächlich in Keuschheit lebten. Dasselbe galt für die Ordensschwestern – und für viele, viele Laien, die ebenfalls keusch lebten: Tausende von ihnen.
Nicht, weil der Mensch aus eigener Kraft dazu fähig wäre, sondern weil die übernatürliche Gnade, vom Himmel herabgesandt, ihm diese Möglichkeit gab – das außergewöhnlichste Werk im ganzen Universum.
Das größte Wunder ist nicht ein Wolkenkratzer oder ein Atomkraftwerk, sondern ein Mann oder eine Frau, die die Zehn Gebote Gottes befolgen. Das ist ein gewaltiges Geschenk, ein Meisterwerk Gottes.
Und dieses Meisterwerk – der Mensch, der nach den Geboten lebt – ist die Voraussetzung für jede Zivilisation.
Was ist Zivilisation?
Ich werde hier keine technische Definition geben, sondern nur sagen: Der „Zivilisierte“ ist das Gegenteil des „Barbaren“. Alles, was den Barbaren auszeichnet, steht im Gegensatz zum Zivilisierten.
Wenn die Barbarei der tiefste Zustand menschlicher Erniedrigung ist, dann ist die Zivilisation naturgemäß der Zustand höchster menschlicher Erhebung und Herrlichkeit.
Und wer ist der zivilisierte Mensch schlechthin?
Der Gipfel der Zivilisation ist: ein guter Katholik zu sein. Wer das ist, besitzt die moralischen Tugenden, die dem Barbaren fehlen, Tugenden, die zum Christentum gehören. Durch sie entfaltet er das Beste seiner natürlichen Gaben und erreicht den Zustand des vollkommen Zivilisierten.
Jemand könnte einwenden, es habe Völker mit großer Zivilisation gegeben, die nicht katholisch waren – etwa die Griechen. Es stimmt, daß die Griechen in mancher Hinsicht hochzivilisiert waren. Aber sie hatten auch Aspekte, die reine Barbarei waren. Ein Beispiel: die Sklaverei. In der griechischen und römischen Gesellschaft bestand der Großteil der Bevölkerung aus Sklaven, die als Eigentum ihrer Herren galten – bis zu dem Punkt, daß man sie ungestraft töten oder foltern durfte, wie Tiere. Das war erlaubt!
Kann man ein Volk, das prächtige Gebäude errichtete, aber den Menschen so behandelte, „zivilisiert“ nennen?
Man kann also sagen, daß das antike Griechenland eine Mischung aus Zivilisation und Barbarei war. Dasselbe gilt für alle antiken Kulturen, in denen man entsetzliche Elemente findet.
Bleiben wir bei den Griechen: Die Götter ihrer klassischen Mythologie waren elegant, literarisch, bildhauerisch schön, geeignet für künstlerische Darstellungen – aber sie waren nicht der einzige Gegenstand der griechischen Religion. Es gab auch andere Kulte, darunter – so unangenehm es ist, das auszusprechen, aber es ist wahr – phallische Kulte.
Was war ein phallischer Kult? Es war der offiziell anerkannte Kult des männlichen Sexualorgans. Man errichtete riesige Statuen dieses Organs und organisierte öffentliche Prozessionen zu seinen Ehren – sogar in Athen.
Hätten das Barbaren getan, hätte man es für normal gehalten, weil sie Barbaren waren. Aber es waren die großen Griechen, die das taten!
Und was müßten wir erst alles über die Römer erzählen?
Kurzum: Es war keine vollständige Zivilisation. Hätten sie den wahren katholischen Glauben besessen, hätten sie eine vollkommene Zivilisation hervorgebracht. Ihre Kunst wäre noch erhabener gewesen, und viele entsetzliche Aspekte ihrer gesellschaftlichen, politischen und moralischen Strukturen wären grundlegend anders gewesen.
Daraus folgt: Je mehr die Menschheit Jesus Christus kennt und Seiner Kirche gehorcht, desto mehr findet sie zu Zivilisation, Ordnung, Herrlichkeit und Frieden. Je mehr sie sich von Ihm entfernt, desto mehr gleitet sie in die Auflösung und schließlich in den Untergang ab.
Wenn das wahr ist – und das ist die große grundlegende Wahrheit, auf der die Gesellschaft für Tradition, Familie, Privateigentum beruht –, dann ist alles, was die TFP sagt, leicht zu beweisen. Wenn es hingegen nicht wahr wäre, könnte fast nichts von dem, was sie behauptet, als bewiesen gelten.
Wenn diese fundamentale Wahrheit echt ist, ergibt sich daraus: Die Ursache der heutigen Krise ist eine religiöse.
Wenn die Menschen zur wahren Religion zurückkehren, wird sich alles nach und nach ordnen. Wenn aber jene, die sich entfernt haben, sich nicht bekehren, wird nichts gut ausgehen. Man kann Gesetze erlassen, Vorschriften aufstellen, Strukturen schaffen wie die UNO… aber man wird nur Katastrophen erleben: Konflikte, Mißverständnisse, Betrug, Barbarei.
Der Beweis dafür ist der deutliche Trend der modernen Welt zur Barbarei.
Eine der einflußreichsten philosophischen Strömungen unserer Zeit ist der Strukturalismus. Einer ihrer führenden Vertreter ist der bekannte Anthropologe Claude Lévi-Strauss.
Er behauptet in seinen Büchern, das „Goldene Zeitalter“ der Menschheit sei das Paläolithikum gewesen – also der Beginn der Vorgeschichte, nicht einmal das Neolithikum! Laut ihm müssen wir zum Paläolithikum zurückkehren.
Das ist der Widerspruch der Moderne: ein „Fortschritt“, der die Rückkehr zur Barbarei predigt. Die moderne Welt bringt Barbarei hervor, weil ihre Wurzeln selbst barbarisch sind: Unglauben und Gottlosigkeit.
In einer normalen Zeit könnte ich meine Ausführungen hier beenden und einfach sagen: „Laßt uns gute Katholiken sein.“
Aber in der heutigen Zeit reicht das nicht. Sofort stellt sich eine weitere Frage: Was bedeutet es überhaupt, ein guter Katholik zu sein?
Heute sehen wir die katholische Kirche in mindestens zwei große Strömungen gespalten: die progressistische und die traditionalistische. Die Auffassungen dieser beiden Richtungen stehen sich diametral gegenüber. Sie widersprechen sich vollständig.
Es ist unmöglich, daß beide recht haben – denn zwei einander widersprechende Positionen können nicht gleichzeitig wahr sein. Entweder die eine hat recht – oder keine von beiden.
Ich stelle daher die Frage: Welche dieser beiden Strömungen hat recht innerhalb der katholischen Kirche? Und: Welchen Einfluß hat diese Spaltung der Kirche auf die heutige Welt?
Um das zu beantworten, müssen wir zunächst klären: Was ist Progressismus – aus Sicht der Progressisten selbst?
Ich möchte hier keine Definition als Traditionalist geben – man könnte mir Voreingenommenheit vorwerfen.
Die Progressisten bezeichnen sich selbst so, weil sie sagen: Die Menschheit ist ständig im Wandel – also muß auch die Religion sich diesem Wandel anpassen. Die Religion muß sich stets verändern, die Denkweise der Welt übernehmen und sie widerspiegeln, um sie anziehen zu können. Das ist das genaue Gegenteil dessen, was ein Traditionalist denkt.
Für den Traditionalisten gilt: Wenn die Religion die Wahrheit lehrt – und die Wahrheit ist eine und unveränderlich –, dann darf sich die katholische Lehre niemals ändern.
Wenn das göttliche Gesetz sagt: „Du sollst nicht töten“, dann muß das bis zum Ende der Welt verboten bleiben. Denn es ist ein göttliches Gebot, das die Natur widerspiegelt – und das, was in der Natur grundlegend ist, kann niemals verändert werden.
Durch eine lebendige Überlieferung müssen Gegenwart und Zukunft in Kontinuität mit der Vergangenheit bleiben – zumindest in den grundlegenden Dingen (nicht in den nebensächlichen). Das nennen wir Tradition.
Wir sind also Traditionalisten, weil wir glauben, daß es unveränderliche Wahrheiten und Prinzipien gibt – so wie es Elemente der Natur gibt, die sich nie verändern.
Unser Herr Jesus Christus hatte recht, als Er sagte: „Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen“ – und als Er erklärte, daß Er nicht gekommen sei, um das Gesetz aufzuheben, nicht einmal das kleinste Teil davon, sondern um es zu erfüllen.
Er war also ein Traditionalist: Er bewahrte die Tradition und vollendete sie durch Seine Lehre.
Die Progressisten hingegen wollen, daß sich alles ändert.
Am Ursprung dieses Gegensatzes steht ein unterschiedliches Verständnis der Sendung der Kirche:
- Für uns Traditionalisten ist die Kirche das feste Maß, an dem sich die Welt zu orientieren hat;
- Für die Progressisten ist die Welt das wandelbare Maß, an das sich die Kirche anpassen muß.
Darin liegt der totale Konflikt.
Aber wo steht Gott in diesem Ganzen?
Gott, der Ewige und Unveränderliche, der Mensch geworden ist, der zu Mose gesprochen hat, der die Zehn Gebote gegeben hat, der in Jesus Christus Mensch wurde und uns die Lehre des Evangeliums hinterließ – kann dieser Gott etwa vom Menschen „aktualisiert“ werden?
Hat der Mensch das Recht, die Fähigkeit oder die Macht, nach Belieben zu korrigieren, was Gott festgelegt hat?
Jeder versteht, daß eine Religion, die den Menschen über Gott stellt – ihm also erlaubt, Gott zu korrigieren –, keine Religion ist, sondern eine Anti-Religion: das genaue Gegenteil dessen, was Religion bedeutet.
Das ist so offensichtlich, daß es keiner weiteren Beweisführung bedarf.
Gehen wir weiter.
Wenn das alles so ist, dann ist der große Kampf unserer Zeit nicht nur – und ich sage: nicht einmal in erster Linie – der zwischen Katholiken und Kommunisten oder anderen Nicht-Katholiken.
Man muß innerhalb der Kirche selbst gegen die falschen Brüder kämpfen, gegen die falschen Katholiken, um sie aus der Kirche zu entfernen – damit die Kirche selbst sie tadelt und, wenn sie sich nicht bekehren, endgültig ausschließt.
Diese innere Reinigung der Kirche ist der Ausgangspunkt für alles andere. Eine in weiten Teilen abgeirrte Kirche kann der Welt keinen wahren Weg weisen. Wer selbst in die Irre gegangen ist, kann niemanden auf den rechten Weg führen.
Im Evangelium finden wir das Gleichnis vom Blinden, der einen anderen Blinden führt: Beide stürzen in die Grube.
Genauso ist es mit den Progressisten, die andere Progressisten anführen: Blinde, die Gott korrigieren wollen, anstatt sich von Ihm führen zu lassen – und so stürzen sie in den Abgrund.
Daher müssen wir ihnen das Recht absprechen, sich katholisch zu nennen – und der Welt zeigen, daß die wahren Katholiken diejenigen sind, die die Tradition bewahren – unter ihnen die Mitglieder der TFP.
Das wahre Zentrum des heutigen Kampfes – dieses gigantischen Kampfes zwischen Wahrheit und Irrtum, zwischen Gut und Böse, der überall tobt – liegt im Herzen der Heiligen Katholischen, Apostolischen und Römischen Kirche: der Konflikt zwischen Traditionalisten und Progressisten.
Das bedeutet nicht, daß sich die TFP nur auf den Kampf gegen die Progressisten beschränkt.
Ihr wißt gut, wie sehr die TFP auch gegen Kommunisten kämpft, gegen die Verfechter der Scheidung und andere Gegner. Doch unser Hauptfeind, also jene, die uns am meisten hassen und die wir vorrangig besiegen müssen, sind die Progressisten.
Ohne Zweifel sind wir ihr Hauptziel. Und das wissen wir aus direkter Erfahrung – wir haben es am eigenen Leib gespürt.
Die TFP ist wie eine kleine Trompete – aber eine mächtige. Ihre (der Progressisten) Trompete ist riesig – aber gibt kaum einen Ton von sich.
Nehmen wir also unsere Trompete, und blasen wir sie mit aller Kraft – zu Ehren der Allerheiligsten Jungfrau Maria –, damit ihr, die Jugendlichen, lernt, wie man das tut, damit ihr es tun wollt und es mit ganzer Liebe tut, sodaß unsere Trompete den herrlichen Klang hat, den sie haben muß.
Deshalb gibt es diese Studienwoche.
Möge die Heiligste Jungfrau Maria, zu deren Ehren diese Woche abgehalten wird, euch segnen und euch reichlich Frucht daraus ziehen lassen.
*Plinio Corrêa de Oliveira (1908–1995) war ein großer katholischer Denker und Gegenrevolutionär des 20. Jahrhunderts, er lehrte zunächst Kulturgeschichte an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Sao Paulo und wurde dann Professor für Neuere Geschichte und Zeitgeschichte an der Philosophischen Fakultät Sao Bento und an der Päpstlichen Katholischen Universität von Sao Paulo. Sein Leben widmete der brasilianische Philosoph, Historiker und Politiker der Verteidigung der katholischen Kirche und der katholischen Soziallehre. Konkret bedeutete das für ihn, den Kampf gegen die antichristlichen Ideologien Marxismus und Nationalsozialismus aufzunehmen. Während letztere mit dem Jahr 1945 verschwand, blieb der Marxismus in seiner Heimat Brasilien und weltweit eine Bedrohung, der er sich entgegenstellte. Sein Hauptwerk ist „Revolution und Gegenrevolution“. Plinio Corrêa de Oliveira gründete die Gesellschaft für Tradition, Familie und Privateigentum (TFP), die heute in verschiedenen Ländern aktiv ist, darunter in der Bundesrepublik Deutschland und in Österreich.
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Corrispondenza Romana