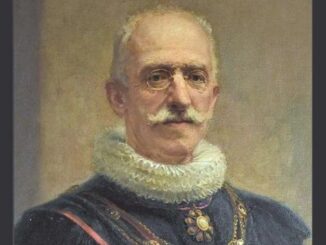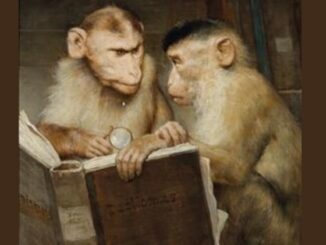Von Roberto de Mattei*
Das Pontifikat des heiligen Gregor VII. (1073–1085), mit bürgerlichem Namen Hildebrand von Soana, stellt eine der Sternstunden des christlichen Mittelalters dar. Der Höhepunkt seines Pontifikats ist der Dictatus Papae, eine Sammlung von 27 Leitsätzen, die die Vorrechte des Papstes und sein Verhältnis zur weltlichen Gewalt festlegen. Dabei wird die Überordnung des Papstes über den Kaiser in religiösen und moralischen Belangen betont und dem Papsttum die höchste und vornehmste Macht auf Erden zugeschrieben. Dieses Werk entstand vermutlich zwischen 1075 und 1078, inmitten des schärfsten Konflikts mit dem deutschen König Heinrich IV., der zu jener Zeit noch nicht zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt war und den sogenannten Investiturstreit gegen die Kirche entfacht hatte.
„Der römische Papst“, so erklärt Gregor VII., „wird mit Recht universal genannt“ (Nr. 2); „sein Titel ist einzigartig auf der Welt“ (Nr. 11); „kein Mensch kann seine Entscheidung widerrufen, hingegen kann er jede andere Entscheidung aufheben“ (Nr. 18); „niemand kann ihn richten“ (Nr. 19); „die römische Kirche hat niemals geirrt und wird gemäß der Schrift auch ewiglich nicht irren“ (Nr. 22); ferner steht es dem Papst zu, „Kaiser abzusetzen“ (Nr. 12) und „die Untertanen von ihrer Treuepflicht gegenüber Ungerechten zu entbinden“ (Nr. 27).
Auf theologischem Gebiet weist Gregor VII. unter Berufung auf seine Rolle als universaler Hirt die Behauptung zurück, daß der Papst nicht berechtigt sei, Könige zu exkommunizieren und deren Untertanen vom Treueeid zu entbinden. Seine Lehre stützt sich auf die Worte Christi an den heiligen Petrus, dem die Vollmacht verliehen wurde, zu binden und zu lösen, im Himmel wie auf Erden, sowie auf verschiedene Aussagen Gregors des Großen und anderer Kirchenväter. Gregor fragt sich, wie man ernsthaft behaupten könne, jemand, der über den Himmel entscheiden darf, sei nicht befugt, irdische Angelegenheiten zu richten. Petrus, so Gregor, sei über die Reiche der Erde gesetzt worden; Gott habe ihm alle Fürstentümer und Gewalten der Welt unterworfen und ihm die Macht gegeben, sowohl im Himmel als auch auf Erden zu binden und zu lösen. Könige und Kaiser stehen nicht über dem göttlichen und natürlichen Gesetz, dem alle Menschen unterworfen sind und dessen Hüterin die Kirche ist.
In Konsequenz dieser Lehre setzte Gregor VII. auf der Synode im Februar 1076 König Heinrich IV. ab und exkommunizierte ihn, wobei er dessen Untertanen vom Treueeid entband. Die Exkommunikation und Absetzung Heinrichs wurde auf der römischen Synode von 1080 erneuert, auf der Gregor die Wahl Rudolfs von Schwaben zum Gegenkönig bestätigte.
Als im Jahr 1119 in Cluny Guido von Burgund, der Erzbischof von Vienne, unter dem Namen Calixt II. (1119–1124) zum Papst gewählt wurde, berief er sich auf die Lehren Gregors VII. Am 29. und 30. Oktober desselben Jahres verurteilte ein großes Konzil in Reims, an dem über 400 Bischöfe teilnahmen, erneut den Kaiser, nunmehr Heinrich V., den Sohn Heinrichs IV. Als der Papst die Exkommunikation aussprach, zerbrachen die 400 Bischöfe symbolisch die Kerzen, die sie in den Händen hielten. Das Wormser Konkordat von 1122, das den Investiturstreit beendete, erkannte die universelle geistliche Oberhoheit der Kirche an sowie ihre indirekte Macht im weltlichen Bereich. Im März 1123 konnte Calixt II. das neunte Ökumenische Konzil im Lateran einberufen, das erste Gesamtkonzil der abendländischen Kirche. Dort wurde das neue Einvernehmen zwischen Kirche und Reich feierlich bestätigt.
Besondere Beachtung fand der achte Leitsatz des Dictatus Papae, dem zufolge „nur der Papst kaiserliche Insignien tragen darf“. Dieser Satz bringt die gesamte mittelalterliche politische Theologie auf den Punkt. Die Kirche ist nicht nur die höchste geistliche Autorität, sondern auch die Quelle kaiserlicher Macht. Sie besitzt zwei Zwangsmittel: das geistliche – in Form kirchlicher Strafen – und das weltliche, nämlich das Recht zur bewaffneten Gewalt (vis armata), das die kanonisch-rechtliche Grundlage der Kreuzzüge bildete, die im Namen dieser päpstlichen Autorität ausgerufen wurden. Diese These formulierte unter anderem der heilige Bernhard von Clairvaux in seinem Traktat De consideratione, in dem er Papst Eugen III. daran erinnert, daß beide Schwerter – das geistliche wie das weltliche – dem Papst und der Kirche gehören. In der Kunst jener Zeit wird der Papst stets an der Spitze dargestellt: Der Kaiser steht zu seiner Linken, eine Stufe unter ihm, darunter wiederum alle Könige und Fürsten der Welt sowie schließlich die Mitglieder der geistlichen Hierarchie, die den spirituellen Bereich verwalten.
Aus dieser Lehre folgt das Recht, Könige zu exkommunizieren und abzusetzen – eine Lehre, die über das Mittelalter hinauswirkt. Im Jahr 1535 erklärte Papst Paul III. den englischen König Heinrich VIII. für abgesetzt. Und Papst Pius V. sprach am 25. Februar 1570 gegen Königin Elisabeth I. von England eine Bannbulle aus, in der er sie als Häretikerin verurteilte, exkommunizierte und für unfähig erklärte, den Thron zu beanspruchen. Ihre Untertanen seien nicht mehr an den Treueeid gebunden und dürften ihr unter Androhung der Exkommunikation keinen Gehorsam leisten.
Der heilige Robert Bellarmin erläutert im fünften Buch seines Werkes De Romano Pontifice, daß der Papst zwar nicht kraft göttlichen Rechts eine direkte weltliche Gewalt ausübt, wohl aber eine weitreichende indirekte Jurisdiktion besitzt – eine Lehre, die er ebenfalls auf den Dictatus Papae Gregors VII. stützt. Diese Position wurde später vom kirchlichen Lehramt anerkannt und fand sich auch in den Lehrbüchern des Kirchenrechts zweier bedeutender Juristen des 20. Jahrhunderts wieder: von Pater Luigi Cappello und von Kardinal Alfredo Ottaviani. Nach diesen Werken wurden Generationen von Klerikern ausgebildet. Kardinal Alfons Maria Stickler hat diese Sichtweise in seinen Studien zur Geschichte des kanonischen Rechts bestätigt. Das Recht, einen Fürsten zu exkommunizieren und abzusetzen, gründet in der plenitudo potestatis – der Fülle der Vollmacht – der Kirche, die sich auf ihr göttliches Recht zu binden und zu lösen stützt.
Der Dictatus Papae Gregors VII. ist somit – neben anderen bedeutenden Dokumenten wie der Bulle Unam Sanctam von Bonifaz VIII. oder dem Syllabus errorum von Pius IX. – ein Schlüsseltext zum Verständnis der kirchlichen Lehre über das Verhältnis zwischen geistlicher und weltlicher Ordnung.
Der heilige Gregor VII. gab der tiefgreifendsten Kirchenreform des Mittelalters seinen Namen – eine echte geistliche und moralische Erneuerung, die sich auch auf die plenitudo potestatis, die Fülle der Vollmacht des Stellvertreters Christi, gründete. Gregor VII. hatte den Wunsch, diese Reform durch einen großen Kreuzzug gegen die Ungläubigen zu vollenden – doch dieses Vorhaben blieb seinem Schüler, dem seligen Urban II., einem Benediktiner aus Cluny, vorbehalten, der den Kreuzzug schließlich ausrief. Aus dem Geist der gregorianischen und cluniazensischen Reform entstand – unter dem Ruf Deus lo vult („Gott will es!“) – das große Epos der Kreuzzüge: eine der leuchtendsten Seiten der Kirchengeschichte zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert.
*Roberto de Mattei, Historiker, Vater von fünf Kindern, Professor für Neuere Geschichte und Geschichte des Christentums an der Europäischen Universität Rom, Vorsitzender der Stiftung Lepanto, Autor zahlreicher Bücher, zuletzt in deutscher Übersetzung: Verteidigung der Tradition: Die unüberwindbare Wahrheit Christi, mit einem Vorwort von Martin Mosebach, Altötting 2017, und Das Zweite Vatikanische Konzil. Eine bislang ungeschriebene Geschichte, 2. erw. Ausgabe, Bobingen 2011.
Bücher von Prof. Roberto de Mattei in deutscher Übersetzung und die Bücher von Martin Mosebach können Sie bei unserer Partnerbuchhandlung beziehen.
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Corrispondenza Romana