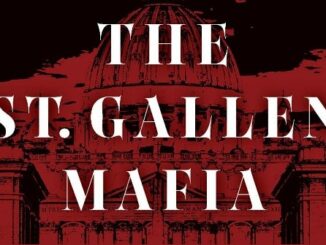Von Roberto de Mattei*
Johannes, der Sohn des Zebedäus und der Salome, hatte die Ehre, aus dem Geschlecht Davids geboren zu sein, aus der Familie der Gottesmutter. Er war also ein Verwandter unseres Herrn, dem Fleisch nach, wie sein Bruder Jakobus der Ältere, und wie Jakobus der Jüngere und Judas, Söhne des Alphäus. In der Blüte seiner Jugend folgte Johannes Christus nach und blickte nie zurück. Er war nicht nur Jünger und Apostel, sondern auch ein Freund des Gottessohnes, „der Jünger, den Jesus liebte“. Der Grund für diese seltene Bevorzugung war, wie Dom Guéranger sagt, das Opfer der Jungfräulichkeit, das Johannes‘ reinste Seele dem Gottmenschen darbrachte. Johannes hat diese jungfräuliche Unschuld immer bewahrt. Er war kein Märtyrer, aber nach dem Blutopfer war das Opfer der Jungfräulichkeit das edelste und mutigste Opfer.
Die Jungfräulichkeit verschaffte Johannes erhabene Vorrechte, angefangen bei seiner Fähigkeit zur Liebe.
Wer die Macht der Liebe kennt, kennt auch die Macht des Hasses. Deshalb ist der Evangelist, der am ausführlichsten über den Verrat des Judas spricht, Johannes, der Apostel der Liebe, „derselbe, der sich beim Abendmahl an seine Brust legte und ihn fragte: Herr, wer ist es, der dich verraten wird“ (Joh 21,20). Indem er sein Haupt an die Brust des Gottmenschen legte, schöpfte Johannes aus der göttlichen Gnadenquelle im Herzen Jesu, wo „alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind“ (Kol 2,3). Die Weisheit, die aus der Liebe geboren wird, sollte den Rest seines Lebens prägen.
Natürlich gehörte auch er zu den Aposteln, die nicht in der Lage waren, mit Jesus in der Stunde von Gethsemane zu wachen, aber er war neben Petrus der einzige, der dem nächtlichen Prozeß Jesu im Hof des Hauses des Kaiphas beiwohnte (Joh 18,15–16), und anders als Petrus verleugnete er den göttlichen Meister nicht.
Vor allem aber war Johannes der einzige Apostel, der am Fuße des Kreuzes anwesend war, wo Jesus, „als er seine Mutter und den Jünger, den er liebte, sah, zu seiner Mutter sagte: ‚Frau, siehe, dein Sohn‘, und sich an Johannes wandte: ‚Siehe, deine Mutter‘“ (Joh 19,26–27). Bischof Pier Carlo Landucci schreibt aufschlußreiche Seiten, um zu erklären, wie in diesen Worten Jesu die geistliche Mutterschaft Marias, der Allerheiligsten, für alle Erlösten, vertreten durch den Apostel, direkt verkündet wird (Maria SS.ma nel Vangelo, Edizioni Paoline, Roma 1954, S. 395–414). Darüber hinaus hat Jesus mit diesen Worten ein göttliches Band zwischen der Gottesmutter und der geistlichen Familie derer geknüpft, die sich im Laufe der Jahrhunderte durch ihre Verehrung Mariens auszeichnen sollten, indem sie in ihr die Mutter Gottes und der Menschheit, die Miterlöserin und universale Mittlerin aller Gnaden sahen.
Nach dem Tod Jesu gehörte Johannes zu der kleinen Prozession, die ihn zur Beerdigung begleitete, zusammen mit Maria, den frommen Frauen, Nikodemus und Josef von Arimathäa. Die beiden eifrigsten Jünger, Petrus und Johannes, waren die ersten, die dann zum Grab eilten, um mit eigenen Augen zu sehen, was die frommen Frauen berichtet hatten. Johannes kam zuerst an, blieb aber stehen und ließ Petrus vor ihm eintreten. Es war ein Akt der Ehrerbietung gegenüber demjenigen, den der Herr als Haupt der Kirche eingesetzt hatte, und zeigte damit, daß der mystische Leib eine sichtbare Gesellschaft ist, in der die Autorität des Stellvertreters Christi verehrt werden muß. Als Petrus und Johannes, die ersten unter den Aposteln, das Tuch sahen, in das der Leib Jesu eingewickelt worden war, und auf der anderen Seite das Leichentuch, mit dem sein Haupt bedeckt worden war, glaubten sie an die Auferstehung und erinnerten sich an das, was der Herr selbst vorausgesagt hatte (Joh 20,2–9). Bei der Erscheinung in Galiläa war Johannes auch der erste, der den auferstandenen Meister erkannte (Joh 21,7).
In den Jahren nach Pfingsten hielt sich Johannes gewöhnlich in Jerusalem auf. Als der heilige Paulus um das Jahr 50 in die Heilige Stadt zurückkehrte, fand er dort Jakobus, Petrus und Johannes vor, die als Säulen der Kirche in Jerusalem galten (Gal 2,1–9), und es ist anzunehmen, daß die Gottesmutter immer bei demjenigen geblieben war, dem sie von ihrem göttlichen Sohn anvertraut worden war.
Später, so die Überlieferung, zogen Maria und Johannes nach Ephesus. Das Haus Mariens auf dem Berg Solmissos in der Nähe von Ephesus, heute in der Türkei, wird als der Ort verehrt, an dem die Jungfrau die letzten Jahre ihres Lebens verbrachte. Johannes befand sich um das Jahr 92 n. Chr., während der Herrschaft von Kaiser Domitian, in Rom. Der Kaiser befahl, Johannes in der Nähe der Porta Latina in Rom in einen Kessel mit siedendem Öl zu tauchen. Durch ein Wunder blieb Johannes unverletzt und wurde dann auf die Insel Patmos verbannt, wo er die Schauungen empfing, die er im Buch der Geheimen Offenbarung niederschrieb.
Johannes war der einzige Apostel, der nach seiner Rückkehr von Patmos nach Ephesus eines natürlichen Todes starb, und zwar im Alter von etwa neunzig Jahren. Sein Grab, ein Wallfahrtsort, befindet sich in der Krypta einer Basilika, die Kaiser Justinian im 6. erbauen ließ.
Gegen Ende des 1. Jahrhunderts war der Evangelist Johannes eine Stütze im Kampf gegen die frühen Häretiker, insbesondere gegen die Anhänger des Doketismus und der Gnosis, die er als „Antichristen“ bezeichnete (1 Joh 2,18–22). Der Doketismus behauptete, daß Jesus nur eine scheinbare menschliche Gestalt hatte und daß sein Leiden und sein Tod nur Illusionen waren [da es ihnen unvorstellbar schien, daß Gott sich zum niedrigen Menschen machte und wie ein solcher leiden und sterben könnte]. Johannes hält dem in seinem Evangelium entgegen, daß „das Wort Fleisch geworden ist“ (Joh 1,14), und bekräftigt, daß Jesus der Gottmensch ist, der wahrhaftig inkarniert ist. Der heilige Irenäus von Lyon bestätigt in seiner Widerlegung der Häresien, daß der Apostel Johannes das Evangelium und seine Briefe geschrieben hat, um Häresien zu bekämpfen, insbesondere „um den von Kerinth verbreiteten Irrtum zu zerstören“, einem Gnostiker, der „lehrte, daß Jesus nicht von einer Jungfrau geboren wurde, sondern der Sohn von Josef und Maria war, wie alle anderen Menschen“, und daß er allein „den anderen an Gerechtigkeit, Klugheit und Weisheit überlegen war“ (Adversus Haereses, I, 26, 1). Der Historiker Eusebius von Caesarea berichtet, daß Johannes aus einem öffentlichen Badehaus floh, um nicht mit Kerinth, einem Feind der Wahrheit, unter ein Dach zu kommen (Kirchengeschichte, III, 28).
Die Gnosis war eine esoterische Strömung, der zufolge das Heil von einem geheimen Wissen herrührte, das einer Gruppe von Eingeweihten vorbehalten war. Gegen diese Häresie betont Johannes in seinen Briefen die Bedeutung der von Christus empfangenen Wahrheit und der Liebe als Zeichen des wahren Glaubens. In seinen Briefen erklärt er den Menschen, daß derjenige, der nicht liebt, Gott, der die Liebe ist, nicht kennt (Joh 4,8). Bis zum Ende seines Lebens hat der Evangelist auf der Liebe bestanden, die die Menschen einander schuldig sind, indem sie dem Beispiel Gottes folgen, der sie geliebt hat; und wie er deutlicher als andere die Göttlichkeit und die Herrlichkeit des Wortes verkündet hat, so hat er sich auch mehr als andere als Apostel jener unendlichen Liebe erwiesen, die der Erlöser auf die Erde gebracht hat.
Johannes ist der Schutzpatron all derer, die die Wahrheit der Liebe verteidigen und aus Liebe die Wahrheit verteidigen. Der Adler, der ihn traditionell darstellt, ist ein Symbol für die schwindelerregende Höhe, zu der seine Gefühle und Gedanken aufstiegen.
*Roberto de Mattei, Historiker, Vater von fünf Kindern, Professor für Neuere Geschichte und Geschichte des Christentums an der Europäischen Universität Rom, Vorsitzender der Stiftung Lepanto, Autor zahlreicher Bücher, zuletzt in deutscher Übersetzung: Verteidigung der Tradition: Die unüberwindbare Wahrheit Christi, mit einem Vorwort von Martin Mosebach, Altötting 2017, und Das Zweite Vatikanische Konzil. Eine bislang ungeschriebene Geschichte, 2. erw. Ausgabe, Bobingen 2011.
Bücher von Prof. Roberto de Mattei in deutscher Übersetzung und die Bücher von Martin Mosebach können Sie bei unserer Partnerbuchhandlung beziehen.
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Corrispondenza Romana