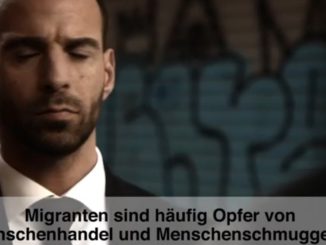(Rom) Einiges Rätselraten verordnete Papst Franziskus der Christenheit mit seinem diesjährigen österlichen Segen Urbi et orbi.
Wie gewohnt, trat Papst Franziskus am Ostersonntag, dem 9. April, auf die Segensloggia des Petersdoms. Von dort aus richtete er seine Osterbotschaft an die Welt. Anschließend spendete er der Stadt Rom und dem ganzen Erdkreis den päpstlichen Segen.
Seine Botschaft enthielt jedoch eine etwas merkwürdige Besonderheit. Er sagte laut offizieller deutscher Übersetzung des Heiligen Stuhls:
„Die Kirche und die Welt sollen sich freuen, denn heute werden unsere Hoffnungen nicht mehr an der Mauer des Todes zerschmettert, sondern der Herr hat uns eine Brücke zum Leben geöffnet. Ja, Brüder und Schwestern, an Ostern hat sich das Schicksal der Welt verändert, und am heutigen Tag, der noch dazu auf das wahrscheinlichste Datum der Auferstehung Christi fällt, dürfen wir uns darüber freuen, aus reiner Gnade den wichtigsten und schönsten Tag der Geschichte zu feiern.“
Das genaue Todes- und Auferstehungsdatum Jesu Christi ist nicht überliefert. Das heißt: Monat und Tag lassen sich prinzipiell errechnen, doch das Jahr ist nicht bekannt, was wiederum Rückwirkung auf die Errechnung von Tag und Monat hat. Die Kirche hat sich wegen der Unsicherheiten, aber auch noch aus einem ganz anderen Grund auf kein exaktes Jahr festgelegt.

Papst Franziskus scheint dies nun aber bis zu einem bestimmten Grad getan zu haben. Aus seiner Aussage in der Osterbotschaft, die am 9. April erfolgte, ergibt sich, daß er den 9. April für „das wahrscheinlichste Datum der Auferstehung Christi“ hält. Das würde bedeuten, daß Christus am 7. April des Jahres 30 n. Chr. ans Kreuz geschlagen wurde.
Neben diesem Datum wird der 3. April des Jahres 33 n. Chr. am häufigsten diskutiert. Es ist allerdings nicht bekannt, worauf sich die Aussage von Papst Franziskus für diese Art der „Festlegung“ stützt.
Theorien und Hypothesen gibt es zahlreiche und ebenso viele vorgeschlagene Daten. Der 7. April 30 n. Ch. als Todestag Jesu Christi wurde am 12. April 1952 auch in der New York Times präsentiert. Es handelte sich um die Forschungsergebnisse des Vatikandiplomaten Msgr. Francesco Borgongini Duca.
Der Titularerzbischof von Heraclea in Europa war an der Römischen Kurie als Sekretär der Kongregation für die außerordentlichen kirchlichen Angelegenheiten (heute eine Sektion des Staatssekretariats) an den Verhandlungen für die Lateranverträge beteiligt. Nach deren Unterzeichnung ernannte ihn Papst Pius XI. 1929 zum ersten Apostolischen Nuntius für Italien. Dieses Amt übte Msgr. Borgongini Duca bis 1953 aus. Seit 1933 war er zudem Päpstlicher Administrator der Patriarchalbasilika Sankt Paul vor den Mauern in Rom und seit 1934 auch Päpstlicher Administrator des Loreto-Heiligtums in den Marken. Drei Tage nach seiner Emeritierung als Nuntius erhob ihn Papst Pius XII. in den Kardinalsrang. Kardinal Borgongini Duca starb im Oktober 1954 im Alter von 70 Jahren.
Borgongini Duca hatte nicht nur Theologie und Kirchenrecht studiert, sondern war auch ein anerkannter Bibelwissenschaftler, der einige Jahre an der Päpstlichen Universität Urbaniana und am Römischen Seminar gelehrt hatte. In dieser Zeit vor dem Ersten Weltkrieg stellte er sich in theologischen Disputen energisch modernistischen Autoren entgegen, vor allem Ernesto Buonaiuti, der 1921 exkommuniziert wurde. Mit mehreren diplomatischen Noten protestierte er gegen die antijüdischen Rassengesetze, die der italienische Faschismus in Nachahmung des Nationalsozialismus erlassen hatte.
Elf Jahre beschäftigte er sich intensiv mit der Frage des Todes- und Auferstehungsdatums, ehe er 1951 seine Ergebnisse mit dem Titel „Le LXX Settimane di Daniele e le date messianiche“ („Die 70 Wochen des Daniel und die messianischen Daten“) in Buchform vorlegte. Der spätere Kardinal ging von einer Prophetie des Propheten Daniel aus:
„Siebzig Wochen sind für dein Volk / und deine heilige Stadt bestimmt, bis der Frevel beendet ist, / bis die Sünde versiegelt und die Schuld gesühnt ist, bis ewige Gerechtigkeit gebracht wird, / bis Visionen und Weissagungen besiegelt werden / und ein Hochheiliges gesalbt wird“ (Dan 9,24).
Die Theorie Bogongini Ducas, die hier nicht näher dargestellt werden soll, stieß seinerzeit auf großes Interesse, wie der Artikel in der New York Times zeigte. Der spätere Kardinal leitete aus seinen theologischen Studien keine konkreten Anregungen bezüglich Kirchenjahr und Liturgie ab.
Solchen wäre nämlich eine große Hürde entgegengestanden. Die Streitigkeiten in frühchristlicher Zeit hatten rund 290 Jahre nach Christi Tod und Auferstehung zu einer Entscheidung geführt: Selbst wenn man das genaue Todes- und Auferstehungsdatum wüßte, bliebe die Frage im Raum, ob dann exakt dieses Datum jedes Jahr gefeiert werden sollte, was einer statischen Engführung entsprechen würde. Die Christenheit bevorzugte dagegen eine dynamische Lösung, die jedes Jahr vom ersten Vollmond nach der Tagundnachtgleiche im Frühjahr ausgeht und es erlaubt, den Gründonnerstag tatsächlich an einem Donnerstag, den Karfreitag tatsächlich an einem Freitag und den Ostersonntag eben an einem Sonntag zu feiern. Würde man jedes Jahr ein exaktes Datum, etwa den 7. April, begehen, wären der Karfreitag wie der Ostersonntag in den meisten Jahren irgendwelche Wochentage.
Es waren unter anderem die Streitigkeiten um diese Frage, die Kaiser Konstantin den Großen veranlaßten, im Jahr 325 das Konzil von Nicäa einzuberufen. Dieses entschied, kein exaktes Datum festzulegen, sondern Ostern gemäß der Darstellung in den Evangelien immer am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach der Frühlings-Tagundnachtgleiche zu feiern.
Wie gesagt, es ist nicht bekannt, worauf sich Papst Franziskus in seiner „Festlegung“ stützt, und ebenso wenig, was ihn veranlaßte, dieses Thema in seiner Osterbotschaft aufzugreifen.
Siehe zu Datierungsfragen auch:
Text: Giuseppe Nardi
Bild: Vatican.va (Screenshot)